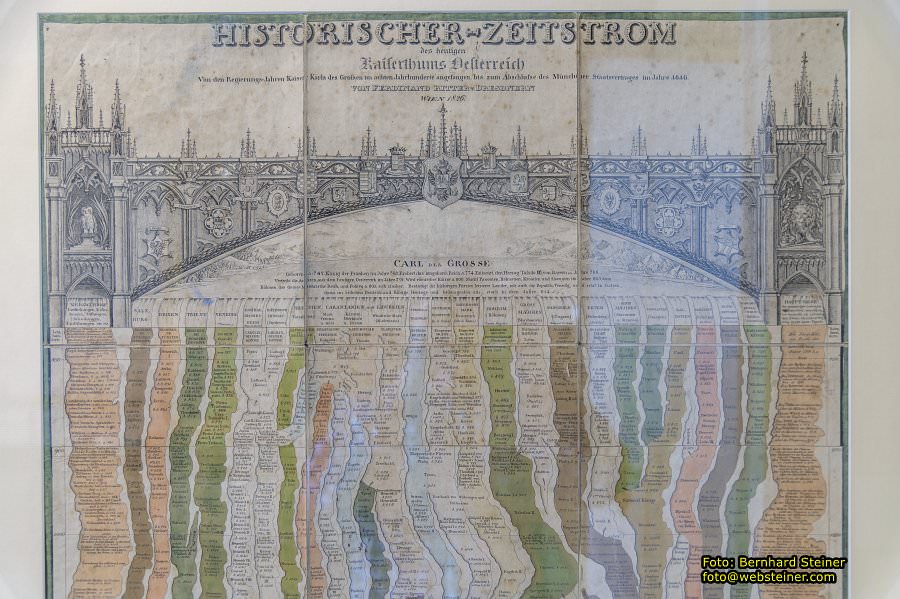web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Kaiser-Franz-Josef-Museum
Baden, Mai 2023
Tauchen Sie in eine Zeit
ein, in der Baden eine der mondänsten Kurmetropolen der großen
Habsburger-Monarchie war. Erleben Sie den Einfluss dieser einst
mächtigsten Familie der Welt auf die Thermenstadt anhand von Objekten
und der atmosphärischen Gestaltung der Säle. Hier wird der Alltag des
Bürgertums, aber auch der einfachen Leute, wie in vielen Kleinstädten
des „alten“ Österreich, vermittelt.

Das Kaiser-Franz-Josef-Museum ist ein Museum am Rande des Wienerwaldes
in Baden bei Wien in Niederösterreich. Die historischen Sammlungen des
Museums bestehen vorwiegend aus volkskundlichen Objekten und
Handwerkserzeugnissen sowie Objekten der Alltagskultur, die zum
Großteil in Niederösterreich entstanden sind. Zudem gibt es eine
ansehnliche historische Essbestecksammlung, eine Sammlung religiöser
Volkskunst, eine Sammlung historischer Waffen und Uniformen sowie eine
kleine Sammlung von Objekten vorindustrieller Strafjustiz.

Schmiedeeisenes Fahrrad um 1880 - wunderschöne Schmiedearbeit (das
Schweißen kam erst in den Dreißigerjahren auf), Pedale verstellbar,
gefederter Sitz, Seilzugbremse auf Rückrad wirkend durch Verdrehen es
Lenkers, bei der Lenkstange Gabel zur Gepäckaufnahme

WAFFELEISEN
Die Erzeugung von Oblaten geht auf die Jahre um 1500 zurück. Diese wurden meist in Ybbsitz hergestellt.
Runde finden sich häufer als Viereckige. Hier finden Sie eines davon
mit Rautenmuster ausgestellt. Dieses Waffeleisen bietet schon seines
Ornamentes wegen eine Besonderheit, da sich sonst meist in der
Innenfläche figürliche Darstellungen, wie z. B. Themen aus den
Osterfestkreis, Adam und Eva usw. finden lassen.
Was ist der Unterschied zwischen Oblate und Hostie?
Die Oblate ist ein Gebäck uralter Tradition - ("Oblatum" übersetzt
"darbieten, opfern") sie wird mit Sauerteig, Hefe, Backpulver etc.,-
hergestellt. Oblaten finden beim christlichen Abendmahl in der Kirche
Verwendung und werden hierbei als "Hostien" (lat. "Hostia" übersetzt
"Opfertier") bezeichnet. Hostien werden hingegen nur aus Mehl und
Wasser hergestellt. Dieser Teig wird möglichst ohne Luftblasen auf die
Waffeleisen verteilt und kommt in den Feuchtofen. Meist werden sie in
Klosterbäckereien oder Hostienbäckereie gefertigt. Zur Hostie wird
solche Oblate aber erst durch das Konsekrieren, (lat. Consecrare), die
Weihe durch den Pfarrer.

Reisepass, ausgestellt im Namen des Kaisers

Als es den Bravo-Starschnitt noch nicht gab: Devotionalien für Fanboys (und Fangirls).

Sowjet-Russisches Selbstladegewehr (System Tokarev Modell 1940) als Scharfschützengewehr
Sowjet-Russisches Selbstladegewehr (System Tokarev Modell 1938) als Scharfschützengewehr

Uniformen- und Waffensaal
Sie finden hier eine Vielzahl von Uniformen, die deren Entwicklung bis
in die Gegenwart ausgezeichnet dokumentieren. Vom „bunten kaiserlichen
Rock“ der aus 12 Nationen zusammengesetzten österreichisch-ungarischen
Armee, über deren Verwandlung in einheitlichen Erdfarben während des
Ersten Weltkriegs, solchen aus dem Zweiten Weltkrieg, bis hin zu
aktuellen Offiziersuniformen des österreichischen Bundesheeres. Der
Garnisonsstadt Baden wird mit Erinnerungen an die Martinekkaserne, die
von 1941 bis 2013 militärisch genutzt wurde, gedacht. Pistolen,
Revolver und Waffen aus beiden Weltkriegen, sowie Sport- und kunstvolle
Jagdgewehre aus mehreren Jahrhunderten und die dazugehörigen
Schießscheiben runden die Atmosphäre des diesem Sammelgebiet gewidmeten
Saales, ab.

Wir Franz Joseph der Erste
VON GOTTES GNADEN KAISER VON OESTERREICH,
Apostolischer König von Ungarn, König von Böhmen, von Dalmatien.
Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von
Oesterreich, Grossherzog von Krakau, Herzog von Lothringen, Salzburg,
Steyer, Kärnthen, Krain, Bukowina, Ober-und Nieder-Schlesien,
Grossfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, gefürsteter Graf von
Habsburg und Tirol, etc.
entbieten allen und jeden Unseren Oberstleutnanten, Majoren,
Haupleuten, Rittmeistern, Leutnanten, Unteroffizieren und insgemein
allen Kriegsleuten zu Fuß und zu Pferd, wessen Nation, Würde, Standes
oder Wesens die sind, so sich in unseren Kriegsdiensten befinden,
Unsere kaiserliche und königliche Gnade, alles Gute und geben Euch
hiermit gnädigst zu vernehmen, daß Wir
Unsern Oberstleutnant des Infanterieregiments Ritter von Auffenberg No. 64, Besitzer des Militärverdienstkreuzes,
lieben getreuen
Wladimir Verhovac
in huldreichster Erwägung der von Demselben Aus und Unserem
Durchlauchtigsten Kaiserhause bisher geleisteten und noch ferner zu
erwartenden guten Dienste, sowie zum Beweise Unseres höchsten
Vertrauens zu seinen Einsichten und seiner Diensterfahrung, zu Unserem
wirklichen kaiserlichen und königlichen
OBERSTEN zu Fuß mit dem Range vom neunzehnten Dezember 1910
gnädigst ernannt, bestellt und erhoben haben. Befehlen daher allen und
jeden Obbenannten gnädigst und ernstlich, daß Ihr dasjenige,
was in Unserem Namen ermeldeler Oberst Wladimir Verhovac mit Euch
sämtlich oder Jedem insbesondere dieses bekleidenden Charakters wegen
anordnen und gebieten wird, jederzeit ohne einige Weigerung gehorsam
und richtig vollziehen und Euch also gegen denselben erzeigen sollet,
wie es Euch gemäß aufhabender Plicht zu verhalten geziemet, hieran
vollziehet Ihr Unseren gnädigsten Befehl, Willen und Meinung. Gegeben
in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien, am fünf und zwanzigsten Tage
des Monates Oktober, im neunzehnhundert und zehnten - Unserer Reiche im
zwei und sechzigsten Jahre.
Der k. und k. Reichskriegsminister.
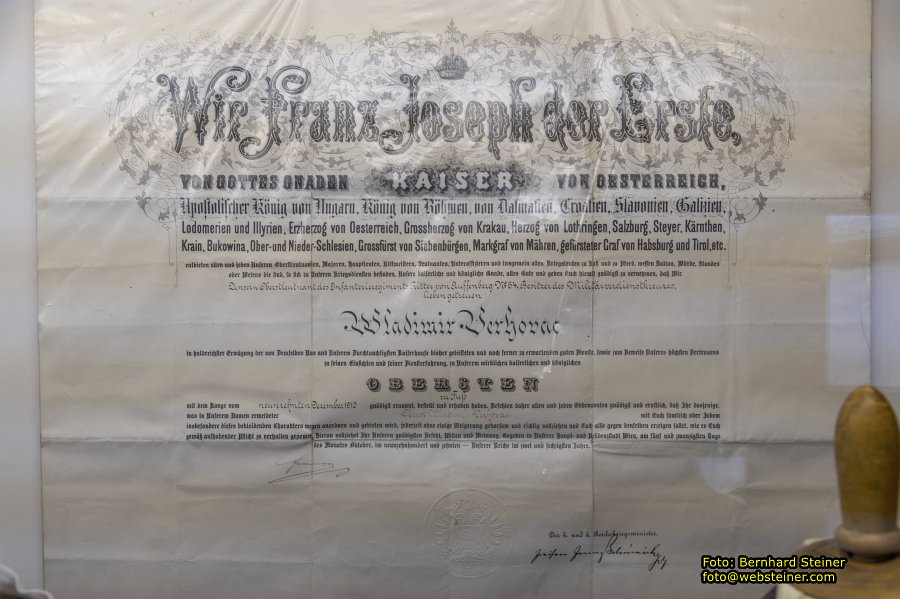
Adjustierungswandtafeln der österr.-ung. Armee.
Gezeichnet von Oberleutnant Camillo Righetti des k. u. k. Infanterieregiments No. 27.
Feldmarschalleutnant, Parade.
Major des Generalstabskorps, Parade.
Hauptmann des Geniestabes
Oberleutnant des Eisenbahn- und Telegrafenregimentes, zugeteilt dem Generalstabe, feldmässig.
Pionier.

Spielzeugkanone des Erzherzog Albrecht

WALLBÜCHSE
Meist Vorderlader, verwendet im Festungskrieg mit großem Kaliber und
entsprechend hoher Durchschlagsleistung; aufgrund des hohen Gewichts
wurde es auf der Brustwehr (oder Wall) aufgelegt.

Teuer, unbequem und weit gereist...
Im Neoabsolutismus des jungen Kaiser Franz Josefs wurden Staatsbeamte
ab einem gewissen Dienstrang dazu verpflichtet nicht nur eine
Beamtenuniform zu tragen, sondern genauso einen Beamtensäbel. Das
Militärische griff damit massiv in den zivilen Bereich ein. Was als
Zeichen der Autorität und Hierarchie angesehen wurde, fand jedoch nicht
bei allen Beamten erfreulichen Widerhall. Einerseits mussten die
Uniformen und Säbel aus eigener Kasse bezahlt werden - was sich vor
allem niedere Beamte nicht leisten konnten - und anderseits erwiesen
sich die Uniformen oftmals als unpraktisch und die Säbel als störend.
Die Waffentechnik schritt rasend schnell voran, erkennbar an den
Bezeichnungen wie „Kavallerieoffizierssäbel M1858" was bedeutete, dass
dieses Model 1858 eingeführt wurde. Nur drei Jahre später wurde es
bereits durch das Modell M1861 ersetzt. Und dabei stellte sich jedes
Mal die Frage, was macht man mit dem Vorgängermodell, dem „alten
Eisen"? In diesem Fall hatte man Glück, als gerade zur jener Zeit ein
Oberst der Konföderierten aus den USA durch Europa tourte, auf der
Suche nach passenden Blankwaffen. So kamen die ausrangierten
Österreichischen Kavalleriesäbel im amerikanischen Bürgerkrieg
(1861-1865) noch zum Einsatz, um später wieder zurück gekauft, um im
KFJ-Museum ausgestellt zu werden.

1. Hofdegen eines hohen Militärs unter Kaiser Franz I. (ca. 1810-1830), gebläut und vergoldete Dreikantigeklinge
2. Degen für Staatsbeamte der österreichischen Länder M(uster)1849
3. Österreichischer Bahnbeamtendegen
4. Infanterieoffizierssäbel M1849; Seltenes Muster (da nur ein Jahr produziert) versehen mit einem ausklappbaren Bügel
5. Kavallerieoffizierssäbel M1869; Normiert bis 1907

Französische MP - MAS
Österreichische MP M-34 (Steyr-Solothurn)
Ungarische MP M-43
Italienische MP BERETTA

Waffen- u. Uniformensaal
Die hier ausgestellten Waffen und Uniformen waren nicht Teil der
ursprünglichen Sammlungen des KFJ-Museum. Der Raum war für die
Prähistorie und die Antike vorgesehen und war dem Ehepaar Karoline u.
Fridolin Keller gewidmet. Er war Besitzer einer Geschosszünder- und
Metallwarenfabrik in Hirtenberg und Villenbesitzer in Baden. Sie trat
als Wohltäterin auf. Die Waffensammlung geht auf Julius Schopf zurück,
dem Verwalter des ehemaligen Schloss Weilburg. Nach dem Tod seines
Sohne Wolfgang Schopf, der an Kinderlähmung verstarb, spendete der
Vater 1938 seine Waffen- und Uniformsammlung dem KFJ-Museum. Bei ihrer
Ausstellung umfasste die Sammlung das gesamte obere Stockwerk. Nach den
Plünderungen 1945 umfasste der Bestand nur mehr ca. ein Zehntel.
Die heutige Aufstellung begann in den 60er Jahren unter dem damals noch
jugendlichen und noch-nicht-Vereinsmitglied Dr. Ingo Wieser, der später
zum Bereichsleiter der Waffen- und Munitionstechnik des
österreichischen Bundesheeres und zum Gerichtssachverständigen
avancierte. Schwerpunkte sind die Entwicklung der Schießpulverwaffen
von den Arkebusen des 15. Jahrhunderts bis zu den Gasdrucklader des 20.
Jahrhunderts, vereinzelte Blankwaffen, die Wandlung österreichsicher
Uniformen im Laufe der letzten 200 Jahre sowie die Geschichte der
Martinek-Kaserne.

Kavallerie Pistoie M-1798, Batterie Schloss
Kavallerie Pistole M-1842 (Zündschloss System Augustin)
Kavallerie Pistole M-1859 (Perkussionsschloss, Laufkonstruktion nach System Lorenz)
Kavallerie Pistole M-1851 (perkussionierte M-1798)

Lefaucheux-Revolver
Revolver 38 cal. Enfield No.: 2 Mark I Royal Small Arms Factory-Enfield England

Eisensaal (Zeno Gögl-Saal)
Hier begrüßt Sie rechter Hand eines der ältestes Stücke des Museums,
die Honigpresse. Zwar sieht sie auf den ersten Blick wie eine
Mostpresse aus, war jedoch stets Ausgangspunkt für die handwerkliche
Arbeit der Lebzelter.
Honigpresse
Honiggewinnung mittels Druckkraft: Honigwaben werden zusammengedrückt,
der Honig fließt durch den Kanal hinaus. Dieses Verfahren wurde bis
Mitte des 19. Jahrhunderts angewandt und anschließend durch die
Honigschleudern (siehe Objekt links) ersetzt. Vorteil: Die Waben
bleiben ganz, die Bienen mussten jene nicht erneut herstellen um damit
Energie verschwenden.
Letzter Standort war Wiesen im Burgenland, Schenkung Ende der 1970er oder Anfang der 1980er.

Ein aus heutiger Sicht pittoresk anmutendes Werkzeug ist die
Lichtputzschere respektive Dochtschere, die im Badener
Kaiser-Franz-Josef-Museum in unterschiedlichen Formen zu besichtigen
ist. In Österreich wurde sie vielerorts auch als „Kerzenschneuzer"
(mundartlich „Kiaznschneiza") bezeichnet. Jahrhundertelang hatte man
die gewöhnlichen Kerzen aus Talg (Unschlitt) hergestellt. Der Talg
wurde aus dem Körperfett von Wiederkäuern gewonnen. Im Unterschied zu
Bienenwachskerzen, die zu den Luxusgütern zählten, musste bei den
Unschlittkerzen der Docht immer wieder „geputzt" werden, weil diese
umso mehr zu rußen und zu tropfen begannen, je länger der Docht wurde.
Mit der Lichtputzschere wurde die Kerze regelmäßig „geschneuzt", wobei
der Docht in der am Oberteil der Schere befindlichen Kammer aufgefangen
wurde.
„Krankheit des Lichts"
Das Auffangen des Dochtes in dieser Kammer war vonnöten, weil ein
Hinunterfallen desselbigen die Kerze womöglich zum Erlöschen gebracht
hätte. Auch die Beschaffenheit des Dochtes selbst erforderte ein
ständiges Lichtputzen. Eine spezielle „Krankheit des Lichts" war vor
allem der „Rauber". Dabei handelte es sich um einen ausgefransten
brennenden Nebenstamm des Dochts, der ein starkes Hinunterlaufen des
Talges zur Folge hatte. Bildete sich an der Spitze des Dochtes eine
Verkrustung, so hieß es seinerzeit: „Das Licht brennt Rosen" (nach
altem Aberglauben verhieß dies Geldsegen oder sonstiges Glück).
Jedenfalls mussten auch solche „Rosen" mit der Lichtputzschere
abgezwackt werden, wollte man sich eines hellen Kerzenscheins erfreuen.
Waldviertler Tabernakelschwalben
In Adelshäusern und Theatern, wo viele Kerzen brannten, gab es früher
spezialisierte Bedienstete für das Lichtputzen. Frauen, die sich gerne
im Umkreis des Pfarrers aufhielten (und dort wohl auch das Lichtputzen
besorgten), wurden in manchen Gegenden Österreichs zweideutig als
„Lichtputze" verunglimpft (im Waldviertel gibt es für diese übrigens
heute noch die Bezeichnung „Tabernakelschwalben", und im Burgenland
spricht man in diesem Zusammenhang von „Sakristeiwanzen").
Das Erfordernis des permanenten Lichtputzens ging früher manch einem
gehörig auf die Nerven, besonders dann, wenn er abends noch schreiben
wollte. Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) schrieb 1779 an
Charlotte von Stein: „Wüßte nicht, was sie Besseres erfinden könnten,
als wenn die Lichter ohne Putzen brennten." Goethes Wunsch sollte noch
zu dessen Lebzeiten in Erfüllung gehen. Ab 1818 bekam man das Problem
infolge der Entdeckung von Stearin und Paraffin als Kerzenrohstoffe in
den Griff.

Kerzenherstellung
Die Hauptverbraucher von Wachskerzen waren seit dem frühen Mittelalter
die Kirchen und Klöster. Die Kerzen dürften zunächst von den Klöstern
selbst gefertigt worden sein, denn das Kerzenmachergewerbe scheint sich
erst im 11. Jahrhundert langsam und vereinzelt herausgebildet zu haben.
Die Wachskerze begleitete die Menschen von der Geburt bis zum Tode. Sie
enthält einen hohen Anteil an Bienenwachs, das aus Blütennektar und
Blütenstaub besteht. Zur Gewinnung des Bienenwachses musste das
Wabenrohwachs mehrfach umgeschmolzen, durch Seihen von Verunreinigungen
befreit und über kochendem Wasser raffinieriert werden. Man erhielt
gelbliches Wachs.
Kerzentauchen
Beim Tauchen werden an einem Hakenkranz befestigte Dochte in das
erhitzte Wachsbad mehrfach eingesenkt, wobei sich Wachsschicht auf
Wachsschicht legt. Beim Angießen werden die am Hakenkranz hängenden
Dochte mit flüssigem Wachs übergossen. Gegossen wird mit einer
Schöffelkelle unter ständigem Drehen der Kerze. Unter der Gießstelle
befindet sich der Kessel mit dem flüssigen Wachs. Nach dem Angießen
werden die Kerzen gerollt, geschnitten und geköpfelt. Das Verfahren
dient zur Herstellung der Rohlinge. Zur Herstellung der fertigen Kerze
bedarf es in der Regel noch eine Reihe weiterer Bearbeitungsvorgänge.
Überwiegend werden hier jedoch außergewöhnliche Eisenwaren
gezeigt. Geschmiedete Grabkreuze, Hostieneisen, kunstvolle Schlösser
und Schlüssel, Hufeisen sowie eine originalgetreu nachgebaute Schmiede
ehemals im noch heute existenten Schlossergässchen in Baden gelegen.
Darüber hinaus sind gegen Saalende Beleuchtungskörper der
unterschiedlichsten Arten und Zeiten ausgestellt. Besondere Objekte
sind einerseits die überaus kunstvoll geschmiedeten Zunftzeichen, wie
z. B. ein überdimensionaler Schlüssel, aber ebenso das
Parade-Kummetgeschirr des serbischen Königs PeterI.

Neueste VÖLKER- TELEGRAFEN- UND EISENBAHN-KARTE des Kaiserthumes ÖSTERREICH,
mit der neuen politischen Eintheilung, und Angabe der Handels- und Gewerbs-Kammern.
VOM GEOGRAFEN RAFFELSPERGER.
Typographisch ausgeführt in der ersten k. k. n. p. Kunst-Anstalt WIEN. Rossau Nr. 129.
Dreizehnte Auflage. 1831.
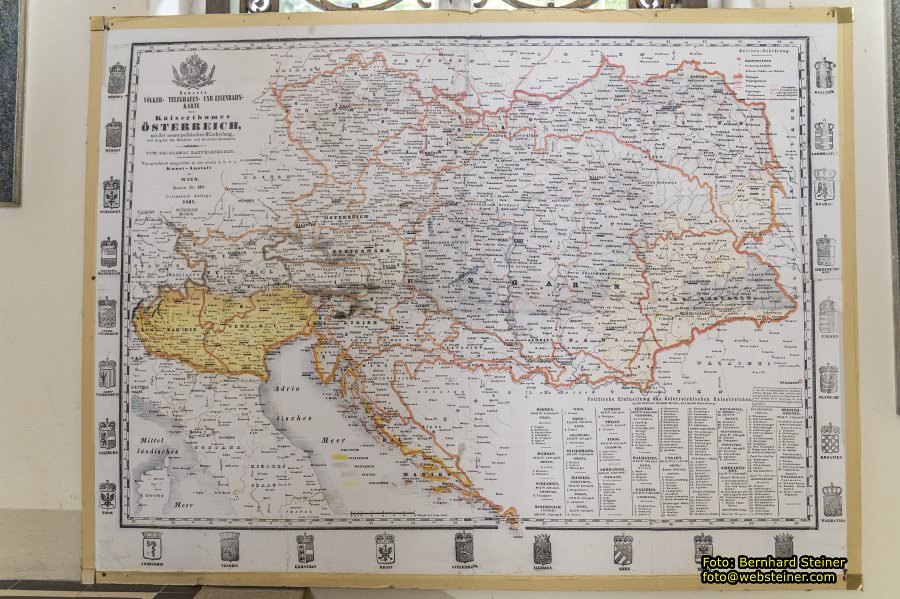
Vom Trinken
Als per Erlass am 17. August 1784 durch Kaiser Josef II. der
öffentliche Weinausschank nicht nur an Weinaufkäufer, sondern nun auch
an „sitzende Gäste" erfolgen durfte, war der Heurige als äußerst
beliebte Einkehrstätte geboren. Für die Ausrichtung der Badener
Gewerbeausstellung wurden zahlreiche Hilfskräfte aus der Hauerschaft
rekrutiert, die mit Handkarren und Pferdefuhrwerken diverse Schaustücke
ihrer Zunft, aber auch solche der Binder zu den Zelten und
Restaurationen am Festgelände brachten. Als Dank erhielten sie
Anerkennungsmedaillen verliehen. Das wichtigste präsentierte Erzeugnis
aber war der Wein. Gezeigt und getrunken wurden nur Weiß- und Rotweine.
Als spezielle Marken kamen „Roter Zierfahnler", „Blauer Portugiser" und
weißer „Muskat" zur Verkostung. Doch auch einen weißen „Alten" bot
mancher Hauer an.

Vom Naschen
Bereits im Mittelalter verfeinerten einige Brotbäcker ihre Teige mit
Honig, diversen Trockenfrüchten und exotischen Gewürzen. Die
Spezialisten unter ihnen nannten sich Lebküchler oder Lebzelter. Mit
dem bei der Honiggewinnung nebenbei anfallenden Wachs betrieben sie ein
weiteres Gewerbe: die Wachszieherei. Nun kamen auch Kerzen,
Wachsfiguren und -bilder zum Verkauf.

Die Zuckerbäcker gingen ursprünglich aus den Apothekern hervor, weil
nur dort der begehrte Zucker aus dem Orient erhältlich war.
Kaffeegebäck, Desserts, Torten, Teegebäck, Schokoladeguss, Bonbons,
Marzipan, Speiseeis und Zuckerdekor zählten zu den kunstvoll
gestalteten Köstlichkeiten. Allmählich wurden auch saisonabhängige
Gebäckstücke angeboten: Faschingskrapfen, Biskuitlämmer zu Ostern,
Allerheiligenstriezel. In Baden war es vor allem das „Badener Kipferl"
mit vielen Rosinen und das in rosa Papier eingewickelte „Badener
Zuckerl", das die Herzen so mancher Liebhaber von Süßem höher schlagen
ließ.

Vom Ablichten
Das Wort „Photographie" leitet sich aus dem griechischen ab und
bedeutet so viel wie „Schreiben mit Licht". Die Entwicklungsgeschichte
der Fotografie begann mit der Daguerrotypie, bei der eine versilberte
Kupferplatte mit Joddämpfen lichtempfindlich gemacht wurde. Erst 1888
wurden Zelluloidfilme mit einer Gelatineschicht für Plattenkameras
hergestellt. Diese Filme fanden bis zur digitalen Umwälzung der
Fotografie gegen Ende des 20. Jahrhunderts ihre Verwendung.
Mit den Plattenkameras machten die professionellen Fotografen
größtenteils Architektur- und Landschaftsaufnahmen oder gebrauchten sie
in der Reproduktions- und Porträtfotografie. Die ersten Handapparate
waren nicht nur handlicher als die zuvor eingesetzten Klapp-, Falt- und
Balgenkameras, sondern auch um vieles preiswerter. Nun nahmen sich auch
Amateure und „Knipser" der Fotografie an. Auf der Gewerbeausstellung
1912 in Baden hat der bekannte „k. k. Kammerphotograph" Anton Schiestl
eine Vielzahl von Badener Ansichten und Porträts präsentiert.
Holzkamera 13 x 18 mit 2 Doppelkasetten und Original Stativ, Anfang 19. Jhdt.
1. Objektiv: Universal Aplanat Extra Papid, Felix Neumann, Wien 1. Bezirk
2. Objektiv: Universal Aplanat Extra Papid, Paris (lange Brennweite - ca. 120 mm)

Mechanikerdrehbank um 1900, Fabrikat Richter
Diese Drehbanktype war vorerst mittels Wippe ähnlich der
Nähmaschinenantriebe betrieben. In der späteren Folge wurden E-Motoren
eingesetzt. Diese Maschinen standen unter anderen bis in die 70er Jahre
des vorigen Jahrhunderts in der Berufsschule Mollardgasse, 1060 Wien
zur Mechanikerschulung in Verwendung. Die Maschine besitzt im Gegensatz
zu den herkömmlichen Drehmaschinen keine Leit- und Zugspindel, das
Gewindeschneiden (nur kurze Gewinde bis ca. 20 mm) erfolgt mit
Gewindepatronen. Die voll funktionstlichtige Maschine wird im Zuge von
Führungen vorgestellt.

Tage des Herrn
„Du sollst den Tag des Herrn heiligen!" Dieses dritte der zehn Gebote
nahm jeder ernst und beging die Sonntage des Jahreskreises mit
gewohntem Kirchgang und Messbesuch. Doch gab es auch andere Zeiten und
Orte, zu und an denen man seinem Glauben Ausdruck verlieh. So wurden
Prozessionen und Wallfahrten veranstaltet, um auf diese Weise der Gnade
des Herrn näher zu sein. Doch auch zu Hause verlieh man seiner
Frömmigkeit Ausdruck: mit Andenkenbildchen, Gebetbüchern sowie Statuen
von Heiligen und mit einer Vielzahl von verschiedenen Schutz- und
Segensmittel.

Von den „Schönen Arbeiten"
Schöne Arbeiten nannte man im 17. und 18. Jahrhundert diese oft in
Frauenklöstern angefertigten Ausschmückungen von Reliquien,
Gnadenbildkopien in Miniaturformen und von gemalten oder gedruckten
Heiligenbildchen. Sie sind oft kunstvoll mit Ornamenten aus vergoldetem
oder versilbertem Draht, dem sogenannten Bouillondraht, mit fabigen
Glassteinen und aus Metallfolien geprägten Blüten verziert. Ab 1800
wurden die Arbeiten auch außerhalb der Klöster gefertigt.
Als beliebte Zeugnisse privater Religionsausübung und Andacht hatten
Klosterarbeiten häufig ihren Platz im Herrgottswinkel. Sie waren auch
Ausweis eines gewissen Wohlstandes, Hinweis auf die fromme Grundhaltung
ihrer Besitzer oder Andenken an ein bedeutendes Ereignis wie etwa die
Hochzeit. Erworben wurden die schönen Arbeiten häufig auf Wallfahrten
als Andenken oder als „wertvolles" Mitbringsel.

Ausblick in den Süden auf Baden

SAKRAL-SAAL
Den um 1900 in Baden maßgeblichen Religionen - katholisch, evangelisch
und mosaisch - ist dieser Saal ebenso gewidmet, wie Objekten, die die
Ausdrucksformen von Religiosität und Glauben der Bevölkerung auch aus
den Epochen davor widerspiegeln. Stimmungsvoll werden sakrale
Volkskunst, aber auch wahre Kostbarkeiten, wie Klosterarbeiten, eine
Vielzahl von Andachtsgegenständen bis hin zu einem ehemaligen Altar,
gezeigt. Hinter dem Altar haben Sie die Möglichkeit, eine der schönsten
Aussichten auf die alte Kurstadt Baden zu genießen.

Eine Besonderheit in diesem Raum ist der an der Stirnseite errichtete
Altar, dessen Altarbild von Johann Baptist Lampi d. J. (1798-1837)
stammt, einem Porträt- und Historienmaler und Hausbesitzer in Baden.
Ursprünglich hing dieses Bild im Armenhaus von Baden, später in der
Möllersdorfer Pfarrkirche. Wann und wie Altar und Bild ins Museum kamen
ist nicht gesichert.
Neugotischer Altar mit Tabernakel
Altarbild: Gottesmutter mit Kind,
gezeichnet und datiert, Johann Ritter von Lampi, 1831

Der Kaisersaal
Eine Reihe von Monarchen, Erzherzögen, Fürsten und Grafen mitsamt ihren
weit verzweigten und kinderreichen Familien prägten in besonderer Weise
seit dem frühen 19. Jahrhundert das Antlitz der damals noch ländlichen
Stadt Baden. Sie alle hinterließen hier größere und kleinere Spuren:
sei es, indem sie mehrstöckige Stadthäuser errichteten, sei es, dass
sie ansehnliche Landsitze in der nahen Umgebung zu ihrem Eigen machten
und über Jahrzehnte bewohnten.
Die zahlreichen heilkräftigen Sprudel und Quellen, das laue, oft
südlich anmutende warme Klima, die abwechslungsreiche und
landschaftliche Schönheit zogen sowohl den Wiener Hof und andere
Adelige als auch so manche Großbürgerliche in ihren Bann. Für einige
wurde Baden zur besonders beliebten Sommerfrische oder gehobener: zur
einzigartigen „Sommerresidenz" sogar. Vieles in Baden erinnert heute
noch an diese glanzvollen Zeiten: das „Kaiserhaus", der „Kurpark", die
„Rainervilla"...

Der Weltkurort - „Warme Quellen und kalte Duschen"
Die Stadt Baden schmiegt sich am Ausgang des Helenentales in einer
flachen Mulde an die grünen Hänge der Thermenalpen. Die warmen Quellen
ziehen viele Heilungsbedürftige an - Das ist heute so und war in der
Vergangenheit nicht anders. Baden wurde durch die oftmaligen Besuche
und Kuraufenthalte von Kaiser Franz I. zu seiner häufig aufgesuchten
„Sommerresidenz". Mit ihm kam der Hof, das reiche Bürgertum und die
Kunstwelt. Kaiserliche Anverwandte verbrachten hier meist ihre Sommer,
und zahlreiche Besuche hoher Gäste in Baden waren die Folge. Daraus
entwickelte sich das unverwechselbare Flair der Kurstadt.
Die alten Häuser, die schmucken Villen, die Salettln und Brunnen, ja
selbst die neu errichteten Häuser versinken fast im Grün dieser
weitläufigen und abwechslungsreichen Gartenstadt. Baden empfängt alle
in seiner spezifisch gastlichen Weise: Durch seine bevorzugte Lage
gedeiht hier ein köstlicher Wein. Für die Kurgäste jedoch ist das
Wasser der heilenden Quellen die größte Anziehungskraft in der alten
Thermenstadt. Das wusste schon das Haus Habsburg-Lothringen im 19.
Jahrhundert, weshalb hier der Repräsentanten des Kaiserhauses gedacht
ist.

Die hier gezeigten Bilder sind Leihgaben der „Österreichischen
Blindenwohlfahrt" und stellen jene Mitglieder der Familie Habsburg dar,
welche im 19. Jh. die Protektoren dieser Institution gewesen sind. Alle
hier Dargestellten haben darüber hinaus einen starken Bezug zu Baden,
entweder weil sie hier einen Sommerwohnsitz hatten oder weil sie
oftmals hier bei ihren kaiserlichen Verwandten zu Besuch weilten.

KAISER-JUBILÄUMS-SAAL
Dieser Saal wurde zum 60-jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz
Josefs errichtet und ist Namensgeber des Museums. Der gewaltige
Doppeladler am Plafond betont die thematische Ausrichtung. Zu finden
sind hier Mitglieder der Familie Habsburg, die auf Baden großen
Einfluss genommen haben. Außerdem wird die Rolle der Kurstadt als
touristisches Zentrum der vorigen Jahrhundertwende und der prägende
Faktor Architektur beleuchtet, wie z. B. der einstige Prachtbau, die
Weilburg.
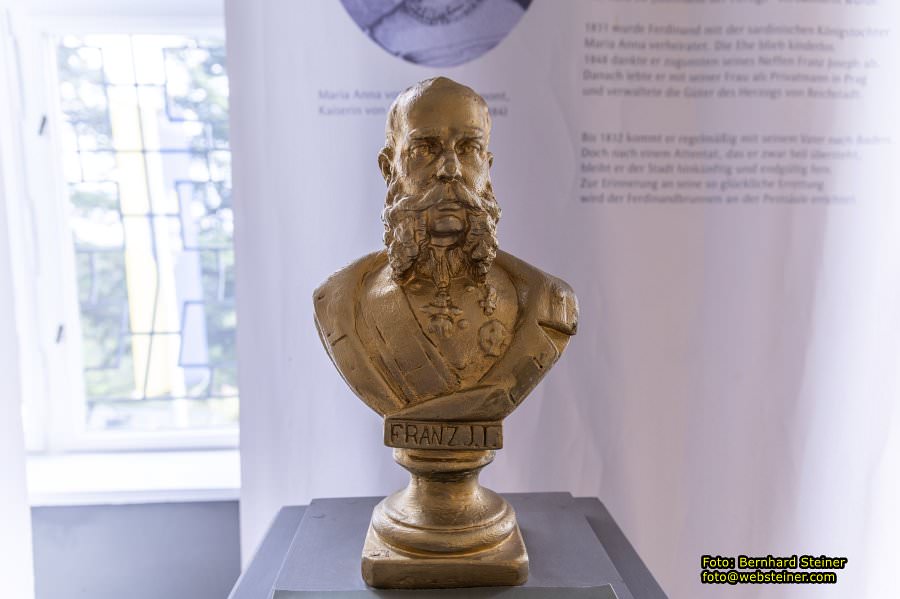
Kronprinz Rudolf (1858-1889)
Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn von Kaiserin Elisabeth und Kaiser
Franz Josef, war ein hochbegabter und kluger junger Mann, der dank
seiner Erziehung durch liberale, bürgerliche Lehrer höchster Kompetenz
ein Weltbild errang, das im Gegensatz zu der traditionellen und
konservativen Haltung der politisch führenden Schichten des Staates
stand.
Wie sein Vater sah auch er in einer glücklichen Zukunft und einem
möglichst langen Erhalt der Monarchie sein Ziel. Aber der Weg dafür
wurde von beiden unterschiedlich gesehen. Seine Beachtung
national-ökonomischer und sozialer Komponenten, auf die er von seinen
Lehrern verwiesen worden war, blieben für Franz Josef zweitrangig.
Unterschiedliche Prinzipien, mangelnder Dialog in der Bewertung der
österreichischen Bündnispolitik mit Deutschland, und die Beschränkung
Rudolfs auf seine militärischen Aufgaben führten zu seiner Frustration.
Ein unglückliches Eheleben mit der belgischen Prinzessin Stephanie und
eine venerische Erkrankung belasteten ihn zusätzlich und führten
allmählich zum Lebensüberdruss. Am 30. Jänner 1889 erschoss er im
gegenseitigen Einverständnis seine junge Geliebte und sich selbst in
Mayerling (heute Kloster der Karmeliterinnen).

Kaiser Karl I (17.8.1887 - 1.4.1922)
Nach der Ermordung Franz Ferdinands in Sarajewo 1914 wurde sein Neffe
Karl zum natürlichen Thronfolger bestimmt. Der Tod des so lange
herrschenden Kaiser Franz Josephs 1916 machte Karl schließlich zum
Kaiser über die Donaumonarchie. Glück war seiner Regentschaft jedoch
nicht beschieden: Seine Friedensbemühungen um ein Ende des Ersten
Weltkriegs endeten für Österreich mit einem unbefriedigenden Ergebnis.
Am 11.11.1918 musste Karl dann seinen Rücktritt erklären, und die
Familie hatte Hals über Kopf Österreich zu verlassen. Für die
Anfangsjahre fand sie in der Schweiz Aufnahme. Nach einem
fehlgeschlagenen Restaurationsversuch jedoch wurde Karl 1921 auf die
portugiesische Insel Madeira verbannt. Mit 35 Jahren, insgesamt
geschwächt und an Grippe erkrankt, verstarb Karl als letzter
Österreichischer Kaiser in Funchal. Dort wurde er schließlich
beigesetzt und zur letzten Ruhe gebettet.
Auch Kaiser Karl I. lebt mit Familie und Gefolge in Baden und „erhebt"
die Stadt nach 100 Jahren wieder zur Kaiserstadt. Auch er steigt wieder
im „Kaiserhaus" am Hauptplatz ab, verwendet für offizielle Empfänge
jedoch das „Haus der Kunst". Mit ihm erhält Baden erstmals auch eine
militärische Bedeutung, verlegt doch Kaiser Karl gleich nach seinem
Regierungsantritt das k. u. k. Armeeoberkommando von Teschen nach Baden
-es war in der Schule am Badener Pfarrplatz untergebracht. Karls
Ehefrau, Zita von Bourbon-Parma, die er 1911 geheiratet hatte, lässt
eine Geburten- und Säuglingsstation in Baden errichten, ebenso wie das
„Zitaheim" des „Vereins für erweiterte Frauenbildung" am Kaiser Franz
Ring 50, das dann bis 1939 besteht.
* * *
Erzherzog Karl Franz Joseph (1887 - 1922; Kaiser und König von Österreich-Ungarn 1916 - 1918)
Karl war der ältere Sohn von EH Otto und erhielt eine militärische
Ausbildung. Ottos Bruder, EH Franz Ferdinand, wurde nach dem Tod von
Kronprinz Rudolf zum Thronfolger (1896). Nach seiner Ermordung in
Sarajewo 1914 ging die Thronfolge auf seinen Neffen Erzherzog Karl
über. Nach dem Tod von Kaiser Franz Joseph übernahm Karl am 21.
November 1916 die Regierungsgeschäfte, ohne eine ausreichende
Vorbereitung dafür erhalten zu haben. 1911 hatte er die Prinzessin Zita
von Bourbon-Parma geheiratet, die ihn in seinen Entscheidungen vielfach
beraten hat. Der glücklichen Ehe entstammten acht Kinder. Für Baden
bedeutsam war Karls Entscheidung, während des Ersten Weltkriegs das
Armeeoberkommando Ende 1916 von Teschen (tschechisch-polnische
Grenzstadt in Schlesien) nach Baden zu verlegen. Karl erkannte bald die
Aussichtslosigkeit der Kriegsführung und unternahm Friedensbemühungen.
Diese wären nur durch eine Lösung vom Bündnis mit Deutschland
erfolgreich gewesen, was sich als unmöglich erwies. Die Not und die
Entbehrungen der Kriegsjahre sowie nationalistische
Separationsbewegungen führten schließlich zum Untergang der Armee am 3.
November 1918 und damit der Monarchie. Karl dankte am 11. November
allerdings nicht formell ab, sondern verzichtete auf eine Beteiligung
an den Regierungsgeschäften. Da er die neu geschaffene Republik nicht
anerkannt hat, wurde er per Gesetz des Landes verwiesen. Er fand Exil
in der Schweiz. Nach zwei gescheiterten Restaurationsversuchen in
Ungarn 1921 verlor er auch das Schweizer Exilrecht und wurde von den
Siegermächten (Entente) auf die portugiesische Insel Madeira verbannt,
wo er am 1. April 1922 an einer Lungenentzündung starb.

Erzherzog Otto Franz Joseph (1865-1906)
Erzherzog Otto war der zweitgeborene Sohn von Erzherzog Carl Ludwig,
der ihn überaus liebte. Er war Offizier, künstlerisch begabt,
sympathisch, lebenslustig und unprätentiös, dadurch sehr beliebt, auch
in der Frauenwelt. Mit seinem Cousin Kronprinz Rudolf verband ihn eine
enge Freundschaft. Zahlreiche frivole Abenteuer beeinträchtigten
allerdings sein Ansehen. Seine Ehe mit Maria Josepha Louise von Sachsen
war durch Ottos zügelloses Verhalten unglücklich; ihr entstammten zwei
Söhne: Karl Franz Joseph, der spätere letzte Kaiser von
Österreich-Ungarn, und Maximilian Eugen. 1900 erkrankte er an Syphilis,
an der er elend zugrunde ging.

Erzherzog Karl Ludwig (1833-1896)
Erzherzog Karl Ludwig war der zweitjüngste Bruder von Kaiser Franz
Josef. Ohne politische Funktion war er an Kunst und Theater sehr
interessiert und wurde Protektor zahlreicher Künstlervereinigungen
(u.a. Künstlerhaus Wien, Akademie der Wissenschaften) und trat
wiederholt bei Ausstellungseröffnungen in Erscheinung. Streng
katholisch und konservativ, unterstützte er viele karitative
Einrichtungen (Gesellschaft vom Roten Kreuz, Blindenwohlfahrt). Er war
ein ausgesprochener Familienmensch, der seinen Eltern, seinen
Geschwistern und Verwandten (auch Kronprinz Rudolf) eng verbunden war.
Als seinen Sommersitz erbaute er die Villa Wartholz in Reichenau. Seine
drei Söhne waren der spätere Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand
(1914 in Sarajewo ermordet), Erzherzog Otto und Erzherzog Ferdinand
Karl (wegen seiner unstandesgemäßen Heirat aus dem Kaiserhaus
geschieden mit dem Namen Ferdinand Bung). Bei einer Pilgerfahrt nach
Palästina trank er Wasser aus dem Jordan und erkrankte daran tödlich.

Erzherzog Rudolph
Er war der jüngste Bruder (1788-1831) von Kaiser Franz I. Wegen seiner
schwächlichen Gesundheit zum geistlichen Stand bestimmt, wurde er 1819
zum Erzbischof von Olmütz (Mähren) gewählt und erwies sich als ein der
Aufklärung verbundener Seelsorger. Künstlerisch vielfältig begabt, ist
er vor allem als Schüler und Mäzen Beethovens bekannt, dem er
lebenslang eine Rente - und damit seinen Aufenthalt in Wien - gesichert
hat. Er komponierte selbst Klavier- und Kammermusik, musizierte
gemeinsam mit Beethoven, der ihm zahlreiche Werke (u.a. „Missa
solemnis") gewidmet hat. Seine wertvolle Musiksammlung (darunter viele
Autographen Beethovens) gelangte an die Gesellschaft der Musikfreunde,
deren Protektor er war. Er verbrachte viele Sommer in Baden und starb
hier an den Folgen eines Schlaganfalls.

Erzherzog Anton Victor Joseph (1779-1835)
Erzherzog Anton war einer der zwölf Söhne von Kaiser Leopold II. (1747
1792), Bruder von Erzherzog Rudolph. Ursprünglich als gewählter
Nachfolger des Kurfürsten von Köln und Bischof von Münster vorgesehen,
kam dies durch die Auflösung der geistlichen Fürstentümer 1802
(Säkularisation) im Gefolge der napoleonischen Kriege nicht zu Stande.
Er wurde 1804 Hochmeister des Deutschen Ordens (hier im Bild
dargestellt), war 1816 bis 1818 Vizekönig des Königtums
Lombardo-Venetien. Danach übernahm er keine Ämter mehr, engagierte sich
aber in der Zivilgesellschaft. So war er u. a. Protektor der
Gesellschaft der Musikfreunde, der Gesellschaft der Blumenfreunde Wiens
und des Wiener Blinden-Institutes. In Baden hatte er sein Sommerpalais
in der Antonsgasse 10 - 12, das nach dem Stadtbrand von 1812 erbaut
worden war. Er war ein großzügiger Gönner und Wohltäter Badens. Selbst
botanisch sehr interessiert, veranlasste er zahlreiche Maßnahmen zur
landschaftlichen und gärtnerischen Verschönerung Badens, wovon die
Antonsgrotte im Helenental bis heute zeugt. Darüber hinaus förderte er
Badeeinrichtungen und die Armenfürsorge.

Kaiser Ferdinand I. (19.4.1793 - 29.6.1875)
Ferdinand war der älteste Sohn von Kaiser Franz I. Von Geburt an war er
von schwächlicher Konstitution, hatte einen Wasserkopf und litt an
epileptischen Anfällen. Schon von seinem Aussehen her war er als
Herrscher über das große Habsburgerreich wohl eher ungeeignet. Dennoch
wurde er im Jahre 1835 zum Kaiser gekrönt. Seine Regierungsgeschäfte
aber führte Fürst Metternich. Ferdinand war anderen - schöngeistigen -
Dingen zugetan: Er sprach fünf Sprachen, spielte zwei Instrumente,
wusste gut zu zeichnen, zu reiten und zu fechten und nahm regen Anteil
am Fortschritt der Wissenschaften. Seine soziale Ader für die Armen und
Schwachen, sowie seine oft etwas einfältig anmutende Art verschafften
ihm den Beinamen „Ferdinand der Gütige", was bald zu „Gütinand der
Fertige" verballhornt wurde.
1831 wurde Ferdinand mit der sardinischen Königstochter Maria Anna
verheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. 1848 dankte er zugunsten seines
Neffen Franz Joseph ab. Danach lebte er mit seiner Frau als Privatmann
in Prag und verwaltete die Güter des Herzogs von Reichstadt. Bis 1832
kommt er regelmäßig mit seinem Vater nach Baden. Doch nach einem
Attentat, das er zwar heil übersteht, bleibt er der Stadt hinkünftig
und endgültig fern. Zur Erinnerung an seine so glückliche Errettung
wird der Ferdinandbrunnen an der Pestsäule errichtet.
* * *
Kaiser Ferdinand von Österreich (1793-1875; Kaiser 1835-1848)
Kaiser Ferdinand war der älteste Sohn von Kaiser Franz I. Sein Vater
und seine Mutter (Marie Theresia beider Sizilien) hatten die gleichen
Großeltern, was Auswirkungen auf ihre Nachkommen hatte. Ferdinand war
körperlich und geistig behindert (Epilepsie), weshalb Franz I. dafür
sorgte, dass die Regierungsgeschäfte von der „Geheimen Staatskanzlei"
geführt wurden (u. a. von Ferdinands Bruder EH Franz Karl - dem Vater
von Kaiser Franz Joseph - und Staatskanzler Fürst Clemens Metternich).
Ferdinand zeigte sich interessiert an Technik und den Fortschritten in
der Landwirtschaft, wodurch zahlreiche Neuerungen im Staat erfolgt
sind. Politisch kam es allerdings zur Stagnation und sozialen
Spannungen. Diese führten im März 1848 zur Revolution. Am 2. Dezember
übergab Ferdinand die Regierung seinem Neffen Franz Josef. Danach lebte
er in Prag und widmete sich der Verwaltung seiner Güter, deren Erträge
gesteigert werden konnten, was Franz Josef ein reiches Erbe einbrachte.
1832 erfolgte in Baden auf ihn ein misslungenes Pistolenattentat durch
einen frustrierten Hauptmann. Am Hauptplatz in Baden erinnert der
Ferdinandbrunnen an den „gütigen" Kaiser, der sich großer Beliebtheit
erfreut hat.

Erzherzog Franz Carl
Franz Carl (1802 1878) war der dritte Sohn von Kaiser Franz I., und
Bruder von Kaiser Ferdinand. Wie sein kaiserlicher Onkel ist er hier
ebenfalls im Ornat eines Ritters vom Goldenen Vlies dargestellt, mit
dem Großstern des Stephans-Ordens. Er hat 1824 die Prinzessin Sophie
Friederike von Bayern geheiratet, mit der er fünf Kinder hatte. Auf
Drängen seiner Frau verzichtete er im Dezember 1848 nach der Abdankung
Kaiser Ferdinands zu Gunsten seines Sohnes Franz Josef auf die
Thronfolge. Politisch unbedeutend, war er sehr an Kunst und Kultur
interessiert, Protektor zahlreicher Institutionen. Am Bekanntesten
dabei das Franzisco-Carolinum, das heutige Oberösterreichische
Landesmuseum (nach seinem Tod übernahm Kronprinz Rudolf das
Protektorat), und das Theater in Bad Ischl).




Kaiser Franz Joseph (18.8.1830 - 21.11.1916)
Nach der Abdankung Kaiser Ferdinands I., des „Gütigen", bestieg Franz
Joseph mit nur 18 Jahren den kaiserlichen Thron. Außen- und
innenpolitisch erlebte Kaiser Franz Joseph eine Serie kleiner Siege,
vor allem aber auch große Niederlagen. Die Nationalitätenkonflikte in
den Ländern der Monarchie wurden jedoch zum größten Problem während
seiner Regentschaft. Besonders der wirtschaftliche Aufschwung der
Donaumonarchie - Verkehrswesen, Industrialisierung,
Weltausstellung -ist mit der Ära Kaiser Franz Josephs verbunden.
Die altösterreichische Prägung vieler Städte im Reich und der Bau der
Wiener Ringstraße mit seinen prächtigen Gebäuden stellen heute noch ein
beredtes Zeugnis dieser Epoche dar.
1854 heiratete Franz Joseph seine sechzehnjährige Cousine Elisabeth.
Der anfänglich glücklichen Ehe mit „Sisi" entstammten 4 Kinder: Rudolf,
der Kronprinz, nahm sich 1889 in Mayerling das Leben. In der Thronfolge
rückte nun der Neffe des Kaisers nach. Die Ermordung Franz Ferdinands
in Sarajewo 1914 gab schließlich den entscheidenden Anstoß für den
Ersten Weltkrieg. Besuche des Kaisers in Baden sind aus familiären
Gründen nicht selten: Erzherzog Albrecht und Erzherzog Rainer zählen zu
den Favoriten. Es waren an die zehn Besuche, aber nur ein offizieller:
am 14.6.1899. Bei dieser Gelegenheit wird die Badener
Schützengesellschaft beauftragt, das „9. NÖ. Landesschießen" in Baden
entsprechend auszurichten. Noch zu Lebzeiten Sisis tritt Katharina
Schratt in das Leben des Kaisers. Die spätere Schauspielerin wurde am
11. September 1853 in Baden geboren. Nach Auftritten in Wien und Berlin
wird sie k u. k. Hofschauspielerin und gastiert mehrmals auch in Baden
unter großem Beifall.
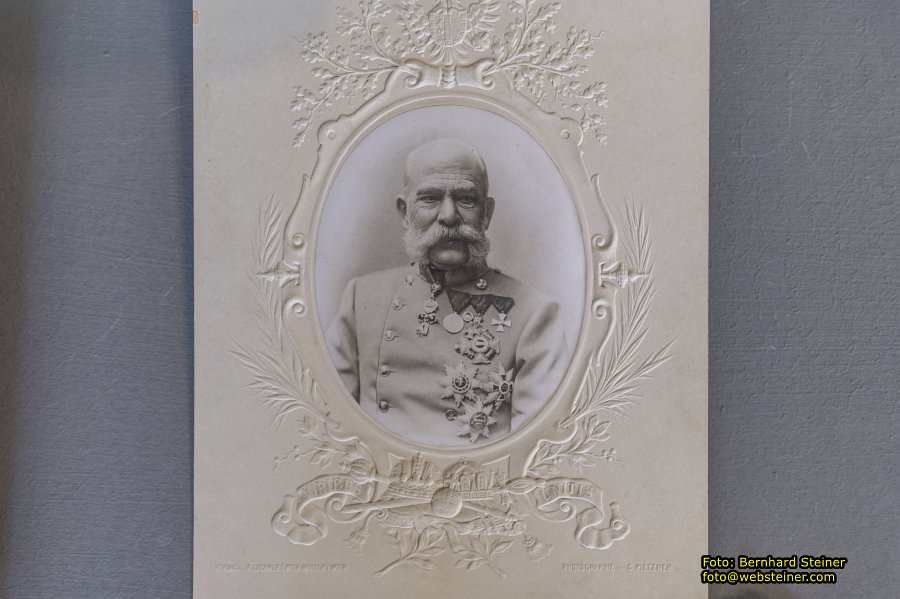
Kaiserin „Sisi"
Elisabeth, die Ehefrau Franz Josephs, war zu ihren Lebzeiten eine vom
Wiener Hof eher minder geachtete Kaiserin, zum einen, da sie nicht dem
höchsten Hochadel entstammte, zum anderen, weil sie nur widerstrebend
die Etikette erfüllte und sich nicht so einfach dem Hofzeremoniell
beugen wollte. Dennoch wurden alle Feste und Jubiläen feierlichst
begangen: mit zahlreichen Abbildern der Kaiserin und des Kaisers, mit
mehrseitigen Broschüren zu den Huldigungsfestzügen, mit
Erinnerungsmedaillen, Huldigungsbällen, Statuetten etc. Berühmt wurde
Elisabeth aber erst durch die „Sissy"-Filme. Hubert Marischka, der
Regisseur, zeichnete eine Kaiserin von mädchenhaftem Liebreiz und
stolzer Anmut, die dem Kaiser stets wohlmeinend und zugeneigt war. Mit
dem Leben der Kaiserin hatten diese jedoch wenig zu tun.
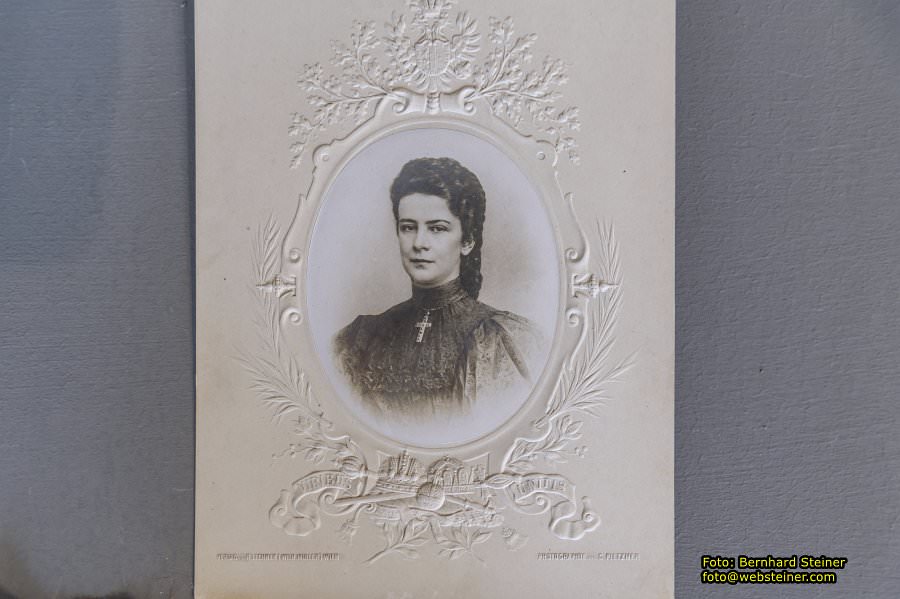

Erzherzog Wilhelm (21.4.1827 - 29.7.1894)
Wilhelm Franz Carl war der jüngste Sohn von Erzherzog Karl und
Henriette von Nassau. Nachdem er im Alter von zwei Jahren die Mutter
verlor, wurde er vorwiegend von Männern großgezogen: von seinem Vater
und seinem älteren Bruder Albrecht. Dementsprechend verlief auch sein
Werdegang: 1842 begann er seine erfolgreiche Karriere als Militarist,
durchlief alle Ränge, und bis zu seinem Tod war er überdies
„Hochmeister des Deutschen Ordens". Als Wohnort ließ er auf der
Ringstraße in Wien das stattliche „Deutschmeister-Palais" erbauen.
Darüber hinaus setzte er wichtige Impulse auf den Gebieten der
Zivilkrankenpflege und baute das Feldsanitätswesen maßgeblich aus.
Dafür erhielt er auch vom Kaiser finanzielle Unterstützung. Erzherzog
Wilhelm war nicht verheiratet, war ihm doch als Hoch- und
Deutschmeister ein zölibatäres Leben vorgeschrieben. 1884 lässt er nahe
der Weilburg die „Eugenvilla" erbauen. Auch sind ihm Badener
Angelegenheiten ein Anliegen, besonders der 1892 gegründete Badener
Trabrennverein. 1894 stürzt er, ein hervorragender Reiter, vom Pferd
und verstirbt unmittelbar danach.
Erzherzog Rainer (11.1.1827 - 27.1.1913)
Erzherzog Rainer war ebenfalls ein Neffe von Kaiser Franz I. Er wurde
von Franz Joseph I. an die Spitze des Reichsrats berufen. Auch Rainer
wählte, wie durchaus üblich, die Militärlaufbahn und befehligte
1868-1906 als Oberkommandeur die Landwehr, beziehungsweise ab 1874
diese als Feldzeugmeister. Erzherzog Rainer, ein Freund von Kunst und
Wissenschaft, war außerdem Kurator der Akademie der Wissenschaften und
Protektor des Museums für Kunst und Industrie. 1884 erwarb er die in
Fayum gefundene Papyrussammlung, die er 1899 dann der k.u.k.
Hofbibliothek vermachte.
1852 nahm er seine Cousine Maria Karolina zur Frau. Sie war die Tochter
Erzherzog Karls und Henriette. Vor ihrer Heirat war Maria Karolina mit
bereits 19 Jahren hochnoble Äbtissin eines Damenstiftes in Prag. Als
„Tante Marie Rainer" war sie in Baden sehr populär. 1873 übernimmt sie
von Kaiserin Carolina Augusta deren Aufgabe in der Kleinkinder
Bewahranstalt Mariengasse. Ab 1892 hat sie, zusammen mit Erzherzogin
Maria Immaculata, das Protektorat über das Wohltätigkeitsparkfest inne,
das zugunsten des Fonds der „Badener Schulküche" und eines Spitals für
arme Kinder alljährlich stattfindet. Als Kind wohnt sie dauerhaft auf
Schloss Weilburg. 1874 kaufen Erzherzog Rainer und Maria Karolina für
ihren Sommeraufenthalt die Villa Epstein in Baden, die heutzutage unter
dem Namen „Rainer Villa" bekannt ist. Erzherzog Rainer war oft zu Gast
in diesem Museum.
Kaiser Franz I. (12.2.1768 - 2.3.1835)
Franz war der erste Enkel Maria Theresias und Neffe von Joseph II. Da
dieser kinderlos blieb, war Franz sein natürlicher Nachfolger. Er war
der letzte Kaiser des HI. Römischen Reiches Deutscher Nation,
begründete jedoch 1804 als Franz I. das erbliche Kaisertum Österreich
und legte schließlich 1806 die deutsche Kaiserwürde ab. Die
Regierungsgeschäfte überließ er großteils Staatskanzler Metternich. Die
Abfassung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, die Gründung der
Österreichischen Nationalbibliothek und die Errichtung der
Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft sind jedoch aufs Engste mit seiner
Regentschaft verknüpft.
1793 kommt Franz das erste Mal zur Kur in die Stadt Baden. Ab diesem
Zeitpunkt wiederholt er seine Besuche regelmäßig und wählt schließlich
die Stadt zu seiner „Sommerresidenz". Kaiser Franz hat einen
ausgeprägten Familiensinn, fühlt sich bürgernah und seinen Untertanen
sehr verbunden. Er wird von der Bevölkerung daher oftmals „der Gute"
genannt. Nach dem verheerenden Brand von Baden im Jahre 1812 hat Franz
sehr wesentlich Anteil an ihrem Wiederaufbau. Er erwirbt 1813 das
Esterházysche Haus am Hauptplatz. das ab diesem Zeitpunkt bis heute
unter „Kaiserhaus" firmiert. 1810 gibt er seine Tochter Marie Louise
Kaiser Napoleon zur Frau, und 1811 kommt Franz Joseph Karl als König
von Rom zur Welt, später bekannt als der jung verstorbene Herzog von
Reichstadt. Mit ihm verweilt seine Mutter immer wieder in Baden. Sie
ist hier oft als Kind gewesen, 1814 und 1818 im Kaiserhaus, 1823 im
früheren Haus Nr. 19 auf dem Hauptplatz, 1828 im Haus des später
berühmten Badener Casinos sowie 1830 und 1834 in der sogenannten
Floravilla.

HISTORISCHER-ZEITSTROM des heutigen Kaiserthuns Oesterreich
Von den Regierungs-Jahren Kaiser Karls des Grossen im achten
Jahrhunderte angefangen, bis zum Abschlusse des Münchner
Staatsvertrages in Jahre 1846.
VON FERDINAND RITTER von DRESDNERN
WIEN 1826