web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Bremen
Freie Hansestadt Bremen, September 2024
Die Stadtgemeinde Bremen ist die Hauptstadt des
Landes Freie Hansestadt Bremen (kurz ebenfalls „Bremen“, und die
zehntgrößte Stadt in Deutschland. Bremen liegt zu beiden Seiten der
Weser, etwa 60 Flusskilometer vor deren Mündung in die Nordsee bzw.
deren Übergang in die Außenweser bei Bremerhaven.
* * *
Bremen Hauptbahnhof ist der
wichtigste Bahnhof in der Stadtgemeinde Bremen, im Zwei-Städte-Staat
Freie Hansestadt Bremen und in der Metropolregion Nordwest. Er befindet
sich nordöstlich der Innenstadt in der Bahnhofsvorstadt. Er steht mit
täglich insgesamt rund 147.000 Reisenden und Besuchern auf Platz 11 der
meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Das von 1885 bis
1889 errichtete Gebäude am Bremer Bahnhofsplatz entwarf der Architekt
Hubert Stier im Stil der Neorenaissance. Auf neun Gleisen verkehren pro
Tag im Durchschnitt 80 Fern- und 450 Nahverkehrszüge. Vor dem Bahnhof
befinden sich Haltestellen von Stadtbussen und Straßenbahnen der BSAG
sowie anderer Anbieter.

Zum Schutz des zwischen 1574 und 1590 angelegten Weserhafens wurde am
Westufer der Weser die befestigte Neustadt angelegt. Die Weser
versandete jedoch zunehmend, und für die Handelsschiffe wurde es immer
schwieriger, an der seit dem 13. Jahrhundert als Hochseekai genutzten
Schlachte anzulegen. Von 1619 bis 1623 bauten deshalb im flussabwärts
gelegenen Vegesack niederländische Konstrukteure den ersten künstlichen
Hafen Deutschlands.

Die Teerhofbrücke in Bremen ist
eine Fußgängerbrücke über die Weser. Sie verbindet die Weserhalbinsel
Teerhof mit der Schlachte und der Bremer Altstadt. Die Brücke hat eine
Länge von etwa 117,7 Meter und die Unterbauten wurden aus Stahlbeton
errichtet, der Überbau in Verbundbauweise. Der Hohlkörper ist in Grün,
das Geländer in Blau gehalten. Zur Schlachte hin wird das Bauwerk durch
seinen breiten Treppenabgang aufgeweitet, der bei Veranstaltungen als
Sitztribüne dient.

Die Schlachte - Historisches Hafenrevier Schlachte
Die Schlachte war über 600 Jahre lang der Hafen Bremens. 1250 wurde sie
erstmals als "slait" erwähnt (mittelniederdeutsch von "eingeschlagenen"
Pfählen). Seit dieser Zeit wurde das Weserufer zum Hafen ausgebaut,
denn die Balge, der älteste Bremer Hafen, der bis zum Markt reichte
konnte von größeren Schiffen nicht angelaufen werden. Im 16.
Jahrhundert erhielt das Weserufer an der Schlachte eine aufragende
Kaimauer aus Stein. Schon seit dem 15. Jahrhundert ist auch das
Vorhandensein von Wuppen (Hebebäume) bezeugt, um 1600 erbaute man einen
Kran für den Umschlag schwerer Güter. Der Hafen zog sich über 400 m
Länge von der Martinikirche bis zum Fangturm. Über die Schlachtpforten
sorgten Gassen (Schlachtgänge) für die Anbindung des außerhalb der
Stadtmauer gelegenen Hafens an die Stadt. Die großen Tore wurden nachts
geschlossen, nur zwei kleine Pforten blieben stets offen und wurden vom
Stadtmilitär bewacht. Den Warentransport zwischen dem Hafen und den
Speichern in der Stadt besorgten Karrenschieber.
An der Schlachte war ein vielfältiges Hafengewerbe ansässig: Der
Schlachtevogt (Hafenmeister) und Schlachteschreiber übten die Aufsicht
aus und zogen Gebühren ein, Schlachtewächter sorgten für die
Sicherheit. Kran- und Wuppenmeister, Kornträger (Maskopträger) und
Tonnenträger besorgten den Umschlag zwischen Schiff und Kaje,
Karrenschieber und Fuhrleute erledigten den Zubringerverkehr in die
Stadt. Im 17. und 18. Jahrhundert arbeiteten ca. 300 Menschen im
Schlachtehafen. Neben Schiffsverkehr und Handel sorgten auch
Gasthäuser, Kellerschänken und Krüge für Leben im Hafen: an der
Schlachte befand sich in fast jedem zweiten Haus eine Gaststätte!
Durch die Versandung der Weser wurde Bremen aber für große Seeschiffe
immer schlechter erreichbar. Seit dem 18. Jahrhundert konnten nur noch
Weserkähne im Leichterverkehr von See kommende Waren nach Bremen
bringen. Erst die Weserkorrektion und der Bau des Freihafens 1884-1888
beendeten diesen Zustand. Die Schlachte hatte damit als Hafen
ausgedient, sie wurde seit 1899 in eine Grünanlage umgewandelt. Ihre
alte Bausubstanz an Kontorhäusern ging im Zweiten Weltkrieg - vor allem
im Luftangriff am 6. Oktober 1944 - verloren. Nach dem Krieg wurde
zwischen Fluß und Mauer eine aufgeschüttete Rampe zur Weserpromenade
erweitert. Im Jahr 2000 wurde die Bremer Schlachte städtebaulich
aufgewertet und in neuer Gestalt wiedereröffnet.

St. Martini Kirche - Backsteinkirche aus dem 13. Jh. mit evangelisch-lutherischen Gottesdiensten und gotischer Architektur.

Propsteikirche St. Johann
Im 14. Jahrhundert als Klosterkirche des Franziskaner-Ordens erbaut.
Die dreischiffige Hallenkirche bietet mit ihrem feingliedrigen Giebel
ein prägnantes Beispiel der Backstein-Gotik. Nach wechselnden Nutzungen
dient die Propsteikirche St. Johann seit 1823 wieder als katholisches
Gotteshaus; im Inneren wurde damals ein zweiter Fußboden zum Schutz vor
Hochwasser eingezogen.

St. Johann ist eine römisch-katholische Pfarrkirche zugleich auch
Propsteikirche in Bremen. Sie wurde im 14. Jahrhundert als
Klosterkirche des Franziskanerordens erbaut. Ihre Pfarrgemeinde gehört
zum Dekanat Bremen des Bistums Osnabrück.

Das Kirchengebäude ist ein überaus prägnanter Vertreter der
Backsteingotik. Alle drei Kirchenschiffe werden von einem einzigen
großen Satteldach überdeckt. Durch diese Bauform erhält der Westgiebel
seine außergewöhnliche Form und Größe. Er ist in drei Geschosse
unterteilt, die ihrerseits durch paarweise angeordnete
Spitzbogenblenden gegliedert werden. Der Grund der Spitzbogenblenden
ist ornamental ausgemauert, die Spitzbogenfelder sind verputzt.

Die Kirchenfenster wurden in den Jahren 1955 bis 1957 durch den
Künstler Walter Klocke geschaffen. Dargestellt sind bedeutende Heilige
wie der Namenspatron Johannes der Täufer sowie Petrus, Paulus,
Franziskus, Gertrud von Helfta und Elisabeth von Thüringen, aber auch
Heilige aus dem Bremer Raum, nämlich Willehad, Ansgar, Rimbert und Emma
von Lesum.

Die Orgel von St. Johann wurde 1965 von der Orgelbaufirma Franz Breil
(Dorsten) erbaut. In den Siebziger Jahren wurde sie durch die
Erbauerfirma umintoniert. Das Instrument hat 47 Register auf drei
Manualen und Pedal mit mechanischer Spiel- und elektrischer
Registertraktur.

Die Böttcherstraße ist eine 108
m lange Straße in der Bremer Altstadt, die aufgrund ihrer Architektur
zu den Kulturdenkmalen und Touristenattraktionen in Bremen zählt. Die
meisten Gebäude sind in der Zeit von 1922 bis 1931 entstanden und
hauptsächlich Ludwig Roselius (1874–1943), einem Bremer Kaffeekaufmann
und Mäzen, zu verdanken. Roselius beauftragte die Architekten Eduard
Scotland (1885–1945), Alfred Runge und den Bildhauer Bernhard Hoetger
(1874–1949) mit der künstlerischen Gestaltung. Die Straße und ihre
Gebäude sind ein seltenes Beispiel für die Architektur des
Expressionismus. Von den Häusern können mehrere dem Stil des
Backsteinexpressionismus zugeordnet werden.

Das Haus des Glockenspiels in
der Bremer Böttcherstraße ist bekannt durch sein Glockenspiel aus
Meißner Porzellanglocken und die von Bernhard Hoetger entworfenen
Holztafeln in einem drehbaren Turm-Teil.

Handwerkerhof mit Bremer Staatswappen 1571 und Statue 'Schauender Knabe' von 1936 auf der Terrasse des Paula-Becker-Modersohn-Hauses in der Böttcherstraße

Sieben-Faulen-Brunnen von Hoetger im Handwerkerhof
Errichtet: vor 1930; Anlass: Erinnerung an die Sage der Sieben Faulen;
Entwurf: Bernhard Hoetger; Ausführung: Otto Meier; Material: Backstein
(Sockel) und Bronze (Rohre); Aufstellungsort: Im Handwerkshof der
Böttcherstraße.
Die Legende der Sieben Faulen stammt von dem Bremer
Volksmärchen-Schriftsteller Friedrich Wagenfeld (1810–1846). Die
Legende erzählt von sieben faulen Söhnen eines armen Bauern, die in die
Welt hinausziehen und mit innovativen Ideen zurückkommen.

Der Lichtbringer ist der Titel
eines großen, vergoldeten Bronzereliefs von Bernhard Hoetger aus dem
Jahr 1936 über dem Eingang zur Böttcherstraße in Bremen. Das
großformatige, quadratische Relief (383 × 383 cm) wird dominiert von
der gestreckten Figur eines lockigen, schwerthaltenden, unbekleideten
Jünglings, der aus der rechten oberen Ecke diagonal herabstürzend
Schwert und abweisende Hand gegen ein dreiköpfiges Schlangen- oder
Drachenwesen richtet.

Krugträgerin
Errichtet: 1912; Ausführung: Bernhard Hoetger, Material: Gussstein, Aufstellungsort: Straße Hinter dem Schütting

Altes Rathaus
1405-1409 als repräsentativer
und wehrhafter Bau zusammen mit dem Roland von 1404 auf einem Höhepunkt
der mittelalterlichen Stadtgeschichte errichtet. Der Saalgeschossbau
aus wechselnd rotem und schwarz glasiertem Ziegelstein ist 42 m lang
und 16 m breit, sein Innenausbau erfolgte bis 1412. Im dreischiffigen
Ratskeller ruht das Gewölbe auf 20 Pfeilern aus Sandstein, in der
Unteren Halle stützen 20 Eichenholzständer die Balkendecke. Die Obere
Halle ist als ungeteilter Saal mit frei tragender Decke reich
ausgestattet mit Wandbildern, Schmuckportalen und Holzschnitzereien.
An der Marktfassade zeigen acht Monumentalskulpturen den Kaiser (links)
und die Kurfürsten. Der Figurenzyklus verdeutlicht den Anspruch der
Stadt auf Reichsfreiheit. An den Schmalseiten über den Eingängen
Prophetenfiguren (zum Dom hingewandt Petrus), später umgedeutet als
Philosophen. Vor der Marktfassade eine Arkadengalerie mit elf Jochen,
im Norden seit dem 16. Jh. verschiedene Anbauten.
1608-1614 Umgestaltung der
Marktfassade im Renaissancestil unter dem Bremer Baumeister Lüder von
Bentheim. Ein Mittelrisalit wurde vorgesetzt. Es entstand ein gläserner
Erker mit einem flandrischen Giebel, rechts und links davon je ein
weiterer Schmuckgiebel. Die schmuckvolle Fassade ist ein Meisterwerk
der Weserrenaissance, ihr reichhaltiges Bildprogramm ist zu verstehen
als ein moralischer Appell an die Regierenden im Sinne republikanischer
Bürgertugenden.
1616 in der Oberen Halle
Fertigstellung der Güldenkammer mit bedeutenden Holzschnitzwerken. 1905
gestaltete Heinrich Vogeler die Kammer im Innern zu einem
Gesamtkunstwerk im historisierenden Jugendstil.
2004 Aufnahme des Ensembles aus
Altem und Neuem Rathaus gemeinsam mit dem Roland in die UNESCO-Liste
Welterbe der Menschheit als ein außergewöhnliches Beispiel eines
spätmittelalterlichen Rathauses, das für bürgerliche Autonomie und
städtische Freiheit einer bis heute selbstständigen Stadtrepublik steht.

Der Bremer Roland, eine 1404
errichtete Rolandstatue auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, ist ein
Wahrzeichen Bremens und gilt als ältester erhaltener Steinroland. Die
Figur hat eine Höhe von 5,47 Metern und steht auf einem 60 Zentimeter
hohen, gestuften Podest. Im Rücken wird sie von einem Pfeiler gestützt,
der von einem gotisch ornamentierten Baldachin gekrönt wird. So
erreicht das Denkmal eine Gesamthöhe von 10,21 Metern und ist damit die
größte freistehende Statue des deutschen Mittelalters.
Dargestellt ist der aus Liedern und Epen (Rolandslied) bekannte
Heerführer und angebliche Neffe Karls des Großen. Roland steht also auf
dem Markt als Repräsentant des Kaisers, er verkündet und garantiert die
Marktrechte und Freiheiten, die der Stadt angeblich verliehen worden
waren. Der Schild mit dem Doppeladlerwappen des Reiches ist Zeichen des
so lange umkämpften Bremer Anspruches auf Reichsfreiheit.

Das Bismarck-Denkmal am Bremer Dom ist ein 1910 eingeweihtes bronzenes
Reiterdenkmal für den 1898 verstorbenen ehemaligen Reichskanzler Otto
von Bismarck. Der renommierte Münchner Bildhauer Adolf von Hildebrand
hatte dazu 1904 den Auftrag bekommen.
Als eines der wenigen Monumente, die Bismarck in Form eines
Reiterstandbilds darstellen, zeigt das Denkmal den Reichskanzler auf
einem sechs Meter hohen Steinsockel aus Untersberger Kalkstein mit Helm
und leicht stilisierter Uniform seines Kürassierregiments. Dem hohen
Standort angemessen sind die figürlichen Einzelelemente kraftvoll und
kompakt modelliert. Die Kopfwendung des Pferdes zum Domshof hin gibt
dem Denkmal etwas Lebendigkeit. Die in der rechten Hand gehaltene Rolle
wird als Verfassungsschrift interpretiert.

Otto von Bismarck (1815–1898),
der preußische Politiker und von 1871 bis 1890 Reichskanzler, wurde vor
allem wegen seiner Rolle bei der Reichsgründung im konservativen
Bürgertum als „Eiserner Kanzler“ hoch verehrt, auch nachdem er 1890 von
Kaiser Wilhelm II. entlassen worden war. Sein Verhältnis zur
offiziellen Bremer Politik war wegen abweichender Interessen in
kolonialpolitischen und Handelszollfragen nicht immer ungetrübt.
Gleichwohl betrachtete man ihn in Bremen, wie in anderen
nichtpreußischen Staaten auch, als Symbolfigur der nationalen Einheit.
Hunderte von Bismarck-Denkmälern entstanden, teils schon zu Lebzeiten
des Reichskanzlers, vor allem aber nach seinem Tod am 30. Juli 1898.

St. Petri-Dom
Weihe der ersten Kirche um 789 durch Bischof Willehad. Nach Brand 1041
grundlegende Vorgaben für den Bau unter den Erzbischöfen Bezelin
(1035-43) und Adalbert (1043-72). Als dreischiffige Basilika mit Ost-
und Westkrypta geht der heutige Dom auf Erzbischof Liemar (1072-1101)
und seine Nachfolger zurück. Im Jahr 1483 erneut Zerstörungen durch
Brand. Ergänzung des mittelalterlichen Baus durch ein spätgotisches
Nordschiff während der Amtszeit von Erzbischof Johann III. Rode
(1497-1511). Im 17. und 18. Jahrhundert unter schwedischer und
hannoverscher Verwaltung.
Grundlegende Restaurierung ab 1888 durch Max Salzmann und Ernst
Ehrhardt; Aufbau der teilweise eingestürzten Westfront und des
Vierungsturms. 1899-1902 Gestaltung des Dominneren durch den
Kirchenmaler Hermann Schaper in Anlehnung an mittelalterliche
Dekorationsvorstellungen; Erneuerung während Domrestaurierung 1972-87.
Im Inneren bedeutende Reste mittelalterlicher Ausstattung, romanische
Krypten und Dommuseum; angrenzend der Bleikeller.

Die Domportale mahnen uns
Die Türen des St. Petri Doms sind 1891 von dem Kölner Künstler Peter
Fuchs entworfen worden. Das linke Portal zeigt Szenen aus dem Alten
Testament, das rechte aus dem Neuen Testament. Verschiedene
Darstellungen der Israeliten und Juden tragen deutlich antisemitische
Züge. Darin nehmen die Domtüren das christliche Kunstverständnis ihrer
Zeit auf. Die St. Petri Domgemeinde ist sich bewusst, dass es sich
hierbei um christliche Antijudaismen handelt. Sie weiß um die Shoa und
das schwere Leid, das Jüdinnen und Juden zugefügt wurde. Auch unsere
Gemeinde hatte daran ihren Anteil. Heute fühlt sie sich verpflichtet,
das Verständnis zwischen Judentum und Christentum zu fördern. Daher
versteht die St. Petri Domgemeinde. diese Portale als Mahnmal. Es
fordert dazu auf, sich Diskriminierungen aus ethnischen und religiösen
Gründen bewusst zu machen und sie entschieden zurückzuweisen.
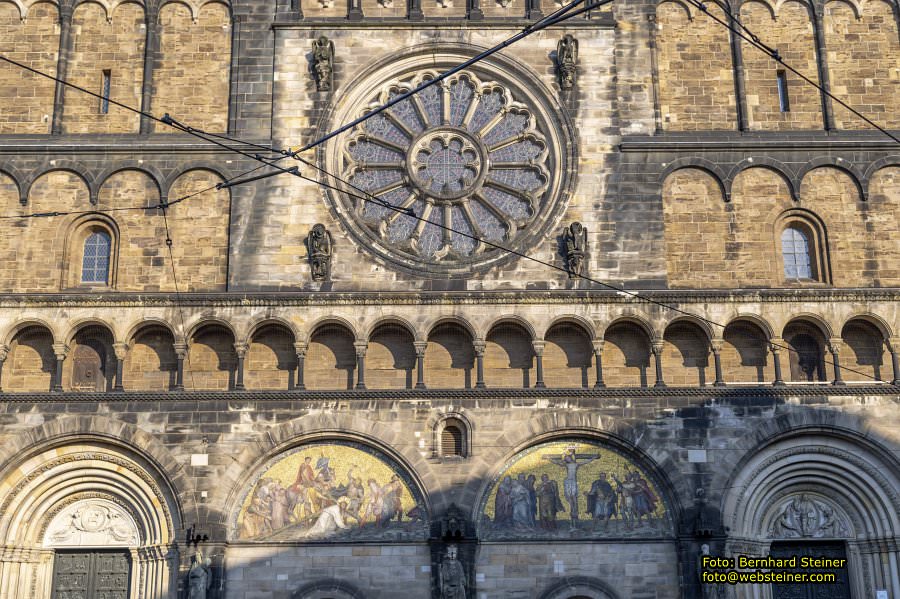
Der Bremer Dom war seit 789 die Kathedrale des mächtigsten Erzbistums
in Nordeuropa. Bremer Missionen verbreiteten das Christentum über ganz
Skandinavien und entlang der Ostseeküste bis ins Baltikum, wo sie die
Stadt Riga gründeten. Der heutige Dombau wurde im Jahr 1042 begonnen.
Seit 1547 ist die Domgemeinde evangelisch.

- 787 Der Missionar Willehad wird von Karl dem Großen zum Bischof von Bremen berufen. Er weiht den ersten steinernen Dombau789.
- 860 Ansgar, „der Apostel des Nordens“, lässt nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Hamburg-Bremen eine dreischiffige Saalkirche erbauen.
- 1042 Nach einem Brand beginnt Erzbischof Bezelin den Neubau einer mehr als doppelt so großen romanischen Basilika in den heutigen Maßen.
- 1240 Die flache Decke wird Mitte des13. Jh. unter Erzbischof Gerhard II. gotisch eingewölbt. Der Dom erhält ein neues Westwerk mit Türmen.
- 1502 Erbischof Johann III. Rode lässt das Nordschiff im spätgotischenStil erhöhen; einen weiteren Umbau verhindern die Wirren der Reformation.
- 1638 Nach fast hundert Jahren Schließung und Verfall wird der Dom mit neuer Kanzel wieder geöffnet.
- 1888 Die erste große Domrestaurierung erneuert die Türme, Fassaden, Bronzetüren und die Orgel. Der Innenraum wird wieder farbig ausgemalt.
- 1945 Im Zweiten Weltkrieg beschädigen Bombentreffer das Nordschiff, die Orgel und alle Fenster.
- 1972 Durch die zweite große Restaurierung erhält der Dom die letzten neuen Fenster, beide Altäre sowie die Chorgitter. Mit den Bodengrabungsfunden wird 1987 das Dom-Museum gegründet.

Am Vorabend der Reformation soll der Dom fünfzig Altäre beherbergt
haben, von denen keiner erhalten blieb. Der Hauptaltar ist heute
schlicht. Weitere drei Altäre befinden sich in den beiden Krypten und
an der Nordseite des Hauptschiffs.

Die Rose im Westen und die Farbfenster der Chorschlusswand schuf 1946
der Bremer Georg Rohde. Die „Anbetung der Hl. Drei Könige“, wurde 1953
von dem deutschen Maler Charles Crodel entworfen.
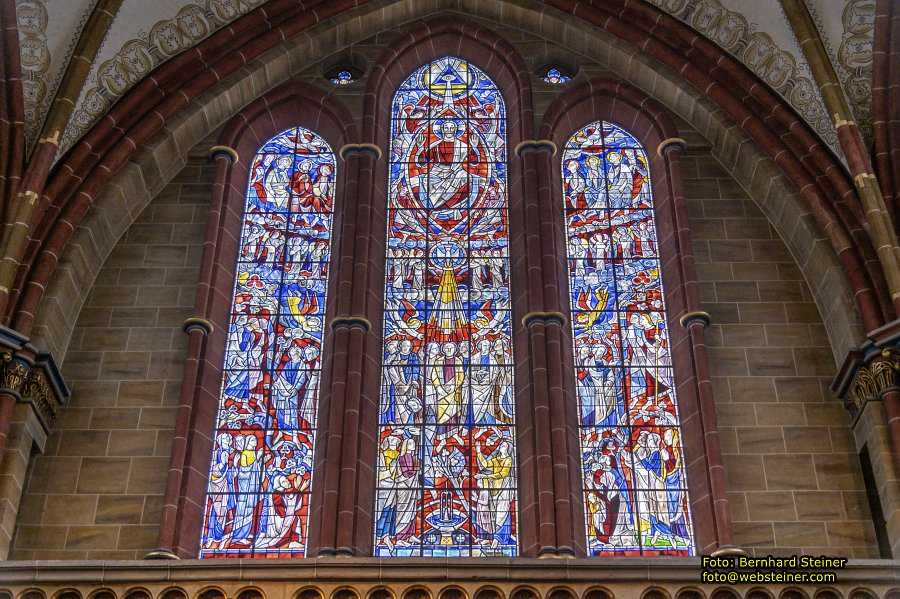
Der dänische Erzbischof Friedrich II. ließ 1638 zur Wiedereröffnung des Doms nach fast hundert Jahren Schließung eine barocke Kanzel
errichten. Sie galt als Bekenntnis des Doms zur lutherischen Liturgie
gegen den reformierten Rat der Stadt Bremen. Jürgen Kriebel,
Hofbildhauer in Kopenhagen, schuf die Lindenholz-Figuren des David mit
den vier Evangelisten, der Propheten und Apostel sowie des
auferstandenen Christus auf dem Schalldeckel.

An der Ostwand des nördlichen Querschiffes befindet sich die im Stile des Neobarock gehaltene Bach-Orgel
mit 35 Registern, die zwischen 1965 und 1966 in der Werkstatt der
niederländischen Orgelbauer van Vulpen in Utrecht gefertigt und am 20.
Februar 1966 mit einem Konzert von Käte van Tricht eingeweiht wurde.
Sie ersetzte die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte erste
Bachorgel des Erbauers Wilhelm Sauer, die anlässlich des 26. deutschen
Bachfestes 1939 im Dom eingeweiht wurde.

Nachdem der Dom am 23. September 1638 wieder für (jetzt lutherische)
Gottesdienste geöffnet worden war, ließ der letzte Bremer Erzbischof
Friedrich Prinz von Dänemark 1641 die figürlich reich geschmückte Kanzel
durch Jürgen Kriebel, den Glückstädter Hofbildhauer des Dänenkönigs
Christian IV., anfertigen. Die Kanzel hatte ursprünglich eine farbige,
in der Barockzeit eine weiß-goldene Fassung und im 19. Jahrhundert
einen braunen Anstrich, der um 1977 entfernt wurde. Das Bildprogramm
beginnt mit den vier Evangelisten am Treppengeländer, sie flankieren
eine als David beschriftete Figur. Um den Kanzelkorb sind Propheten des
Alten Testamentes (Jeremia, Jesaja, Daniel, Hesekiel und Moses)
seitlich Johannes dem Täufer und einem Christus Salvator dargestellt.
Den Schalldeckel umringen acht Apostel, er wird überhöht durch den über
das Böse siegenden, auferstehenden Christus. Die Kanzel erhebt sich
seit jeher am mittleren Pfeiler der nördlichen romanischen Arkade des
Hauptschiffs.

Mehrere Fenster in den Kapellen des Südseitenschiffs stammen von Robert
Rabolt († 1974) aus München, die Obergadenfenster und andere entwarf
Heinrich Gerhard Bücker.


Im Zuge der Restaurierung des Westbaues des Bremer Domes erhielt der
Dom 1894 unter Verwendung des Schulze-Prospektes und des Contrabass 32'
von 1849 eine neue Orgel von Wilhelm Sauer. Eine Reihe von Umbauten
zwischen 1903 und 1958 führten zu umfassenden Veränderungen in der
technischen Anlage und einem Austausch bzw. Umbau/Umstellung von
insgesamt 58 originalen Sauer-Registern, um die Disposition dem
Zeitgeschmack im Hinblick auf die sogenannte Orgelbewegung anzupassen.
Vom dreimanualigen Instrument mit 65 Registern entwickelte es sich über
verschiedene Zwischenstufen zum viermanualigen Instrument mit 101
Registern. Durch eine umfassende Restaurierung (1995–1996) von
Christian Scheffler gelang es schließlich, zahlreiche zwischenzeitlich
entfernte Register der Ästhetik Wilhelm Sauers entsprechend zu
rekonstruieren. Darüber hinaus wurde der 1958 teilweise zerstörte
neogotische Prospekt wiederhergestellt sowie ein neuer fahrbarer
Spieltisch auf der Empore gebaut. Heute verfügt die große Sauer-Orgel
auf der Westempore über 98 Register. Die Orgelpfeifen sind in dem
gesamten, über 90 m² großen, Raum zwischen Orgelprospekt und
Fassadenwand verteilt.

Glocke 'Brema', Gussjahr 2022, Glockengießerei Grassmayr (Innsbruck), Durchmesser 2144 mm, Masse 7000 kg, Südturm, 4. Neuguss der Brema

Bremer Marktplatz - Malerischer Stadtplatz mit jährlichem Weihnachtsmarkt, der von berühmter Architektur umgeben ist.

Nach der Ostkrypta ist die Westkrypta
Bremens ältester Raum, die Weihe erfolgte 1066 durch Erzbischof
Adalbert. Die frühromanischen Tiersymbole und Pflanzenranken an den
Kapitellen der Säulen zeigen vermutlich die Handschrift lombardischer
Bildhauer, die Adalbert nach Bremen holte. Das Christusrelief an der
Altarwand wurde um 1050 für die erste Fassade geschaffen. Das bronzene Taufbecken
entstand im frühen 13. Jh. Es diente mit 217 Litern Inhalt zugleich als
Eichgefäß für die „Alte Bremer Tonne“, ein übliches Weinmaß. Auch heute
noch feiert die Gemeinde hier die Taufe.

Orgel von Gottfried Silbermann, vermutlich 1732/33
Ursprünglich in Etzdorf/Sachsen, zwischenzeitlich in Wallroda, später
in Privatbesitz. Mehrfach leicht umgebaut, 1993/94 von Kristian
Wegscheider (Dresden) restauriert und in den Originalzustand
zurückversetzt.

In der nördlichen Blendarkade der Erdgeschosszone stand, ebenfalls aus
Stein, die Skulptur eines kreuztragenden Christus (um 1490) und in der
südlichen ein gekreuzigter Christus der Zeit um 1400. Die in Venedig
ausgeführten Mosaiken in den mittleren Bogenfeldern der Blendarkaden
entwarf 1899–1901 Hermann Schaper, sie greifen Themen auf, die zuvor an
dieser Stelle skulptural dargestellt gewesen waren.

Das heute in Formen der Spätgotik gehaltene neugotische Brautportal
war ab 1818 schon einmal neu gestaltet worden, nach dem Vorbild des
nördlichen Westportals mit „romanischem“ Gewände aber spätgotischem
Maßwerkoberlicht.
Nördliches Seitenschiff spätgotisch, aber obere Fenster ab 1817, Brautportal

Das Bremer Rathaus ist eines der bedeutendsten Bauwerke der
Backsteingotik und der Weserrenaissance in Europa. Das Gebäude ist Sitz
des Senats und des Bürgermeisters (in Personalunion Senatspräsident)
der Freien Hansestadt Bremen. Das Bremer Rathaus liegt mitten in der
Bremer Altstadt an der Nordostseite des Marktplatzes. Die Herolde am
östlichen Portal des Alten Rathauses sind zwei Reiterfiguren, die
erstmals 1901 aufgestellt wurden. Der Bremer Kaufmann John H. Harjes
hatte diese vom Bildhauer Rudolf Maison geschaffenen Figuren 1900 bei
der Weltausstellung in Paris gesehen, gekauft und der Stadt geschenkt.
Bei den Herolden am Bremer Rathaus
handelt es sich um Freiplastiken zweier gepanzerter Ritter zu Pferd.
Die knapp überlebensgroßen und in Kupfer getriebenen Figurengruppen
flankieren das Ostportal des Alten Bremer Rathauses. Sie werden
traditionell als „Herolde“ bezeichnet.

Die Bremer Stadtmusikanten ist ein bekanntes Märchen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm:
Der alte Esel soll verkauft werden.
Deshalb flieht er und will Stadtmusikant in Bremen werden. Unterwegs
trifft er nacheinander auf den Hund, die Katze und den Hahn. Auch diese
drei sind schon alt und sollen sterben. Sie folgen dem Esel und wollen
ebenfalls Stadtmusikanten werden. Auf ihrem Weg kommen sie in einen
Wald und beschließen, dort zu übernachten. Sie entdecken ein
Räuberhaus. Indem sie sich vor dem Fenster aufeinanderstellen und mit
lautem „Gesang“ einbrechen, erschrecken und vertreiben sie die Räuber.
Die Tiere setzen sich an die Tafel und übernehmen das Haus als
Nachtlager. Ein Räuber, der später in der Nacht erkundet, ob das Haus
wieder betreten werden kann, wird von den Tieren nochmals und damit
endgültig verjagt. Den Bremer Stadtmusikanten gefällt das Haus so gut,
dass sie nicht wieder fort wollen und dort bleiben.
Die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Marcks (1953) vor dem Bremer Rathaus

Hirte mit Schweinen - Der Schweinehirt und seine Herde ist eine bronzene Figurengruppe in Bremen-Mitte am Ende der Sögestraße nahe bei den Straßen Am Wall und Herdentorsteinweg.
Das Denkmal, bestehend aus dem Schweinehirten, seinem Hund und seiner
Herde mit fünf Schweinen und vier Ferkeln, wurde 1974 nach einem
Entwurf des Bremer Bildhauers Peter Lehmann (1921–1995) aus Bronze
gefertigt. Die beliebte Skulpturengruppe wurde von den Kaufleuten der
Sögestraße finanziert. Sie steht für die Herkunft des Namens
Sögestraße: Die heutige Fußgängerzone Sögestraße war im Mittelalter als
Soghestrate (Plattdeutsch für Sauen) die Straße, an der wahrscheinlich
viele Schweineställe standen. Damals trieben die Hirten die Schweine
von hier durch das Herdentor in der Bremer Stadtmauer zur Bürgerweide,
eine Allmendefläche (gemeinschaftliches Eigentum) vor der Stadt.

Die Herdentorswallmühle – auch Herdentorsmühle oder Ansgaritorsmühle, zumeist aber Mühle am Wall genannt – ist eine Windmühle in den Wallanlagen der Stadt Bremen.
Die Herdentorswallmühle ist eine Windmühle vom Typ Galerieholländer mit
fünfgeschossigem, achteckigem Unterbau aus Klinkersteinen. Die vier
Jalousieflügel haben einen Durchmesser von 24 Metern und sind zur
Drehzahlregulierung mit Bremsklappen ausgestattet. Die
Windrichtungsnachführung erfolgt selbsttätig durch eine Windrose. Die
Mühle hat drei betriebsfähige Steinmahlgänge.
Das Herdentor liegt auf dem Fußweg vom Hauptbahnhof in das Stadtzentrum
und bietet daher vielen Besuchern zugleich den überraschenden Anblick
einer großen, intakten Windmühle im Grünzug der Wallanlagen direkt in
der City. Die Mühle zählt zu den häufig fotografierten
Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Loriot-Figur - Knollennasenmann von Loriot:
Die 200 Kilogramm schwere Figur ist bekannt aus diversen
Veröffentlichungen Vicco von Bülows. Sie sitzt dort auf einer Parkbank,
den Kopf in die Hände gestützt und klassisch mit einer feingestreiften
Hose, die Beine übereinandergeschlagen.

Die Bremer Wallanlagen waren
Teil der Bremer Stadtbefestigung und gingen aus den bis zum 17.
Jahrhundert erbauten Befestigungsanlagen hervor und sind heute eine
beliebte Parkanlage am Rande der Bremer Altstadt. Sie sind nicht nur
Bremens älteste, sondern auch die erste öffentliche Parkanlage in
Deutschland, die durch eine bürgerliche Volksvertretung realisiert
wurde.
Die Wallanlagen umschließen noch heute fast die ganze Altstadt. Sie
erstrecken sich von der Weser am Osterdeich im Osten bis zum
Doventorswall im Stephani-Viertel, wo sie von der Oldenburger Straße
(Bundesstraße 6) unterbrochen werden und weiter bis zum Focke-Garten.

Der Schütting ist das Gebäude
der Bremer Kaufmannschaft, ehemals Gilde- und Kosthaus der Kaufleute
und seit 1849 der Sitz der Handelskammer Bremen. Es steht an der
Südseite des Bremer Marktplatzes, direkt gegenüber dem Rathaus. Rechts
der Bremer Roland.

Unser Lieben Frauen
Älteste Pfarrkirche Bremens, errichtet unter Erzbischof Unwan
(1012-1029). Mitte des 12. Jahrhunderts Umbau zu einer Basilika. Ab
1230 unter Erzbischof Gerhard II. (1219-1258) Erweiterung zu einer
frühgotischen Hallenkirche mit drei Schiffen und zweitem Turm im
Norden. Bis etwa 1400 war der Unser Lieben Frauen Kirchhof das Zentrum
des städtischen Lebens, die Kirche diente als Ratskirche. Ihr Keller
zählt zu den ältesten Bauwerken in Bremen. Im Innenraum wurde während
der Sanierung 1958-66 das Mauerwerk freigelegt. Die Fenster aus den
Jahren 1966-1973 stammen von dem französischen Künstler Alfred
Manessier.

Die Kanzel am Anfang des Chores
wurde 1709 von Simon Post gestiftet (Bildschnitzer vermutlich Rode).
Die vier Evangelisten sind an ihren Symbolen deutlich zu erkennen:
Matthäus (Engel/Mensch) - Markus (Löwe) - Lukas (Stier) - Johannes
(Adler); auch Moses mit seinen Gesetzestafeln ist leicht zu entdecken.
Etwas schwieriger wird es allerdings, die sechs christlichen Tugenden
zu finden, die der Schnitzer sinnbildlich durch Figuren und Gegenstände
darstellte: Glaube (Dreieck, Kelch) - Liebe (Mutter mit Kindern) -
Hoffnung (Anker) - Gerechtigkeit (verbundene Augen und Schwert) - Demut
(Frau mit demütiger Gebärde). Die sechste weibliche Figur ist nicht
eindeutig einer Tugend zuzuordnen. Ist es vielleicht die "Sanftmut",
die eines Tages die Welt (Weltkugel!) regieren wird (Mt 5,5)?
Alle Fenster im Kirchenraum
wurden von dem französischen Künstler Alfred Manessier in den Jahren
von 1964 - 1979 geschaffen, allerdings sind nur die vier Hauptfenster
thematisch gebunden: Das große Chorfenster (Pfingstfenster) befasst
sich mit dem Pfingstwunder: die Ausgießung des Geistes Gottes. (Apg
2,1-4)
Im linken Seitenschiff (Nordschiff) befindet sich das Weihnachtsfenster, das die Menschwerdung Gottes zum Thema hat. (Joh. 1,14)
Im rechten Seitenschiff (Südschiff) finden Sie das Predigtfenster, in
dem Manessier sich mit dem Auftrag vom Apostel Paulus auseinandersetzt:
"So sind wir nun Botschafter an Christi statt.(...) Lasst euch
versöhnen mit Gott." (2. Kor 5,20)
Das Marienfenster über der Empore im Westen bezieht sich auf die Worte
von Maria aus der Weihnachtsgeschichte: "... und Maria hörte alle diese
Worte und bewahrte und bewegte sie in ihrem Herzen." (Luk. 2,19)

DIE BRUDERSCHAFT "TO ALLEN CHRISTEN SEELEN"
Im Jahre 1468 wird die Bruderschaft "To allen Christen Seelen"
gegründet, die den Beinkeller als Bruderschaftskapelle nutzt und dort
regelmäßig ihre Totenfeiern und Seelenmessen für verstorbene Brüder und
Schwestern abhält; denn eine "Hauptaufgabe von Bruderschaften war die
Sorge um das Totengebet und das Gedenken ihrer Mitglieder".
Doch warum drängen im Mittelalter so viele Menschen aus allen
Bevölkerungsschichten in die so zahlreichen Bruderschaften? Die
christliche Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott wurde damals
zunehmend durchkreuzt durch das - von der Kirche forcierte -
Sündenbewusstsein. Die Angst vor der ewigen Verdammnis (dem
"Höllenrachen"), die Sorge um eine Abkürzung der in jedem Fall zu
erleidenden Fegefeuerqualen zur Läuterung der Seelen spielen im
Lebensgefühl jener Generation eine uns kaum mehr verständliche Rolle.
Die Kirche schrieb Gebete und Seelenmessen, Wallfahrten überhaupt
"verdienstliche gute Werke" wie Armenpflege, Stiftungen, Ablässe u. a.
vor. Auch die Tätigkeit vieler Bruderschaften ist aus der Sorge um das
ewige Seelenheil zu verstehen. Ihre Mitglieder wussten: Wenn ihre
Seelen im Fegefeuer leiden, dann kommen ihnen die Gebete der irdischen
Brüder und Schwestern wirksam zu Hilfe.
Luther und die Reformation haben die Sorge "um den gnädigen Gott", die
Angst des Menschen um seine gute Zukunft jenseits des Todes (wieder)
ganz an Christus und seine Gnade gewiesen. Die Lehre und dann auch die
Praxis der "verdienstlichen guten Werke" verlieren ihre Grundlage, die
Arbeit der Bruderschaften ihren religiösen Sinn. Grundlage christlicher
Liebestätigkeit wird im evangelischen Bereich das Evangelium selber
anstelle irgendeines Verdienstgedankens. Die Bruderschaften lösen sich
zögernd auf: Das Vermögen der Bruderschaft "To allen Christen Seele"
wird erst 1559 von Bürgermeister Daniel von Büren und einem anwesenden
Bauherren der Diakonie (Gotteskiste) übergeben, die allerdings bereits
seit 1525 die Fürsorge für die Hausarmen übernommen hat. Von diesem
Jahr an - also fast schon 500 Jahre - hilft die Liebfrauen-Diakonie in
Not geratenen Menschen über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg
durch Rat und natürlich auch durch materielle Unterstützung. Die
Glaubensgrundlage ihrer "Liebestätigkeit" ist das Evangelium: "Was ihr
an einem meiner geringsten Brüder versäumt habt, das habt ihr an mir
versäumt." (Matthäus 25,45)

Die heutige Liebfrauenkirche wurde 1229 als Hallenkirche im
Übergangsstil von der Romanik zur Gotik gebaut. Die Joche zwischen den
Säulen haben fast einen quadratischen Grundriss. Die drei gleich hohen
Schiffe werden von unterschiedlich gestalteten Kreuzrippengewölben
abgeschlossen: Einige haben Ringwulste und in den leicht überhöhten
Scheiteln Hängezapfen.
Die Gottesdienstbesucher fanden in der damaligen Zeit für ihre
Bequemlichkeit noch keine Sitzgelegenheit; nur für den Bürgermeister
und die Ratsherren waren Bänke vorgesehen. An den verpützten Wänden
konnten sie wahrscheinlich bildliche Darstellungen aus der biblischen
Geschichte entdecken, denn die Kirche nutzte zu der Zeit jede
Möglichkeit, den Menschen, die damals zumeist nicht lesen und schreiben
konnten, Gottes Wort in Bildern zu verkündigen. Einige Reste dieser
Malereien finden Sie im Gewölbe des Nordschiffes: ein Löwe, ein
gekröntes Haupt, Rankenwerk mit Eicheln und Blättern u. a. Bis auf
diese Reste wurde der übrige Putz — aus akustischen Gründen — im Rahmen
der Restaurierung des gesamten Kirchenraumes (1955 - 1965) unter
Leitung von Professor Oesterlen entfernt, so dass nun aus dem
Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Farben und Formen der
natürlichen Materialien ein Raum von einer großen Ruhe und
Geschlossenheit entstand.

Am Nordturm führt eine Treppe in den Keller der ehemaligen
St.-Veit-Kapelle. Er gehörte zu einer "Karnerkapelle", die zwischen
1100 und 1160 an die seit 1020 existierende hölzerne St.-Veit-Kirche
gebaut wurde. Dieser Raum war in seiner wechselvollen Geschichte
nacheinander: Beinkeller, Bruderschaftskapelle, Abstellraum,
Heizungskeller und Schutzraum für die Brandwache während des Krieges.
Nach der Restaurierung (1985-1993) nutzte die Gemeinde diesen Raum für
Andachten und Gottesdienste.
DER BEINKELLER ALS GRABKAMMER
Im Jahre 1725 lässt der königlich-dänische Geheime Rat und Ritter des
Danebrog-Ordens Fr. Emanuel von Kötzschau eine Grabkammer für seine am
9. März des gleichen Jahre verstorbene Gattin in dem Beinkeller
errichten. Im Kaufvertrag heißt es, dass die Liebfrauengemeinde "im
'Keller' der Kirche für 100 Rthl. einen Raum zur Anlage einer Gruft an
den kgl. dän. Geheimen Rat und Ritter Fr. Eman. von Kötzschau..."
verkauft habe. Doch mit dem Kauf sind die Schwierigkeiten noch nicht
beseitigt, denn die Tür des Kellers ist vermauert. So muss Herr von
Kötzschau noch weitere 20 Reichsthaler zur "Eröffnung des Gewölbes" auf
den Tisch legen, bevor er den Raum für seine Grabkammer überhaupt
betreten kann. Leider geht aus der Akte nicht hervor, welche
Beziehungen der Herr von Kötzschau überhaupt zur Stadt Bremen hat und
warum er und seine Frau ausgerechnet in Bremen begraben werden wollen.
Aber nach dieser etwas mühsamen "Eröffnung des Gewölbes" entdecken in
den folgenden Jahren offenbar auch andere Familien den Beinkeller als
Grabkammer, denn ein alter Grundrissplan aus dem Jahre 1765 zeigt (s.
Skizze nach diesem Plan), dass ihre Zahl schließlich bis auf elf
angewachsen ist und fast zwei Drittel des gesamten Raumes beansprucht.
Das sehr aufwendig gearbeitete, spätbarocke Grabportal ist uns erhalten
und "sicher die Arbeit einer der bekannten bremischen
Bildhauer-Werkstätten des A. Ger-cken oder T. W. Freese...".

Die vier weitgespannten romanischen Gewölbe, die von einem schmalen
Mittelpfeiler getragen werden, setzen sich überwiegend aus Feld- und
Bruchsteinen zusammen. Der neben dem Mittelpfeiler stehende mächtige
Rundpfeiler wirkt allerdings wie ein Fremdkörper in diesem Raum. Er
wurde auch erst beim Bau der jetzigen Kirche "eingefügt", um ein
tragfähiges Fundament für einen der Hauptpfeiler der Liebfrauenkirche
zu erhalten.
Die Decken- und Wandmalereien
sind vermutlich in der Zeit entstanden als die Bruderschaft "To allen
Christen Seelen" diesen Raum als Bruderschaftskapelle nutzt, also
zwischen 1468 (Gründung der Bruderschaft) und 1523/25
(Reformationsbeginn in Bremen). Die in "Fresco-Secco-Technik"
ausgeführten Malereien lagen bis zur Restaurierung unter mehreren
(8-12) Kalk- und Schmutzschichten verborgen, die mechanisch mit einem
Skalpell Schicht für Schicht entfernt wurden. Bis auf einige Stelle in
der Südwand-Malerei sind alle Farben original erhalten.
Auf der westlichen Südwand sind in einer Dreibogenstellung Szenen aus
der Bibel dargestellt. Im rechten Bild: Das Verhör von Jesus vor
Pilatus. Kaiphas klagt an. Der gefesselte Jesus scheint die Anklagen
kaum zu hören, denn er schaut gebannt auf Pilatus, von dem das Urteil
kommen wird. Pilatus zeigt mit dem Finger auf die hinter ihm stehenden
Ältesten, die offensichtlich - mit offenen Mündern - den angeklagten
Jesus beschuldigen.
Während sich dieses Bild noch leicht erschließt, fällt die Deutung des
mittleren Bildes doch wesentlich schwerer. Im Vordergrund versucht ein
mit einem Schwert bewaffneter junger Mann, sich von einer Faust, die
ihn am Hemd gepackt hält, loszureißen. Die linke, "zupackende" Figur
ist ohne Beine dargestellt. Im Hintergrund ist deutlich ein großer,
goldener Nimbus zu erkennen vielleicht ein Hinweis auf Christus. Dieses
Bild könnte zu einer Geschichte gehören, die Markus als einziger
Evangelist erzählt: Nach der Gefangennahme Jesu seien alle Jünger
geflohen, nur ein junger Mann sei ihm gefolgt. Als man auch ihn
verhaften wollte, habe er sich losgerissen, seinen Überwurf
zurückgelassen und sei nackt entflohen (nach Markus 14, 50-52). Der
Restaurator Dombrowski (Berlin) vermutet allerdings, dass dieses Bild
die Opferung Isaaks durch Abraham darstellt, als der Engel den noch
"zögernden Abraham" von seiner Tat abhalten will.
Das linke Bild, wäre es nicht durch einen Türdurchbruch weitgehend
zerstört worden, hätte vielleicht einen thematischen Zusammenhang
zwischen den drei Bildern herstellen können, so dass dann eine besser
abgesicherte Deutung des mittleren Bildes möglich gewesen wäre.
Eine weitere Malerei ist auf der Nordseite des viereckigen
Mittelpfeilers - allerdings nur undeutlich Zu erkennen: Ein Apostel-
oder Weihekreuz. Dieses Kreuz - von einem Kreis umschrieben - weist auf
die priesterliche Weihe dieses Raumes in vorreformatorischer Zeit hin.

Der Neptunbrunnen auf dem
Domshof in Bremen ist ein Kunstwerk des Bildhauers Waldemar Otto das im
Jahre 1991 aufgestellt wurde. Es handelt sich um einen der wenigen
modernen Neptunbrunnen. Die Grundfläche in Form einer Superellipse hat
eine Größe von zirka 4 × 6 Meter, eine Höhe von zirka 3,5 Meter und
besteht aus einem Sockel aus grünem Granit aus dem schweizerischen
Andeer sowie einer Figurengruppe aus Bronze.
Die Figurengruppe des Brunnens zeigt verschiedene Gestalten aus der
römischen beziehungsweise griechischen Mythologie. In der Mitte steht
dabei der Meeresgott Neptun (griechisch Poseidon), der auf seinem von
zwei Pferden gezogenen Wagen über die Wellen reitet und seinen Dreizack
empor reckt. Der Wagen selbst wird dabei durch einen Granitblock
angedeutet, der sich über die Fontänen (d. h. über die Wasserebene)
erhebt, lediglich Poseidon selbst und das Pferdegespann sind in Bronze
geformt, wobei wiederum von den beiden Pferden, die aus ihren Nüstern
hin und wieder Wasser versprühen, nur die Köpfe plastisch ausgearbeitet
sind. Seitlich des Wagens ist Triton zu erkennen, Sohn des Poseidon,
der mit Hilfe einer Muschel – die er wie eine Fanfare bläst – die
Wellen aufwühlen oder glätten kann.

Bremer Bank Haus - Altes Bankgebäude am Domshof
Von 1902 bis 1904 entstand im Stil der Neorenaissance nach Plänen der
Architekten Albert Dunkel und Diedrich Tölken das Bankgebäude auf dem
Domshof. Von 1980 bis 1990 war das Gebäude auch Sitz der Bremer Börse.
Das alte Bankgebäude auf der Ecke Domshof / Sandstraße steht seit 1994
unter Denkmalschutz und repräsentiert weiterhin die Tradition der
Bremer Bank.

Das Schnoorviertel
Von Schnoor = Schnur. Die Häuser scheinen wie an einer Schnur aufgereiht.
13. bis 14. Jh. Erste Bewohner dieses an einem Weserübergang
entstandenen Viertels waren Fischer, Schiffer, Handwerker und
Gewerbetreibende. Niederlassung des Bettelmönchordens der Franziskaner.
Bau eines Klosters und der St. Johannis Kirche.
15. bis 16. Jh. Entwicklung als Stadtteil mit eigenem Charakter, von See- und Kaufleuten bewohnt.
19. Jh. Durch Modernisierung starke Änderung der Bausubstanz.
1959 bis 1970 umfangreiche Restaurierung des im Zweiten Weltkrieg
weitgehend erhalten gebliebenen Viertels unter Bewahrung seiner
ursprünglichen Eigenständigkeit.

Sankt Jakobus Packhaus (Geschichtenhaus) im Schnoor, Wüstestätte 10 (Bremen)

Das Packhaustheater Bremen,
auch Packhaus Theater im Schnoor, in Bremen-Mitte im Stadtquartier
Schnoor, Hinter der Holzpforte 8/ Wüstestätte 11 ist ein kleines
Schauspieltheater. Der Neubau gehört zu den bedeutenden Bremer
Bauwerken.

Der Badestubenbrunnen mit der Skulptur Beim Bade,
auch Die fröhlichen Badenden genannt, steht in Bremen-Mitte im Schnoor,
am Stavendamm in der Nähe des Schifferhauses. Das fröhliche Bronze-Paar
auf einem Granitsockel von 1986 stammte vom Bildhauer Jürgen Cominotto.
Der Brunnen soll an die Zeit, als es im Schnoor noch Badehäuser gab,
erinnern. Im Mittelalter badeten die Menschen gern. Badezimmer gab es
noch nicht und deshalb besuchten sie die öffentlichen Badestuben. In
der Straße Stavendamm (Stave = Stube) soll ein Badehaus gestanden haben.

Altes Postamt 1, Domsheide 15, 28195 Bremen, Deutschland
Die Kaiserliche Oberpostdirektion Bremen
war als Mittelbehörde vom 1. Januar 1874 bis 1919 eine
Oberpostdirektion (OPD) der Reichspost. Daraus wurde 1919 dann eine OPD
des Reichspostministeriums und von 1934 bis 1945 eine
Reichspostdirektion (RPD) sowie von 1945 eine OPD der Zone und von 1950
bis zum 1. Januar 1995 eine OPD der Deutschen Bundespost, die aufgelöst
und zur Deutschen Post AG wurde. Gebäude und Portal entstanden um
1565–69.

Park Hotel am Hollersee im Bürgerpark
Das Parkhotel Bremen im
Bürgerpark ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Bremen. Nach der Anlage des
Bürgerparks Ende der 1860er Jahre wurde 1872/73 am Standort des
heutigen Hotels das erste einfache Ausflugslokal an dem später
Hollersee genannten Teich errichtet. Im Rahmen der Nordwestdeutschen
Gewerbe- und Industrieausstellung, die 1890 auf dem Gelände des
Bürgerparks stattfand, wurde es durch eine monumentale Festhalle
ersetzt. Der an derselben Stelle von 1912 bis 1913 nach Plänen von
Rudolf Jacobs errichtete Neubau gab sich als fürstliches Herrenhaus im
Stil des Neobarock. Nach der weitgehenden Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg bei den Luftangriffen auf Bremen entstand in den Jahren 1954
bis 1956 das heutige Hotel. Dabei wurde im Rahmen eines tiefgreifenden
Um- und Neubaus die Kuppel des erhalten gebliebenen Mittelbaus um 1,40
Meter angehoben sowie der gesamte Baukörper von 65 auf 100 Meter
deutlich verbreitert.

Der Bürgerpark und der
Stadtwald sind die bekannteste Parkanlage in Bremen. Der Bürgerpark
entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unweit des
Hauptbahnhofes als klassischer Volksgarten mit Seen, Kaffeehäusern und
Liegewiesen innerhalb der bewaldeten Flächen. In der Zeit nach 1900
wurde nördlich davon der rund 65 ha große Stadtwald angelegt.

Die Gestaltung des Bürgerparks geht auf Wilhelm Benque zurück, der
selbst von 1866-1870 und noch einmal von 1877-1884 Parkdirektor war.
Von ihm übernahm Carl Orth das Amt und nach seinen Plänen wurde 1907
mit der Anlage des Stadtwaldes begonnen. 66,5 Hektar groß war das
Gelände nördlich der Bahntrasse, das der Bremer Kaufmann Franz E.
Schütte dem Bürgerparkverein ein Jahr zuvor geschenkt hatte.
Laubengang aus Hainbuchen im Bürgerpark, angelegt 1886

Eine grüne Oase in Innenstadtnähe und viel genutztes Naherholungsgebiet
ist der Bürgerpark. Die ausgedehnte Anlage, die sich an die heutige
Bürgerweide hinter dem Bahnhof anschließt, ist kein irgendwann der
Öffentllichkeit zugänglich gemachter Privatpark ehemals Herrschender
wie vielerorts, sondern ein von den Bürgern selbst initiierter Park.
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte man bereits die alten Wehranlagen der
Stadt abgebaut und die Wallanlagen in eine Parklandschaft verwandelt.
Doch anlässlich der rasant wachsenden Stadt im Laufe des Jahrhunderts
wurde der Ruf nach mehr Grünräumen immer lauter.
Gegenschuss: Laubengang aus Hainbuchen im Bürgerpark, angelegt 1886

Universum Bremen - Wissenschaftszentrum für Erde und Kosmos mit Erlebnispark zum Thema Bewegung sowie Wechselausstellungen.

Das Universum Bremen ist ein
Science Center mit ausgeprägtem Erlebnischarakter. Die Besucher sollen
an über 300 Exponaten naturwissenschaftliche Phänomene hautnah und mit
allen Sinnen erleben. Das Hauptgebäude, in der sich die
Dauerausstellung befindet ist, mit 40.000 Edelstahlschindeln bedeckt
und wurde vom Bremer Architekten Thomas Klumpp entworfen. Die
Gebäudeform erinnert an eine Mischung aus Wal und Muschel.

Stephani Anleger an der Schlachte

Theater am Goetheplatz - Musicals, Opern, Schauspiel und Tanzproduktionen in einem prächtigen klassizistischen Gebäude von 1913.

Kunsthalle Bremen - Kunstmuseum mit Werken von Rubens, Rembrandt, Courbet und Picasso sowie Wechselausstellungen.

SCHNOOR - Das Schnoorviertel - Ältester Stadtteil in der Bremer City
Das Schnoorviertel ist der einzige noch erhaltene Teil der Altstadt von
Bremen und bildet zugleich das älteste Viertel Bremens. Es besteht aus
etwa 100 kleinen Häusern des 15.,16., 18. und 19. Jahrhunderts und
liegt an der Weser. Das Schnoorviertel wurde nach der längsten Straße,
die durch das Viertel führt, benannt. Der Name „Schnoor" kommt von
„Schnur", weil die Häuser wie an einer Schnur aufgereiht stehen.

Die Glocke - Das alte Konzerthaus mit großem Stufengiebel und 2 Sälen im Art-déco-Stil favorisiert die klassischen Künste.

Domshof am Dom

St. Petri Dom Bremen - Dom aus dem 11. Jh., umfangreich renoviert im
19. Jh, mit Aussicht auf die Stadt von den gotischen Türmen.

Bremer Rathaus - Gotisches Rathaus mit Wandelhalle aus Marmor, Güldenkammer im Jugendstil und Restaurant im Kellergewölbe.

Bremer Marktplatz - Malerischer Stadtplatz mit jährlichem Weihnachtsmarkt, der von berühmter Architektur umgeben ist.

Unserer lieben Frauen Kirchhof / Am Markt

Seine Zeichenhaftigkeit, seine formale Strenge und zurückhaltende
Stilisierung hat sicher dazu beigetragen, dass die unterlebensgroße
Bronzeplastik - 200 cm hohe Figurengruppe - neben dem Bremer Roland zum
heimlichen Wahrzeichen Bremens wurde und für Touristen zum
obligatorischen Besichtigungsprogramm gehört. Gern wird den Besuchern
dabei erzählt, wenn man die Vorderbeine des Esels anfasse, gehe ein
Wunsch in Erfüllung. Der Standort der Bronzeplastik von Marcks ist seit
dem Jahr 1953 fortdauernd am Bremer Rathaus.
Die Bremer Stadtmusikanten von Gerhard Marcks (1953) am Bremer Rathaus, im Hintergrund die Liebfrauenkirche

St. Petri Dom Bremen am Dom

Das Haus der Stadtsparkasse am Bremer Marktplatz ist ein rekonstruiertes Baudenkmal der Rokokozeit.

Bremer Marktplatz mit Bremer Rathaus / St. Petri Dom Bremen / Parlamentsgebäude Bremische Bürgerschaft

Schlachte an der Weser
Das MS "Gräfin Emma" ist seit Beginn des Jahres 2011 das neue
Schmuckstück der "Hal över/Schreiber"-Schiffsflotte in Bremen und kann
für Rundfahrten gebucht werden.

Als Schlachte wird in der Bremer Altstadt die historische Uferpromenade
an der Weser bezeichnet. Im amtlichen Sinne ist die Schlachte ein
parallel zum Ufer verlaufender Straßenzug, der an der Ecke Erste
Schlachtpforte (bei der St.-Martini-Kirche) beginnt und etwa 660 Meter
weiter nordwestlich bei der Jugendherberge Bremen (Haus der Jugend),
Ecke Kalkstraße endet. Die Schlachte, ursprünglich der Hafenplatz
Bremens, hat sich heute zur Gastronomie- und Biergartenmeile gewandelt.

Der Name Schlachte kommt von slagte, also vom Einschlagen der
Uferpfähle, die mit Balken und Faschinenflechtwerk gehalten wurden und
für die Uferbefestigung sorgten. Die Bezeichnung stammt aus dem
Niederdeutschen und ist in anderer Form – wie beispielsweise im
ursprünglicheren Schlagde – für ähnliche Uferbereiche im gesamten
norddeutschen Raum verbreitet. 1250 wurde dieser Bereich erstmals als
slait urkundlich erwähnt, später auch als slagte und als slacht
bezeichnet.

Der Bremer Hauptbahnhof ist als Durchgangsbahnhof in
Nordwest-Südost-Richtung angelegt und besitzt neun Bahnsteiggleise, von
denen sich sieben innerhalb der Bahnhofshalle befinden. Außerdem führen
zwei Durchfahrtsgleise für den Güterverkehr durch die Halle. Auf der
Südseite der Gleise steht das Empfangsgebäude. Es wurde mehrfach
umgebaut, ist aber im Prinzip erhalten geblieben. Die Bildhauerarbeiten
der Fassade stammen von Diedrich Samuel Kropp und Carl Dopmeyer. Die
Allegorien auf den Eckpfeilern sollen Industrie und Handel, in den
Mauerbögen Eisenbahnverkehr und Schifffahrt symbolisieren. Über dem
Hauptportal sind drei Reliefs zu sehen.

In der Empfangshalle über dem Tunneleingang ist ein Wandmosaik
eingearbeitet, das 1957 als Werbefläche für die Bremer Zigarettenfabrik
Martin Brinkmann AG angebracht wurde – eine Gegenleistung für die
Finanzierung weiterer Renovierungen. Gefertigt durch die Steingutfabrik
Grünstadt, war es seit den 1960er Jahren durch eine Werbung der
Klöckner Stahlwerke Bremen verdeckt und wurde bei den
Renovierungsarbeiten wieder freigelegt, so dass der Bahnhof mit
bildlicher Kunst aus verschiedenen Epochen glänzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: