web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Dortmund
in Westfalen, April 2025
Dortmund ist eine kreisfreie Großstadt in
Nordrhein-Westfalen. Mit 600.000 Einwohnern ist sie nach der
Einwohnerzahl die neuntgrößte Stadt Deutschlands, die größte Stadt des
Landesteils Westfalen sowie nach Fläche und Einwohnerzahl die größte
Stadt des Ruhrgebiets. Die Stadt ist Heimat des größten Fußballstadions
von Deutschland und von Borussia Dortmund - BVB 09.
* * *
St. Reinoldi, auch Reinoldikirche,
ist eine evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt. Sie ist
ihrem Gründungsdatum nach die älteste erhaltene Kirche im historischen
Stadtzentrum, eine frühgotische dreijochige Basilika mit
spätromanischem Querhaus, spätgotischem Chor und an romanische Formen
anschließendem barockem Westturm.

Der älteste heute noch erhaltene Teil ist das Querhaus, errichtet knapp
vor Mitte des 13. Jahrhunderts. St. Reinoldi war im Mittelalter als
Stadt- und Ratskirche das geistige Zentrum der Reichsstadt Dortmund und
bis zur Reformation auch Hauptpfarrkirche. Heute ist sie die
evangelische Stadtkirche. St. Reinoldi bildet den städtebaulichen sowie
geographischen Mittelpunkt der Innenstadt und ist ein Wahrzeichen
Dortmunds.

Auf der Südseite des Choreinganges wacht eine hölzerne Figur über die
Gemeinde. Die Skulptur Karls des Großen verdeutlicht die weltliche
Herrschaft. Karl der Große hält Reichsapfel und Zepter in den Händen.
Er ist mit einer Bügelkrone, Rüstung und kostbarem Umhang bekleidet.
Das Schnitzwerk stammt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.
2019 wurde eine neue Chororgel von Orgelbau Mühleisen über dem
südlichen Seiteneingang unterhalb der Fensterrosette eingebaut. Sie hat
11 Pfeifenreihen, die – mit Ausnahme des Prospektregisters (Violon 16’
/ Pfeifenreihe 1) – in einem Schwellkasten untergebracht sind. Sie
funktioniert nach dem Prinzip der Multiplexorgeln:

Das Retabel auf dem Hochaltar stammt aus dem Jahre 1420 und wurde in
Belgien vom sogenannten Meister von Hakendover gefertigt. Das heute
dauerhaft geöffnete Retabel zeigt Szenen aus dem Leben Jesu und Marias.
Im Mittelteil der Altartafel wird die Kreuzigung Christi thematisiert.

Das Adlerpult stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es
wurde aus Belgien, einem damaligen Zentrum für Bronzekunst, importiert.
Das Pult diente zum Verlesen des Evangeliums, worauf der Adler als
Symboltier des Evangelisten Johannes verweist. Der Greifvogel, der auch
das Wappentier der Stadt Dortmund ist, hat die Schlange besiegt und
hält sie zwischen seinen Krallen. Er umgreift dabei eine von einer
Säule gestützte Kugel. Adler und Säulenarchitektur ruhen auf den Rücken
von kleinen Löwenfiguren.

Die neue Hauptorgel von Orgelbau Mühleisen verfügt über 54 Register auf
vier Manualwerken (Haupt-, Ober-, Schwell- und Solowerk) und Pedal,
darunter 10 Auxiliarreihen, aus denen weitere 22 Register und
Transmissionen gewonnen werden. Sie wurde am 20. März 2022 in Dienst
genommen. Etliche Register der Walcker-Orgel von 1958 wurden in der
neuen Hauptorgel wiederverwendet. Das Instrument besitzt einen
eingebauten mechanischen viermanualigen Spielschrank und kann ebenfalls
vom mobilen Spieltisch der Chororgel aus angespielt werden. Bis auf
eine mechanische Koppel am mechanischen Spieltisch, sind die
Spielanlagen identisch.

Augustinus, Ambrosius, Hieronimus, Gregorius am Kirchenfenster hinter
der Hauptorgel

Baudenkmal 'Zum Ritter' - Traditionsreiches Gasthaus

Der Europabrunnen ist ein
Brunnen und Kunstwerk in der Kleppingstraße an der Ecke zum
Ostenhellweg im Zentrum der Dortmunder Innenstadt. Er befindet sich auf
dem Conrad-von-Soest-Platz, neben der Marienkirche.

Gestaltet wurde der Brunnen durch Joachim Schmettau, im Zuge der
Verkehrsberuhigung und Umgestaltung der Kleppingstraße im Jahr 1989.
Die Motive des Brunnens sind eine Anspielung auf die kulinarischen
Angebote der Umgebung. Ausgeführt wurde die Arbeit in Granit und
Bronze. Der Brunnen hat eine Größe von 0,5 m im kleinen, oberen Becken
und 4,5 m im großen, unteren Becken, die Breiten betragen 7 und 12 m.
Schmettau hat in seinem Kunstwerk das Gefälle der Straße und auch einen
ehemaligen Bachlauf, der sich an dieser Stelle befunden hatte,
berücksichtigt. Das Wasser des Brunnens entspringt im oberen
Wasserbecken, dem kleineren, welches von einer Kugel gekrönt ist,
schlängelt sich auf der nördlichen Seite um einen Frosch aus Bronze,
sprudelt über Stufen, die auch den ehemaligen Bauchlauf durch
unterschiedliche Ausarbeitung darstellen, um dann das untere, größere
Becken zu füllen. Auch auf der südlichen Seite ergießt sich das Wasser
vom oberen ins untere Becken und hier versucht eine Person aus Bronze,
den Brunnen zu erklimmen. In beiden Becken befinden sich kleine
Fontänen. Umgeben ist das untere Becken von einem breiten Rand, der zum
Sitzen einlädt.

Rechteckbrunnen in der Kleppingstraße

Der heutige Adlerturm ist ein
rekonstruierter Turm, der 1992 über den originalen Fundamenten des
einstigen Wehrturms errichtet wurde. Der 30 Meter hohe Turm wurde auf
Pfeiler gesetzt, um die erhaltene Bausubstanz der Fundamente des
ursprünglichen Adlerturms aus dem 14. Jahrhundert und der angrenzenden
Stadtmauer nicht zu beeinträchtigen.
Museum Adlerturm in den Resten der Stadtbefestigung Dortmund

Die Berswordt-Halle in Dortmund wurde 2002 neu errichtet und verbindet
die anliegenden Gebäude miteinander. Die Halle ist in einer offenen
Glas-Stahlkonstruktion erbaut und verbindet kontrastreich das Alte
Stadthaus mit dem Verwaltungsneubau aus den 1950er Jahren. In der
Glasfassade spiegelt sich die rote Sandsteinfassade des alten
Stadthauses.

Das Geflügelte Nashorn (auch
Dortmunder Nashorn) ist eine Nashornfigur mit Flügeln („Rhinoceros
alatus“). Es wurde während der Planungsphase (2000 bis 2002) des
Dortmunder Konzerthauses als Wappentier ausgewählt, wobei es zwei Ideen
zum Ausdruck bringen soll: Erstens: Obwohl das Nashorn ein recht
bodenständiges Tier ist, hat es doch ein sehr feines Gehör und ist
deshalb ein ideales Konzerthaus-Wappentier. Zweitens: Das geflügelte
Nashorn soll dem Pegasus gleich beflügeln und zu immer neuen
gedanklichen Höhenflügen anregen. So soll der Geist der Konzertbesucher
auf den Schwingen des Nashorns immer ungehinderten Zugang zur Kunst
haben. Die fertig gestalteten Nashörner wurden im Jahr 2006 an
markanten Punkten in der Dortmunder Innenstadt aufgestellt. Zum
Höhepunkt dieser Kunstaktion befanden sich über 120 lebensgroße
Nashornfiguren in der Stadt.
Freundschaftsgeschenk: Ein Geschenk von Dura/ Palästina an die Stadt
Dortmund als Zeichen der Freundschaft und des Friedens!

Das Alte Stadthaus der Stadt
Dortmund wurde 1899 nach Entwurf von Stadtbaurat Friedrich Kullrich im
Stil der Neurenaissance errichtet. Nach starker Beschädigung im Zweiten
Weltkrieg wurde es wieder aufgebaut, jedoch in leicht vereinfachter
Form. An der Spitze des Giebels befindet sich der Adler des Dortmunder
Stadtwappens. Die Fassaden bestehen aus rotem Sandstein und verputzten
Flächen an den seitlichen Teilen. An der Frontseite sind die Wappen der
acht Hansestädte Bremen, Hamburg, Köln, Lippstadt, Lübeck, Münster,
Osnabrück und Soest zu sehen.

Der Friedensplatz ist ein
zentraler Veranstaltungsplatz in Dortmund. Historisch wird er als Neuer
Markt bezeichnet. In der Mitte des Platzes ragt die von Bildhauerin
Susanne Wehland gestaltete Friedenssäule
in den Himmel. Auf dieser Säule wird in verschiedenen Sprachen der
Friede auf Erden angemahnt. Das Dortmunder
Rathaus ist der Sitz des Rates der Stadt und des
Oberbürgermeisters. Es wurde in den Jahren 1987–1989 im Stil der
Moderne erbaut.

Das Opernhaus des Theaters Dortmund am Platz der Alten Synagoge

GALERIA Dortmund

Platz von Hiroshima und die Propsteikirche Dortmund

Die Propsteikirche St. Johannes Baptist ist eine der vier
innerstädtischen Kirchen Dortmunds. Die Kirche liegt südlich des
Westenhellwegs und westlich des Hansaplatzes. Sie ist die einzige
römisch-katholische Kirche innerhalb des Dortmunder Wallrings.

Zu den herausragenden Kunstschätzen der Propsteikirche gehört ein
spätgotisches Hochaltar-Retabel des Weseler Malers Derick Baegert aus
den 1470er Jahren. Auf der linken Tafel findet sich im Hintergrund die
älteste Abbildung der Stadt Dortmund. Der insgesamt 7,80 Meter breite
und 2,30 Meter hohe Altar beeindruckt durch den Figurenreichtum und die
Fülle der im realistischen Stil dargestellten Szenen.

Marienleuchter: Leuchter aus Schmiedeeisen mit Doppelmadonna, Holz um
1523
Kreuzigungsgruppe an der Südwand. Links ist Maria, die Mutter Jesu,
rechts der Jünger Johannes

Madonna (Holz, mittelrheinisch, um 1470)
Maria mit Kind, heutiger Zustand (vermutlich Meister Tilman)


Die Orgel der Kirche, im Jahre 1988 durch den Orgelbauer Siegfried
Sauer erbaut, wird häufig für Konzerte genutzt. Die Orgel vertritt den
Typus der Universalorgel und verfügt über 53 Register, verteilt auf
drei Manuale und Pedal. Sie besitzt eine mechanische Spiel-Traktur und
mechanisch-elektrische Koppeln. Auf der Sauer-Orgel wurden bislang zwei
CD-Produktionen eingespielt. 2015 wurde die Orgel durch die Firma
Orgelbau Mühleisen (Leonberg) saniert; in diesem Zuge wurden drei Sub-
und eine Superoktavkoppeln hinzugefügt, und die Disposition geringfügig
überarbeitet.

Das letzte bedeutende Kunstwerk der Propsteikirche finden wir an der
Westwand im südlichen Seitenschiff. Es ist der Rosenkranzaltar. Die
Bildtafeln wurden im Jahre 1523 vom Kölner Maler Hilgardus für einen
Altar des ebenfalls aus Köln stammenden Bildhauers Arboch bemalt. Es
sind Szenen aus dem Marienleben und dem Leben des Dominikus
dargestellt. Für die Stadtgeschichte ist von Interesse, dass auf dem
Bild, das die Berufung des Dominikus darstellt, die älteste Abbildung
des alten Dortmunder Rathauses zu finden ist. Auf dem Bild des
predigenden Dominikus sind die Zuhörer alle mit Rosenkranz dargestellt,
was den Schluss nahelegt, dass der Altar einst von einer
Rosenkranzbruderschaft gestiftet wurde.

Sakramentskapelle mit Tabernakel und Taube

Der Hansaplatz ist ein
zentraler Platz in der Dortmunder Innenstadt. Der Platz liegt
südwestlich des Alten Marktes und wurde ab 1904 in mehreren Phasen
angelegt. Er ist heute Standort des Dortmunder Wochenmarktes. Neben
dieser Nutzung finden auf dem Platz auch häufig Großveranstaltungen und
politische Kundgebungen statt.

Der Bläserbrunnen wurde 1901
erstellt, als Tränke für die Pferde der Markthändler. Der Markt hatte
vor Ort eine alte Tradition, die auf das 12. Jahrhundert zurückreicht.
Der Name des Brunnen wurde von der Skulptur abgeleitet, die einen
"fahrenden Musikanten aus dem Mittelalter" darstellt, erschaffen von
dem Berliner Prof. Gerhard Janesch.

Turm der Evangelischen Stadtkirche St. Reinoldi und Ev. Stadtkirche St
Marien

Die heutige Orgel der
Marienkirche verfügt über 34 Register auf drei Manualen und Pedal. Sie
stammt aus dem Jahre 1967 und wurde von der Firma Gustav Steinmann
Orgelbau aus Vlotho gefertigt. Das Instrument steht wie die
mittelalterliche Orgel als Schwalbennestorgel auf einer Empore vor der
nördlichen Mittelschiffswand. Das Hauptgehäuse ist in abstrahierenden
Formen dem spätgotischen nachgebildet.

Die Marienkirche ist eine
evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt aus dem 12.
Jahrhundert. Sie liegt südlich der Reinoldikirche am Ostenhellweg. Die
Marienkirche beherbergt als Gerichts- und Ratskirche der ehemaligen
Freien Reichsstadt bedeutende mittelalterliche Kunstschätze, darunter
den Marienaltar von Conrad von Soest und den Berswordtaltar. Sie
vereinigt romanische und gotische Bauelemente.

Der Marienaltar des Conrad von
Soest ist ein Altarretabel in der Marienkirche in Dortmund aus der Zeit
um 1420. Er gilt als Meisterwerk der Spätgotik und ist ein gutes
Beispiel des höfischen Stils. Er ist der Hauptaltar der Dortmunder
Kirche. Das als Triptychon ausgeführte Retabel ist das späteste
bekannte Werk des Malers, welches er kurz vor seinem Tod vollendete.
Die beiden Außentafeln sind 1,40 Meter hoch, die mittlere Tafel
aufgrund der Aussägungen geringfügig niedriger. Alle Tafeln wiesen
neben der Verkleinerung kleinere Schäden von früheren Übermalungen und
Restaurierungen auf.


Sakramentshaus von 1894 im südlichen Chor links vom Altar

Taufstätte 1687 und Christusfigur um 1700

Die Kirche für Fans von Johannes Schreiter, dem bedeutensten
Kirchenfenstermaler der Gegenwart. Alle 30 Kirchenfenster sind von ihm
und um 1972 eingebaut. Gefertigt wurden die Fenster im Glasstudio Derix
in Taunusstein.

EMMA - das Maskottchen des BVB
Seit 2005 ist EMMA, die Biene, das stolze Maskottchen von Borussia
Dortmund. Mit ihrer gelb-schwarzen Erscheinung und ihrem unverkennbaren
Charme hat sie die Herzen der BVB-Fans im Sturm erobert. Benannt nach
der Vereinslegende Lothar Emmerich, trägt EMMA nicht nur einen
berühmten Namen, sondern auch eine große Verantwortung im Vereinsleben
des BVB.

Eckstatue mit Falke am Westenhellweg 2

Die Krügerpassage in der Dortmunder Innenstadt ist die älteste Passage
auf Dortmunder Stadtgebiet; sie wurde 1912 im Stil der Neorenaissance
von Paul Lutter und Hugo Steinbach erbaut. Jedoch fiel sie im Zweiten
Weltkrieg wie viele bedeutende Dortmunder Bauwerke dem Krieg zum Opfer
und wurde erst 1953 wieder aufgebaut. Wegen Bauarbeiten derzeit leider
versperrt.
Krügerpassage im Krügerhaus am Westenhellweg

Die evangelische St.-Petri-Kirche in Dortmund ist eine westfälische
Hallenkirche in hochgotischem Stil in der Dortmunder Innenstadt. Dem
Idealtypus dieser Kirchenform nahekommend sind Mittelschiff und
Seitenschiffe gleich hoch. Das Gebäude ist von fast quadratischem
Grundriss mit vergleichsweise kurzem Chor. Der Sakralbau ist ein
bedeutendes Beispiel für die besondere Formgebung der Hallenkirchen in
Westfalen.

Die Petrikirche ist, neben der
evangelischen Reinoldikirche und der evangelischen Marienkirche, ein
weiteres mittelalterliches Gotteshaus unmittelbar am Westenhellweg in
der Innenstadt Dortmunds. Der dreijochige Bau wurde 1322 begonnen und
ist in hellem Sandstein ausgeführt. In ihrer heutigen Gestalt zeigt die
Kirche wieder die ursprüngliche, mittelalterliche Form von
Quersatteldächern über den Seitenschiffen, die dem Betrachter eine
Reihe kleiner Spitzgiebel präsentiert.

Auffällig ist der überhoch wirkende Turmhelm, der nach einem Einsturz
1752 lange Zeit nicht mehr in dieser Form zu sehen war und erst nach
den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs am 17. November 1981 in seiner
historischen Höhe erneuert wurde. Er ist in diesen Maßen Produkt eines
alten Wettstreits um den höchsten Kirchturm in der Stadt zwischen
Reinoldikirche und Petrikirche im 15. und 16. Jahrhundert. Der Turmhelm
hat heute eine Gesamthöhe von etwa 60 Metern. Er besteht aus einer 15
Meter hohen Unterkonstruktion und einer 48 Meter hohen Turmspitze mit
Weltkugel und Kreuz. Die gesamte Höhe der Petrikirche beträgt nach
Wiederherstellung des Turmes 105 Meter.

Orgelbau Schulte wurde beauftragt, die 1868 von der englischen Firma
Radcliff & Sagar für die Kirche St. Mary, Woodkirk, bei Leeds
erbaute, und aufgrund der Kirchenschließung ausgelagerte romantische
Orgel für das Dortmunder Gotteshaus umzubauen. Da die gesamte Technik,
die Windanlage, die Windladen, das Gehäuse und der Spieltisch in der
Kürtener Werkstatt gefertigt wurden, gleicht das Instrument nun eher
einem Neubau, welcher am 6. September 2015 festlich eingeweiht wurde.
Der schlichte, 7,5 Meter hohe Kubus mit einem Querschnitt von 3 × 2
Metern beherbergt 1.049 Pfeifen und polarisiert. Die Hülle aus grau
lasierten Birkenholzbrettern lässt aber Einblicke in die Technik der
Orgel zu. Der freistehende, fahrbare Spieltisch ist über ein LAN-Kabel
mit der Orgel verbundenen. Die Steuerung übernimmt (nach dem
Organisten) ein Castellan-System der Firma Sinua.
Im Inneren von St. Petri befindet sich das Goldene Wunder von
Westfalen, ein prächtiger Schnitzaltar. Es handelt sich um einen
spätgotischen Flügelaltar (Antwerpener Retabel) von 1521. Geschlossen
zeigt der Altar die Anbetung der Eucharistie. Im ersten aufgeklappten
Zustand sind 36 detaillierte Bilder zu sehen. Die Festtagsseite, im
aufgeklappten Zustand, zeigt 30 Gefache mit vergoldeten Schnitzfiguren.

3 people sculpture vor der Sparkasse Dortmund

Im schauraum: comic + cartoon dreht sich alles um die „Neunte Kunst“:
Comics und Cartoons in Originalen vermitteln grafisches Erzählen
in Wort und Bild.

Deutsches Fußballmuseum

Das Deutsche Fußballmuseum ist die Erlebniswelt des deutschen Fußballs,
mitten in der Fußballhauptstadt Dortmund, direkt gegenüber dem
Dortmunder Hauptbahnhof.
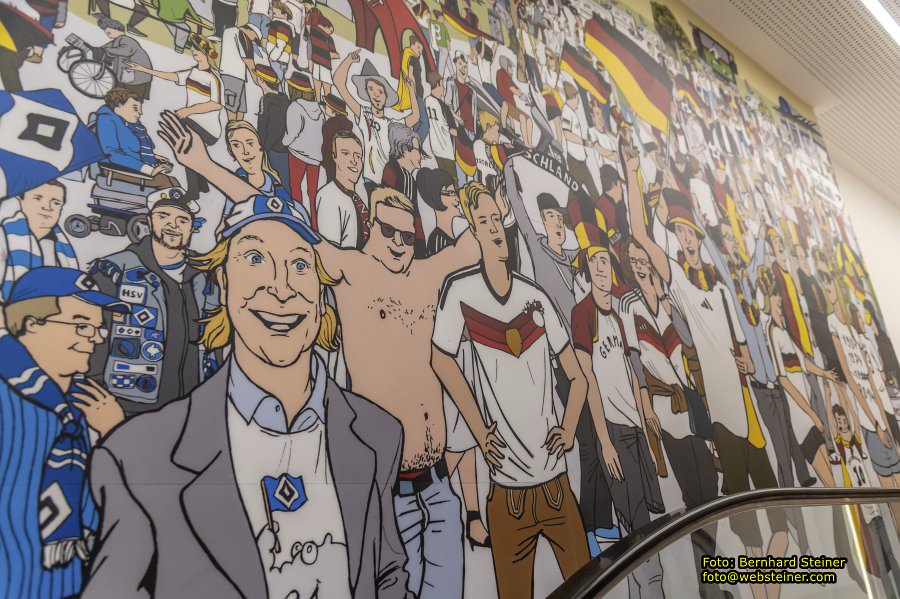
Endspielball der WM 1954






Spielball Achtelfinale EM 2024
Im Dortmunder Unwetter besiegt Deutschland Dänemark mit 2:0.
2024, Original, Deutscher Fußball-Bund

FIFA WM-Siegertrophäe 1990
Andreas Brehme trifft zum 1:0 Sieg gegen Argentinien. Kapitän Lothar
Matthäus erhält den WM-Pokal aus den Händen von FIFA-Präsident Joao
Havelange. Deutschland gewinnt zum dritten Mal die Weltmeisterschaft.
1990 Original | Nach Silvio Gazzaniga | Deutscher Fußball-Bund

FIFA WM-Siegertrophäe 2014
Deutschland gewinnt als erstes europäisches Team auf dem
südamerikanischen Kontinent den WM-Titel. Nach Mario Götzes
1:0-Siegtreffer gegen Argentinien feiert die Mannschaft um Philipp Lahm
die Pokalübergabe.
2014 Original | Nach Silvio Gazzaniga | Deutscher Fußball-Bund

Coupe Jules Rimet 1954
Deutschland besiegt Ungarn und wird erstmals Weltmeister. Der Elf von
Sepp Herberger gelingt das „Wunder von Bern". Helmut Rahn schießt das
entscheidende und legendäre 3:2. Die ganze Nation bejubelt das Team um
Kapitän Fritz Walter.
1954 Replik | Nach Abel Lafleur | Deutscher Fußball-Bund


Die Viktoria
Die Bronzefigur, ein Entwurf von Daniel Christian Rauch, dient von 1903
bis 1944 als Meistertrophäe des DFB. Nach Kriegsende lange Zeit in der
DDR unter Verschluss, kehrt das Abbild der Siegesgöttin 1992 zum DFB
zurück.
1900 Original | Deutscher Fußball-Bund
Die Viktoria ist ein Entwurf von Christian Daniel Rauch und nach der
römischen Siegesgöttin benannt. Anlässlich der Olympischen Spiele 1900
dem DFB gestiftet, ist sie auch als Wanderpreis für Rugby-Teams
gedacht. Ab 1903 erhält sie jedoch der Deutsche Fußballmeister. 1948
kommt die Viktoria in Ost-Berlin unter Verschluss, statt ihrer wird im
Westen die Meisterschale vergeben. Nach der Deutschen Einheit erhält
sie der DFB 1992 zurück.

Der DFB-Pokal
1964 entwirft und fertigt der Goldschmied Wilhelm Nagel im Auftrag des
DFB die neue Trophäe für den Pokalwettbewerb. Der vergoldete Pokal aus
Sterlingsilber wiegt 5,7 Kilogramm, fasst acht Liter und ist mit 42
Schmucksteinen verziert.
1964 Deutscher Fußball-Bund



Operation Spieltag
Rund 2.500 Menschen sind bei Heimspielen des BVB im Einsatz, um den
Zuschauern den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Das Spektrum
umfasst dabei ganz verschiedene Tätigkeiten: Balljunge,
Stadionsprecher, Feuerwehrmann oder Fotograf.
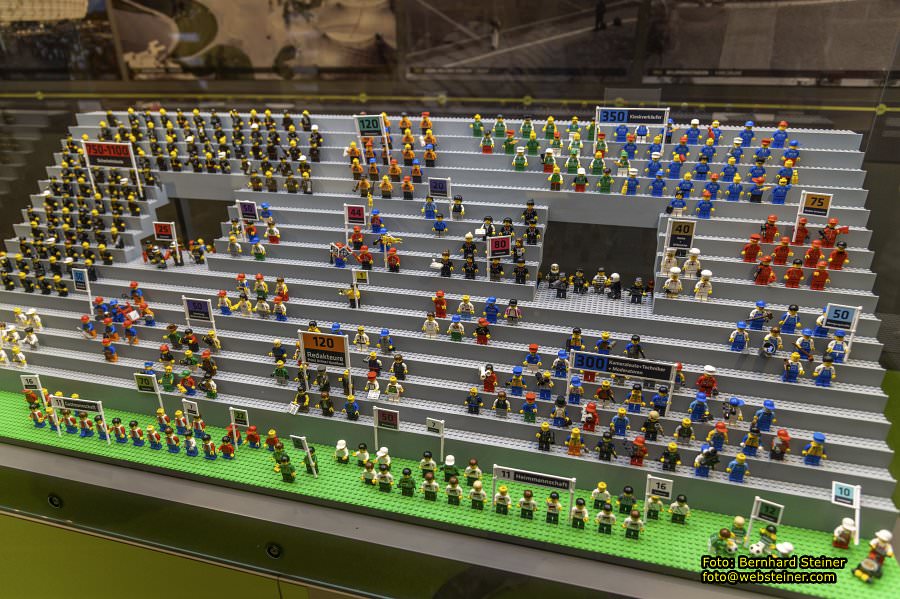

Sonderausstellung Günter Netzer und das goldene Fußballzeitalter der
Siebzigerjahre

Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität
Lebhaftes, von einem riesigen "U" gekröntes Kulturzentrum in einer
ehemaligen Brauerei mit Kunst und Events.

Aussicht nach Osten auf die Innenstadt vom U.

Das Dortmunder U, auch U-Turm genannt, ist ein 1926/1927 als „Gär- und
Lagerkeller“ der Dortmunder Union Brauerei errichtetes Hochhaus am
westlichen Rand der Dortmunder City. Der Name ist abgeleitet von dem
1968 auf dem Hauptturm aufgebrachten und 2008 komplett restaurierten
Firmenzeichen der Brauerei: ein vierseitiges, neun Meter hohes,
vergoldetes und beleuchtetes „U“ nach einem Entwurf des Architekten
Ernst Neufert.

Das Museum Ostwall (MO) ist das Museum der Stadt Dortmund für die Kunst
des 20. und 21. Jahrhunderts. Es wurde 1947 am namensgebenden Ostwall
als „Museum am Ostwall“ auf einem kriegszerstörten Museumsstandort
gegründet und behielt den „Kernnamen“ bei, als die Kunstsammlung im
Kulturhauptstadtjahr Ruhr.2010 vom östlichen an den westlichen Teil des
innerstädtischen Wallrings in das neu eröffnete Dortmunder U umzog.
Durch Schenkungen, Ankäufe und Ausstellungen konnte das „Museum Ostwall
im Dortmunder U“ insbesondere seine Bedeutung als Ort der Fluxus-Kunst
stärken.


Unser Dorf, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier
Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive
Malerei, 1964
Hochzeit, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier
Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive
Malerei, 1964
Im Park, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier
Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive
Malerei, 1964
Klosterkirche, um 1963/64 Maria Korsak (1908-2002) Gouache auf Papier
Stiftung der Galerie Pauli, Lausanne, anlässlich der Ausstellung Naive
Malerei, 1964
Über Maria Korsak ist nur wenig bekannt. Von der Weberei kommend, fing
sie im Alter von 50 Jahren an zu malen. Zunächst fertigte sie
Reproduktionen von Gemälden an, entwickelte aber schon bald ihren
eigenen Stil, der auf eine hohe Nachfrage stieß. Thema ihrer Arbeiten
sind ihre Erinnerungen an Städte, die im Zweiten Weltkrieg zerstört
wurden. Im Museum am Ostwall wurden ihre Werke 1963/64 gemeinsam mit
Arbeiten von Friederike Voigt gezeigt - zeitgleich zur Ausstellung
Sonntagsmaler aus Jugoslawien.


St. Jacques le grand, Lecbá, Roca Kouagal, Couzin Zakamédé, Baron
Samedi, Couzin Zakamédé, Simbi Congo, Simbi Rouangel, Le Général Simbi
en deux eaux, o. J. (vor 1972)
André Pierre (1915-2005) Getrocknete halbe Kürbisse, mit Farbe und Lack
bemalt
Geschenk der Sammlung Bachmann
Christi Geburt, um 1963
Seymour Etienne Bottex (1922-2016)
Öl auf Hartfaser
Geschenk der Sammlung Bachmann
Zeremonie in einem Wodu-Tempel, 1963
Gérard Valcin (1925-1988) Öl auf Hartfaserplatte
Geschenk der Sammlung Bachmann
Besuch, um 1963
Micius Stéphane (1912-1996)
Öl auf Hartfaser
Geschenk der Sammlung Bachmann
Das Landhaus, 1963
Micius Stéphane (1912-1996) Öl auf Hartfaser
Geschenk der Sammlung Bachmann
Die Kürbisse von André Pierre sind eng mit dem Voodoo-Kult Haitis
verbunden: Sie spielen als Schalen für Opfergaben eine wichtige Rolle;
hier sind sie mit Bildern von Loa, mächtigen Geistern des Voodoo
bemalt. Baron Samedi, der meist mit Zylinder und Stock dargestellt
wird, ist zum Beispiel einer der Herrscher über das Reich der Toten. In
den Malereien spiegelt sich auch die Kolonialgeschichte Haitis: Vom
Ende des 15. Jahrhunderts bis zu der 1804 von Schwarzen Versklavten
erkämpften Unabhängigkeit war Haiti erst eine spanische, später eine
französische Kolonie. Die europäischen Kolonialherren versuchten, das
Christentum unter der haitianischen Bevölkerung zu verbreiten; die aus
afrikanischen Ländern verschleppten und versklavten Arbeiter*innen
hatten hingegen ihren Voodoo-Glauben mitgebracht. Das Praktizieren von
Voodoo wurde immer wieder verboten, weshalb Bildnisse von Loa manchmal
der Darstellung von christlichen Heiligen gleichen. Die Darstellung
Lecbás ähnelt mit seinem Stab zum Beispiel dem Heiligen Petrus. Voodoo
gilt als wichtige Widerstandspraxis im Kampf für die Unabhängigkeit
Haitis und die Been-digung der Sklaverei.
Auch die beiden Gemälde von Seymour Etienne Bottex und Gérard Valcin
spiegeln die Einflüsse Afrikas und Europas auf die Geschichte Haitis
und zeigen zum einen eine Voodoo-Zeremonie, zum anderen eine
Darstellung der Geburt Christi. Micius Stéphane widmet sich hingegen
dem Alltag und zeigt das soziale Miteinander von Menschen in ihren
Häusern.
Pierre, der Farmer und Voodoo-Priester war, Bottex, der sein Geld
zunächst als Fotograf verdiente, Valcin, der als Fliesenleger
arbeitete, und Stéphane, der Schus-ter war, zählen zu den bekanntesten
haitianischen Künstler*innen, die um 1950 dem Centre d'Art in
Port-au-Prince beitraten, das 1944 von dem US-amerikani-schen Maler
DeWitt Peters und haitianischen Intellektuellen gegründet worden war.
Ursprünglich sollte Peters im Auftrag des amerikanischen
Erziehungsdepartments Sprachunterricht geben. Die USA versuchten in
dieser Zeit nach einer gescheiterten Militärinvasion - massiv Einfluss
auf Haiti zu nehmen, um kommunistischen Tendenzen in Mittel- und
Lateinamerika entgegenzuwirken. Die hier ausgestellten Werke kamen als
Geschenk Kurt Bachmanns in die Sammlung des MO. Auch Bachmann kam als
Angestellter der amerikanischen Wohlfahrtsorganisation CARE nach Haiti
und begann dort Kunst zu sammeln.

Das Stadion Rote Erde, früher
Kampfbahn Rote Erde genannt, wurde 1926 in Dortmund in unmittelbarer
Nähe zu den Westfalenhallen an der Strobelallee errichtet. Seit dem Bau
des Westfalenstadions grenzt es unmittelbar an dessen Osttribüne. Der
Bau des Stadions zwischen 1924 und 1926 wurde vorwiegend von
Arbeitslosen im Rahmen von Notstandsarbeiten durchgeführt. Der Begriff
Rote Erde ist eine historische Bezeichnung für Westfalen.

Am 15 April 2025 fand das Viertelfinale Rückspiel der Champions League
in Dortmund statt. Borussia Dortmund besiegte den FC Barcelona
mit 3:1, schied aufgrund des Hinspiels von 0:4 mit dröhnendem Applaus
aus.

Die Mannschaftsbusse fahren unter sehr hoher Publikumsbeteiligung am
Stadion ein.

Katharinenstraße zum Dortmunder Hauptbahnhof am Königswall

Ev. Stadtkirche Sankt Petri Dortmund - Bis 1981 wieder aufgebaute,
gotische Hallenkirche aus dem 14. Jahrhundert mit mittelalterlichem
Taufstein.

Der Hansaplatz ist ein
zentraler Platz in der Dortmunder Innenstadt. Der Platz liegt
südwestlich des Alten Marktes und wurde ab 1904 in mehreren Phasen
angelegt. Er ist heute Standort des Dortmunder Wochenmarktes. Neben
dieser Nutzung finden auf dem Platz auch häufig Großveranstaltungen und
politische Kundgebungen statt.

Der Hansaplatz ist mehr als
nur
ein Platz – er ist ein Ort der Begegnung, an dem sich Fans aus aller
Welt treffen, um ihre Leidenschaft für Borussia Dortmund zu teilen.
Hier spürt man die Aufregung und die Vorfreude auf das Spiel, während
man sich inmitten der schwarzweißen Atmosphäre befindet.

Der Alte Markt in Dortmund ist das historische Zentrum und einer der
ältesten Plätze der Stadt. Angelegt wurde er wahrscheinlich bereits im
9. Jahrhundert. Der Alte Markt liegt südlich der Einkaufsstraße
Westenhellweg. Bis zu seinem Abriss 1955 stand hier das Alte Dortmunder
Rathaus, der älteste Profanbau nördlich der Alpen. Im Nordosten des
Platzes befindet sich der 1901 erbaute Bläserbrunnen.

Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi und Ev. Stadtkirche St Marien

Kleppingstraße, Dortmund, Deutschland

Europabrunnen und barocker Turm der Evangelischen Stadtkirche St.
Reinoldi

Ostenhellweg, Dortmund, Deutschland

Die Zeche Zollern ist ein
stillgelegtes Steinkohlebergwerk im Nordwesten der Stadt Dortmund, in
den Stadtteilen Kirchlinde und Bövinghausen. Es besteht aus zwei
Schachtanlagen, die unter Tage zusammenhingen: Die Schachtanlage 1/3
(das heißt: mit den beiden Schächten 1 und 3) in Kirchlinde und die
Schachtanlage 2/4 in Bövinghausen.
Blick über die Mittelachse des Geländes auf das Verwaltungsgebäude

Die Zeche Zollern 2/4 ist heute einer von acht Museumsstandorten des
dezentralen LWL-Industriemuseums, das zugleich hier seinen Sitz hat.
Die Zechenanlage ist ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur im
Ruhrgebiet und der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH).

DIE MUSTERZECHE ZOLLERN II/IV ZOLLERN II/IV-A MODEL MINE
Für die GBAG war Zollern II/IV ein Prestigeprojekt: Innovative Technik,
imposante Architektur und ansprechende Arbeitsräume sollten vorbildlich
wirken und den Führungsanspruch des Konzerns optisch unterstreichen.
Die beiden Schächte II und IV bilden die zentralen Bezugspunkte für die
Anordnung der Betriebsbauten. Fast alle Gebäude orientieren sich an
drei parallelen Längsachsen. Ergänzende Querachsen stellen Sichtbezüge
zwischen einzelnen Giebeln sowie zwischen den beiden Fördergerüsten
her. Diese symmetrische Ausrichtung sorgt für ein Erscheinungsbild von
großer Harmonie.
Die Zeche gliedert sich in drei Bereiche. Im Westen gruppieren sich die
Gebäude der Zechen-Infrastruktur um einen „Ehrenhof": die beiden
Torhäuser, Werkstattgebäude, Pferdestall, Verwaltung und
Lohnhallenkomplex mit Magazin, Waschkaue und Lampenstube. In der Mitte
schließt der zentrale Produktionsbereich an. Hier flankieren die beiden
Fördergerüste mit Schachthallen und Separation die zentral gelegene
Maschinenhalle. Das mittlere Ensemble wird im Süden durch die
Kohlenwäsche ergänzt, im Osten durch das Kesselhaus. Als dritter
Bereich folgen im Südosten und Osten die Kokerei mit Ammoniakfabrik und
Benzolfabrik zur Nebenproduktgewinnung.

Zollern II/IV gehörte nie zu den großen Zechen im Ruhrrevier. Als
„Musterzeche" lag ihre Bedeutung weniger in hohen Förderzahlen als in
ihrer vorbildlichen Gestaltung und ihrer modernen betrieblichen
Sozialpolitik. Hierbei endete der Gestaltungswille der GBAG nicht an
den Zechentoren: Für die Zollern-Belegschaft errichtete die GBAG zwei
Werkswohnsiedlungen. Sie engagierte sich karitativ und förderte das
kulturelle Leben in Bövinghausen.
Aus einer nationalkonservativen Grundhaltung heraus bedauerte die
Direktorenkonferenz die Notwendigkeit, Bergleute polnischer
Nationalität anwerben zu müssen. Bereits 1898 hatte Kirdorf seine
Kollegen dazu vergattert, „in unseren Belegschaften keine notorischen
Agitatoren zu dulden". Zu diesen zählten „nicht nur Sozialdemokraten,
sondern auch ultramontan-demokratische sowie nationalpolnische
Agitatoren."
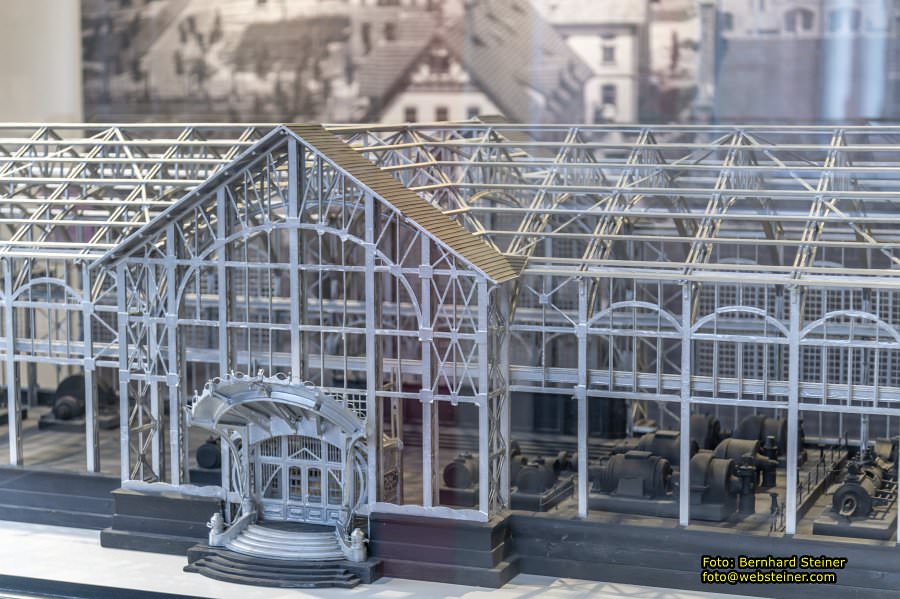
Demonstrationsschilder der Zeche Hansa 1967
Plakate aus schlichter Pappe und einfachen Holzgestellen wurden vom
Betriebsrat der Zeche Hansa im Oktober 1967 selbst gefertigt. Bewusst
hielt man sie in kräftigem Rot, weil man die Angst vor „linker
Agitation" schüren wollte. Slg. LWL-Industriemuseum

Der Förderbeginn der Zeche Zollern II/IV 1902 fiel in eine Zeit
wachsender sozialer Konflikte. Im Ruhrgebiet kam es 1905 zum großen
Bergarbeiterstreik. Unversöhnlich prallten Machtinteressen der
Unternehmer und Forderungen der Bergarbeiter aufeinander. Der mit hoher
Aggressivität geführte Arbeitsausstand warf ein Schlaglicht auf die
scharfen sozialen Gegensätze zwischen Betriebsleitungen auf der einen
und Bergleuten auf der anderen Seite. Auch wenn sich die konkreten
Arbeitsbedingungen besserten, die Spannungen zwischen den Milieus
blieben.
Auch die Außenpolitik war von internationalen Rivalitäten geprägt.
Wirtschaftliche Abschottung, imperialistische Weltmachtgelüste und ein
enormes Wettrüsten kurbelten die Industrieproduktion an. Das
„Säbelrasseln" brauchte Kohle und Stahl: Ein Jahr vor dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs erreichte die Kohlenförderung auf Zollern einen
Stand, der erst 1929 übertroffen wurde. Kurz darauf, im Juli 1914, bot
sich der politischen Führung ein kriegsauslösender Anlass; die
Kriegsbegeisterung erfasste auch Bövinghausen. Der Erste Weltkrieg
forderte nicht nur einen enormen Blutzoll, sondern erwies sich auch als
Druckkammer, in der das bisherige politische und gesellschaftliche
System zerbrach.
Im Ersten Weltkrieg ging die bisherige staatliche und gesellschaftliche
Ordnung unter. Ausgelöst durch die Ermordung des Österreichischen
Thronfolgers wurde ein System von Bündniskoalitionen aktiviert. Am Ende
befanden sich ganz Europa und die USA im ersten „totalen Krieg". Der
Krieg löste in Deutschland anfangs in breiten Schichten Zustimmung aus.
Ein „Burgfrieden" aller gesellschaftlichen Kräfte stabilisierte die
Lage im Innern. Man rechnete mit einem raschen Sieg. Doch der Plan ging
nicht auf: Ein zermürbender Stellungs-und Grabenkrieg zerstörte
Millionen Menschenleben. Für die Massenvernichtung des „Gegners"
lieferte die Montanindustrie des Ruhrgebiets neue Waffentechniken von
immenser Zerstörungskraft.
Erstmals wurden Chemiewaffen eingesetzt. Unzählige Veteranen waren
lebenslang durch entsetzliche Verstümmelungen gezeichnet. Die
„Heimatfront" sollte für Nachschub von Menschen und Material sorgen.
Doch auf einen langen Krieg war Deutschland nicht vorbereitet. Überall
fehlten Arbeitskräfte. Dem Bergbau wurden etwa vierzig Prozent seiner
leistungsfähigsten Kräfte entzogen; die Produktivität sank. Im
berüchtigten „Steckrübenwinter" 1916/17 brach die Versorgung vollends
zusammen. Mit dem Hunger und den Toten durch Mangel und Kälte sank auch
die Moral. Beflügelt durch die Russische Revolution mehrten sich
Streiks und radikale Forderungen nach einem Umsturz. Hunger und
Kriegsmüdigkeit gewannen die Oberhand, im November 1918 kapitulierte
Deutschland.
Extraausgabe des Vorwärts 9. November
1918
Gedrängt durch die revolutionären Massen verkündete Reichskanzler Max
von Baden eigenmächtig die Abdankung Kaiser Wilhelms II. und übertrug
seine Geschäfte dem SPD-Vorsitzenden Friedrich Ebert. Kurz darauf ging
der Kaiser in die Niederlande ins Exil.
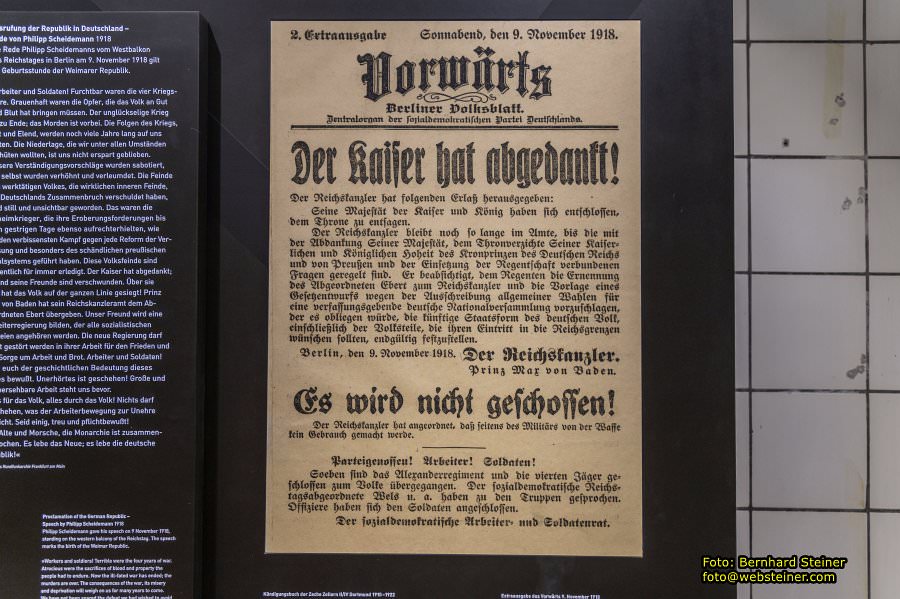
Der Zweite Weltkrieg veränderte den Arbeitsalltag auf Zollern enorm.
Die Vereinnahmung des Betriebes durch die NS-Ideologie nahm sichtbar
zu. Auch wurde die Beschaffung von Arbeitsmaterial wegen der
kriegsbedingten Mangelwirtschaft immer schwieriger. Nach dem Angriff
Deutschlands auf die UdSSR 1941 und der massiven Einziehung von
Bergleuten zur Wehrmacht schrumpften die Stammbelegschaften auf den
Zechen des Ruhrgebietes erheblich, obwohl der Bergbau eine
Schlüsselfunktion für die deutsche Volks-, Rüstungs- und
Kriegswirtschaft hatte. Kohle war der wichtigste Rohstoff für die
private und industrielle Energieversorgung.
Um die vorgegebenen Produktionsnormen zu erfüllen und den Mangel an
Arbeitskräften auszugleichen, griffen die Bergbauunternehmen verstärkt
auf den Einsatz von Zwangsarbeitern zurück. Allein von 1942 bis 1944
arbeiteten auf den Zechen des Ruhrgebietes fast 240.000 Zwangsarbeiter;
sie stellten 40 Prozent der Belegschaften.
Zwangsarbeit entwickelte sich zu einem zentralen Element der
nationalsozialistischen Kriegswirtschaft: Vor aller Augen wurden
zwanzig Millionen Menschen in Deutschland und den besetzten Gebieten
zur Arbeit gezwungen. Ob sie gequält, ihrem Schicksal überlassen oder
menschlich behandelt wurden, lag zum großen Teil in der Hand der
deutschen Zivilbevölkerung. Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg ist
deshalb das größte Gesellschaftsverbrechen des 20. Jahrhunderts.
Ungezählte Menschen überlebten die Torturen dieser Zeit nicht.

Im Bereich des ehemaligen Zechenbahnhofs und des sich anschließenden
Freigeländes ist eine umfangreiche Sammlung an Eisenbahnfahrzeugen
abgestellt, die größtenteils von ehemaligen Werkbahnen der
Montanindustrie stammen. So findet sich hier beispielsweise auch die
Dampflok „97“ der ehemaligen Schmalspur-Werkbahn der Westfalenhütte.

1958 setzte eine nachhaltige Absatzkrise für die Ruhrkohle ein, die im
Vergleich zur Importkohle inzwischen zu teuer geworden war. Das
nachfolgende „Zechensterben" führte zum Abbruch von zahlreichen
Tagesanlagen. Das galt vor allem für die Fördergerüste, die
jahrzehntelang das Landschaftspanorama im Ruhrgebiet geprägt hatten.
Auf Zeche Zollern II/IV endete die Förderung bereits 1955, nachdem in
Dortmund-Marten eine neue Zentralförderung für sämtliche
Zollern-Germania-Grubenfelder in Betrieb gegangen war. Während die
„Ehrenhof"-Bauten noch durch Mittel- und Kleinbetriebe genutzt werden
konnten, demontierte die GBAG das Fördergerüst über Schacht II im
September 1969. Als nächstes wurde der Abbruch der Maschinenhalle
ausgeschrieben, um Schrotterlös zu erzielen. Die Rettung der
„Jugendstil-Halle" gelang schließlich dank des visionären Engagements
einer kleinen Zahl von Persönlichkeiten aus der nordrhein-westfälischen
Kulturszene. Diese Rettung wurde bald zur Keimzelle der Industriekultur
im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus. Nach mehrjähriger Betreuung
durch das Deutsche Bergbau-Museum Bochum wurde Zollern II/۱۷ einer von
acht Standorten und Zentrale des 1979 gegründeten LWL-Industriemuseums.

Die spektakuläre Rettung der Maschinenhalle vor drohendem Abriss lenkte
die öffentliche Aufmerksamkeit generell auf die Frage einer
„Technischen Denkmalpflege" für hochkarätige, aber funktionslose
Industriebauten. Der Landeskonservator von Westfalen-Lippe schuf 1973
ein eigenes Referat für diesen Aufgabenbereich. Hier wurde die Idee
eines Westfälischen Industriemuseums entwickelt. Die Museumsgründung
erfolgte 1979. Kern des Museumskonzepts ist die Darstellung der
Geschichte der Menschen im Industriezeitalter am originalen Schauplatz,
im historischen Industriegebäude und benachbarten Arbeiterhaus.
Inzwischen gehören außer der Zeche Zollern II/IV sieben weitere
Industrieanlagen in Westfalen-Lippe zum LWL-Industriemuseum. Zum
Zeitpunkt der Übernahme waren die Baudenkmale weitgehend in ruinösem
Zustand und mussten umfassend saniert werden.

Über einem 491 m tiefen Schacht steht die Schachthalle. Hier kam die
Kohle zu Tage und erfuhr ihre erste Aufbereitung. Hier fanden auch
Seilfahrt und Materialtransport statt. Die ursprüngliche Schachthalle
wurde 1959 abgerissen, zehn Jahre später fiel das Fördergerüst. Die
heutige Schachthalle und das Fördergerüst stammen von der Zeche
Wilhelmine Victoria I/IV in Gelsenkirchen. Das LWL-Industriemuseum hat
sie 1988 wieder aufgebaut, um die wichtigsten Betriebspunkte und
zugleich Symbole einer Zeche wieder herzustellen. Die Ausstellung in
der Schachthalle zeigt die Aufbereitungsstufen von der Rohkohle bis zu
einer Fülle verkaufsfertiger Produkte. Im Mittelpunkt stehen jedoch die
Menschen, die hier im Wandel der Zeiten gearbeitet haben.

Portal der Maschinenhalle der Zeche Zollern 2/4 mit Jugendstilfenster

Die Maschinenhalle wurde dank
der Initiative von Hans P. Koellmann 1969 nicht wie geplant
abgebrochen, sondern als erstes Industriebauwerk in Deutschland unter
Denkmalschutz gestellt und zunächst vom Deutschen Bergbaumuseum in
Bochum betreut. 1981 integrierte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
die Zeche in das dezentrale Westfälische Industriemuseum. Nach und nach
wurden die umliegenden Gebäude restauriert und für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Neben den eindrucksvollen Bauwerken sind auch die
Außenanlagen Teil des Museums. Die Kohleverladestation, der ehemalige
Zechenbahnhof und ein begehbares Fördergerüst gehören zu den
Attraktionen.

An dieser Stelle trennt uns ein nur 139 m starkes Deckgebirge von einem
etwa 1.500 m mächtigen Schichtenpaket mit reichen Kohlevorkommen. Die
kohleführenden Schichten, die Flöze, liegen dabei stark gefaltet
übereinander. Zwischen ihnen lagert Gestein. Erschlossen wurde das etwa
4 qkm große Grubenfeld über einen vertikalen Schacht mit fünf Sohlen,
die etagenartig die begehrte Fettkohle zugänglich machten. 1898
begannen die Abteufarbeiten am Schacht, der einen Durchmesser von 5,50
m hat. Die sechste Sohle war mit 620 m die tiefste. Sie war nicht
direkt mit dem Förderschacht und der Erdoberfläche verbunden. Eine
solche vertikale Verbindung zwischen mehreren Sohlen bezeichnet man als
Blindschacht.
1902 begann die Förderung. Abgebaut wurden mächtige Fettkohlenflöze, z.
B. Präsident, Dickebank, Röttgersbank, Wilhelm und Sonnenschein, aber
auch weniger mächtige wie Johann und Gretchen. Fettkohle eignet sich
besonders zur Kokserzeugung, Zollern war also eine Kokskohlenzeche. Die
Rasenhängebank diente vor allem dem Transport von schwerem, sperrigem
Material und bis 1953 auch der Einfahrt der Grubenpferde. 1955 wurde
die Zeche Zollern II/IV Teil des Verbundbergwerks Zollern-Germania. Die
Kohlenförderung fand nun am Zentralschacht Germania in Dortmund-Marten
statt, doch bis zur Stilllegung 1966 fuhren hier weiterhin Bergleute
ein. Heute ist der Schacht verfüllt.


Die zentrale Maschinenhalle der Zeche war seinerzeit nicht mehr in
massiver Bauweise (wie zunächst von Knobbe geplant) ausgeführt worden,
sondern in der Hoffnung auf schnellere Fertigstellung als eine mit
Backstein ausgefachte Eisenfachwerk-Konstruktion. Vorbild war die
Ausstellungshalle der Gutehoffnungshütte auf der
Rheinisch-Westfälischen Industrie- und Gewerbeausstellung Düsseldorf
1902, in der auch die elektrische Fördermaschine für den Schacht 2 (vor
ihrer endgültigen Montage in Bövinghausen) ausgestellt wurde. Wie bei
der Düsseldorfer Halle sorgte der Berliner Architekt Bruno Möhring
(1863–1929) für die Ausschmückung der Maschinenhalle mit Details in
Jugendstilformen, als deren Höhepunkt der Haupteingang mit farbiger
Verglasung und einem geschwungenen Vordach (ähnlich den Pariser
Metrostationen von Hector Guimard) gelten konnte. Das Vordach wurde
wohl schon in den 1930er Jahren nach einem Schaden abgebrochen, aber
andere Einzelheiten ziehen noch heute den Betrachter in ihren Bann.

Wenn auch der Jugendstil für ein Industriebauwerk insgesamt eher
ungewöhnlich war, so gab bzw. gibt es doch einige Beispiele für seine
Verwendung im Zusammenhang mit Bauten der Elektrizität wie z. B. dem
Wasserkraftwerk Heimbach in der Eifel, oder bei modernen
Eisenkonstruktionen wie z. B. den Brücken- und Stationsbauwerken der
Berliner Hochbahn. Die Maschinenhalle erfüllt beide Kriterien: Sie war
eine moderne Eisenkonstruktion und sie beherbergte fortschrittliche
Elektrotechnik, als auf anderen Zechen noch ohne Elektrizität
gearbeitet wurde.
Schalttafel aus Marmor in der Maschinenhalle mit Uhr über der
Schalttafel
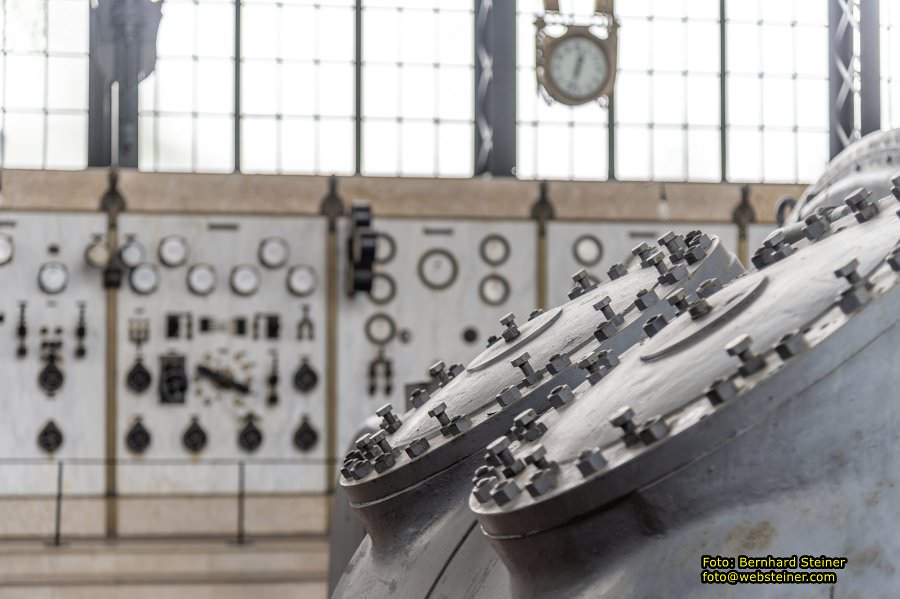
Kohleverladung

1999 wurde die Dauerausstellung Musterzeche eröffnet. In dieser wird
die Sozial- und Kulturgeschichte des Ruhrgebiets sowohl für Erwachsene
als auch für Kinder anschaulich dargestellt. Die Ausstellung
thematisiert das Ausbildungswesen des Ruhrbergbaus, die Entwicklung des
betrieblichen Hygiene- und Gesundheitswesen sowie die Anstrengungen zur
Reduzierung von Arbeitsunfällen.

Mit Vollgas in die neue Zeit
Die jugendlichen Bergleute gingen auch in den 1950er Jahren ihre
eigenen Wege. Sie fühlten sich vor allem von der wieder auflebenden
Freizeitindustrie angezogen. Viele verbrachten ihre Freizeit im
Fußballstadion, Kino, Tanzschuppen, Café oder einfach auf der Straße
und lasen Heftchenromane, Comics, Musik- und Filmzeitschriften.
Mit dem wachsenden Einkommen wuchs auch die Konsumorientierung der
Jugendlichen. Ganz oben auf ihrer Wunschliste standen Produkte mit
einem hohen Freizeitwert wie Moped, Radio, Tonband, Fotoapparat - alles
Dinge, die ein individuelles Freizeitvergnügen förderten und den Drang
nach Mobilität befriedigten.

Die Lohnhalle war Aufenthaltsraum und Durchgangsstation zur
Materialausgabe des Magazins und zur Kaue. Am Schalter des Büros
erhielten die Bergleute dreimal monatlich ihren Lohn.

Der Westfalenpark ist eine 70
Hektar große Parkanlage in Dortmund. Der Park wurde zur ersten der drei
dortigen Bundesgartenschauen (1959, 1969, 1991) eröffnet. Auf dem
Gelände des alten Kaiser-Wilhelm-Hains, des Buschmühlenparks, einer
Mülldeponie und verwilderten Kleingartenanlagen entstand eine
Parkanlage, deren Mittelpunkt das mit 220 Metern damals höchste
deutsche Gebäude, der Florianturm, bildet. Der Park zählt mit 70 Hektar
zu den großen innerstädtischen Parkanlagen in Europa und dient als
beliebtes Ausflugs- und Erholungsziel in Nordrhein-Westfalen.
Florianturm und Flamingoteich (Westfalenpark)

Der Florianturm, kurz Florian,
ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen und prägt als Landmarke die
Skyline der Stadt Dortmund. Der Aussichts- und Fernsehturm wurde 1959
anlässlich der Bundesgartenschau im Westfalenpark mit einer Höhe von
219,3 Metern errichtet. Für rund ein Jahrzehnt war er der höchste
Fernsehturm Deutschlands und damit eines der höchsten Bauwerke des
Landes. Seine gegenwärtige Höhe mit Antennenanlage beträgt rund 209
Meter. Im Turmkorb befindet sich ein Drehrestaurant. 1959 war es das
erste seiner Art weltweit.

Kaiser Wilhelm I. (1797-1888)
Das Denkmal aus Bronze auf einem Sockel aus Schwedischem Granit stellt
den König von Preußen von 1861 bis 1888 und Deutschen Kaiser von 1871
bis 1888 dar. Es wurde vom „Verein zur Errichtung eines Kaiser Wilhelm
Hains" unter Vorsitz des Landgerichtsrates Wilhelm Maximilian Baeumer
finanziert und am 3. Juni 1894 feierlich eingeweiht und mit der
gesamten Parkanlage der Stadt Dortmund übertragen. Gestalter des
Ruhenden Monarchen war Professor Dr. Johannes Schilling aus Dresden,
dessen Hauptwerk das rund 40 m hohe Germania-Denkmal auf dem Niederwald
bei Rüdesheim ist. Der einstige Kaiser Wilhelm Hain (11 ha) wurde 1959
anlässlich der ersten Dortmunder Bundesgartenschau zur Keimzelle des
heutigen Westfalenparks (70 ha). In diesem Zusammenhang wurde das
Denkmal von seinem ursprünglichen Standort südlich des Teiches an den
jetzigen Platz umgesetzt.

Statue Stehendes Mädchen

Bronzeplastik "Wisent" im Westfalenpark, im Hintergrund: Fernsehturm
'Florian' (Florianturm).

Aussicht vom Florianturm auf SIGNAL IDUNA PARK und Westfalenhalle

Aussicht vom Florianturm auf die Innenstadt von Dortmund

Station der U-Bahn Westfalenpark U

Der Vincketurm ist ein
achteckiger, neugotischer und 26 Meter hoher Aussichtsturm bei der
Hohensyburg im Dortmunder Stadtteil Syburg in Nordrhein-Westfalen. Der
Turm wurde 1857 auf dem höchsten Punkt des Sybergs (244,63 m ü. NN) zur
Erinnerung an den früheren Oberpräsidenten Westfalens Ludwig von Vincke
(1774–1844) nach den Plänen des Verstorbenen errichtet. Die Ehrung
Vinckes erfolgte wegen großer Verdienste um den Aufbau Westfalens nach
der französischen Herrschaft während des Département Ruhr. Der Turm
besteht aus Ruhrsandstein.
Parkanlage Hohensyburg mit Vincketurm

Hohensyburg Burgruine
Im frühen Mittelalter spielte die circa 14 Hektar umfassende, in
fränkischen Quellen als „sächsische Sigiburg" bezeichnete Wallburg eine
Schlüsselrolle bei den Kämpfen zwischen Sachsen und Franken. Die
Eroberung der Sigiburg im Jahr 775 durch Karl den Großen ist die
älteste schriftliche Nachricht für den Dortmunder Raum. Im südlichen
Bereich der frühmittelalterlichen Wallburg entstand vermutlich im 12.
Jahrhundert die Burg Syburg. 1253 werden die Herren von Sieberg zum
ersten Mal erwähnt. In den Jahren 1287/88 wurde die Burg durch den
Grafen Eberhard von der Mark zerstört und danach ganz oder in Teilen
wieder aufgebaut. Die Hauptburg wurde auf einer Fläche von-22 x 45 m
von einer etwa 90 cm starken Wehrmauer aus Sandstein eingefasst. Das
Zentrum dieser Burganlage nimmt ein großer Steinbau ein, der eine Länge
von fast 20 m aufweist. Dieses heute als Ruine erhaltene Hauptgebäude
war im Obergeschoss in einen großen Saal sowie einen kleineren
Nebenraum unterteilt. Der benachbarte Vincketurm stammt aus dem Jahr
1857.
Kriegerdenkmal von Fritz Bagdons, 1930

Aussicht über die Ruhr zum Sauerland von der Aussichtsplattform beim
Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Preußisch-nationaler Erinnerungskult auf dem Syberg - Kaiser-Wilhelm-Denkmal
Im 19. Jahrhundert bekam das Bergplateau auf dem Syberg, auf dem sich
noch heute die Ruinen der mittelalterlichen Burganlagen befinden, im
Zuge der deutsch-nationalen Denkmalsbewegung eine neue Funktion
zugesprochen. Während der Vincketurm von 1857 noch einer Frühphase
angehört, stellt das 1902 eröffnete Kaiser-Wilhelm-Denkmal ein
steingewordenes Zeugnis des Wunsches dar, die karolingische Geschichte
in einen Sinnzusammenhang mit Kaiser Wilhelm I., den »Reichseiniger«,
zu stellen. Das Denkmal wurde als monumentale Dreiturmgruppe mit
reichem neugotischem Bauschmuck nach einem Entwurf des Architekten
Hubert Stier gestaltet. Vor den Turmbauten standen das zentrale
Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. sowie die Standbilder Ottos von
Bismarck, des Grafen von Moltke, Kaiser Friedrichs III. und des Prinzen
Friedrich Karl. Hierbei handelte es sich um Arbeiten der Stuttgarter
Bildhauer Adolf und Karl von Donndorf.
Die Nationalsozialisten reduzierten 1935 die Denkmalgruppe und deuteten
sie damit bewusst um. Sie entfernten die Skulpturen der beiden Söhne
Wilhelms I., Kaiser Friedrich III. und Prinz Friedrich Karl. Der Kaiser
war nun nur noch von Bismarck und Moltke umgeben; seine Rolle als
Alleinherrscher wurde somit betont. Infolge der Abtragung der
flankierenden Turmbauten erhielten die Standbilder Bismarcks und
Moltkes ihren neuen Standort vor den seitlichen Nischen des Hauptturms.
Die Lebensdaten Kaiser Wilhelms I. wurden durch das Datum der
Reichsgründung, 18. Januar 1871, ersetzt.

SIGNAL IDUNA PARK - Stadion des BVB mit Kapazität für 80.000 Menschen
bei Bundesligaspielen & 65.000 bei internationalen Partien.

Der Signal Iduna Park (Eigenschreibweise: SIGNAL IDUNA PARK; bei
UEFA-Wettbewerben werbefrei BVB Stadion Dortmund), bis Dezember 2005
und im Sprachgebrauch auch Westfalenstadion, sowie in Fankreisen auch
als Tempel bezeichnet, ist ein Fußballstadion im Bezirk Innenstadt-West
der nordrhein-westfälischen Großstadt Dortmund.

Mit 81.365 Zuschauerplätzen ist es das größte Fußballstadion
Deutschlands sowie das sechstgrößte Vereinsstadion Europas. Das Stadion
liegt an der Strobelallee und ist seit 1974 die Spielstätte des
Fußball-Bundesligisten Borussia
Dortmund.
Es war bereits mehrfach Austragungsort internationaler Fußballturniere,
u. a. der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, der Fußball-Weltmeisterschaft
2006 und zuletzt der Fußball-Europameisterschaft 2024, sowie von
Heimspielen der deutschen Nationalmannschaft.

BVB-FanWelt mit Maskottchen Emma.

Am 1. Dezember 2005 wurde aus dem Westfalenstadion offiziell der Signal
Iduna Park. Für die Namensrechte des Stadions erlöst Borussia Dortmund
bei optimalem sportlichem Erfolg aktuell jährlich geschätzte fünf
Millionen Euro. Der Vertrag über die Umbenennung zwischen Borussia
Dortmund und der Signal Iduna Gruppe gilt bis zum 30. Juni 2031.

Das Stadion der UEFA-Kategorie 4 ist mit den markanten gelben Pylonen
der Dachkonstruktion ein Wahrzeichen der Stadt Dortmund.

Zuschauerrekord: In der Saison 2015/16 verbesserte Borussia Dortmund
bei seinen 17 Heimspielen den selbst gehaltenen europäischen Rekord für
eine einzelne Liga-Spielzeit aus der Saison 2012/13 (80.543 Zuschauer
pro Spiel). Obwohl die Kapazität des Stadions in den letzten Jahren
geringfügig verringert wurde, wohnten letztendlich 1.380.023 Besucher
den Bundesliga-Partien des BVB bei und schraubten die durchschnittliche
Zuschauerzahl auf 81.178. Das entsprach einer Stadionauslastung von
99,88 Prozent. Der BVB hat seit der Saison 1998/99 jährlich den
höchsten Zuschauerschnitt in der Bundesliga. Der eigene europäische
Rekord wurde, mit fast 100.000 Zuschauern mehr als der vorherige Rekord
aus der Saison 2013/14, auf 1.948.880 Zuschauer verbessert.

Das Westfalenstadion ist aktuell das viertgrößte Fußballstadion Europas.


„Unschlagbar in Dortmund“: Ab ihrem ersten Länderspiel im
Westfalenstadion am 17. April 1974 gegen Ungarn (5:0) blieb die
deutsche Fußballnationalmannschaft an dieser Stätte über 32 Jahre lang
ungeschlagen. Erst nach zwölf Spielen ohne Niederlage (davon elf Siege)
endete die Serie, als sich die DFB-Elf im Halbfinale der WM 2006 in
Dortmund dem späteren Weltmeister Italien mit 0:2 nach Verlängerung
geschlagen geben musste.

Polizeistation und Hafträume

Ein letzter Umbau zur Vorbereitung des Stadions auf die
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fand in der Sommerpause 2005 statt,
überwacht von den Architekten der Dortmunder „Planungsgruppe Drahtler“.
Dazu gehörten die Installation eines elektronischen Zugangssystems, die
Aufwertung der Plätze für Behinderte, der Umbau der VIP-Bereiche, der
Spielerkabinen und der sanitären Einrichtungen. Aufgrund der
Umbaumaßnahmen der Tribünen fielen 1.500 Zuschauerplätze weg und das
Stadion bot nun Platz für 81.264 Zuschauer. Die UEFA deklarierte das
Stadion anschließend zum Elitestadion, heute Kategorie 4. Es ist damit
eines der Stadien, in denen Endspiele der Champions League oder der
Europa League stattfinden dürfen.

Seit dem 19. Dezember 2008, dem 99. Geburtstag des Vereins, existiert
in der Nordostecke des Stadions das »Borusseum«, ein Museum rund um die
Geschichte von Borussia Dortmund. Maßgeblich geplant wurde das
Borusseum von der Fan- und Förderabteilung des BVB sowie von Reinhold
Lunow, dem derzeit amtierenden Schatzmeister der Borussia. Aufgrund der
Schulden des Vereins wurde das Museum komplett aus Spenden finanziert.
Im Februar 2011 wurde das Borusseum für den Europäischen Museumspreis
nominiert.

Das BORUSSEUM ist auf Initiative der Fans hin entstanden. Das
Vereinsmuseum von Borussia Dortmund erinnert an über 110 Jahre
Fußballgeschichte und Tradition. Hier, im,schönsten Stadion der Welt",
wird Vereinshistorie lebendig. Von der Gründung am Borsigplatz bis
heute die schwarzgelbe Strahlkraft wirkt über den Fußball hinaus. Mit
Werten wie Toleranz, Vielfalt und Demokratie, mit Leidenschaft, Hingabe
und Emotion schreiben wir gemeinsam BVB-Geschichte.

Am 19.12.1909 gründen 18 junge Männer Borussia Dortmund. Sie versammeln
sich in der Gaststätte „Zum Wildschütz", nicht weit vom Borsigplatz im
Dortmunder Norden gelegen. Mit der Gründung stellen sich die ersten
Borussen gegen die Bevormundung der Kirche. Kaplan Hubert Dewald will
das „rohe" Fußballspiel verbieten und versucht, die Versammlung
persönlich zu verhindern. Es kommt zum Handgemenge, doch die Gründer
rund um Franz Jacobi bleiben standhaft. Angelehnt an das ehemals im
Wildschütz ausgeschenkte Bier, gibt man sich den Namen „Borussia". Dem
Zusammenhalt der Gründerväter verdanken wir die Geschichte unseres
Vereins.



Schatzkammer vom BVB 09

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) ist ein städtisches
Museum in Dortmund; es befindet sich in der 1924 von Hugo Steinbach
erbauten ehemaligen Städtischen Sparkasse. Die Sammlungen von Gemälden,
Skulpturen, Möbeln und Kunsthandwerk geben einen Einblick in die
Kulturgeschichte und die Geschichte der Stadt Dortmund.

Zeitlich umfasst die Sammlung Exponate der Ur- und Frühgeschichte bis
hin zu Exponaten des 20. Jahrhunderts.

Dortmunder Goldschatz
Am 30. August 1907 entdeckten Arbeiter in der Dortmunder Ritterstraße
den größten Fund spätrömischer Münzen auf deutschem Boden. In 90 cm
Tiefe fanden sie ein kleines grauweißes Gefäß mit Henkel, um das drei
goldene Halsreifen gelegt waren, und daneben 444 Goldmünzen und Teile
von 16 Silbermünzen. Alle Fundstücke gelangten in das Dortmunder
Museum. Die älteste Münze stammt aus dem Jahre 335, der Regierungszeit
Konstantins des Großen, die jüngste aus der Zeit Konstantins III.
zwischen 407 und 411. Der Schatz ist also nicht vor 407 n. Chr.
vergraben worden. Seine Zusammensetzung deutet darauf hin, daß er in
Gallien gesammelt wurde. Da er aber in Germanien vergraben worden ist,
wird er einem germanischen Soldaten der römischen Gallienarmee gehört
haben, die seit dem Kaiser Julian fast ausschließlich aus Germanen
bestand.

Bronzezeit (1800-750 v. Chr.)
In der Bronzezeit setzte erstmals eine systematische Metallproduktion
ein. Da in Westfalen aber weder Kupfer noch Zinn, die beiden
Bestandteile der Bronze, vorkommen, mußten die Rohstoffe oder die
fertigen Geräte importiert werden. Bronzegegenstände waren daher sehr
kostbar und wurden nicht nur wegen ihrer im Vergleich zu Steingeräten
größeren Effektivität, sondern auch aufgrund ihres Prestigewertes
geschätzt. Wegen des hohen Wertes der Bronze stellte man Gegenstände
des täglichen Bedarfs meist weiterhin aus den althergebrachten
Werkstoffen wie Stein, Holz und Knochen her. Überhaupt hielt man zu
Beginn der Bronzezeit noch an vielen Traditionen der ausgehenden
Jungsteinzeit fest, z.B. an dem Brauch, einzelne Tote unter großen
Grabhügeln zu bestatten.
Die ältere Bronzezeit ist in unserem Raum nur durch relativ wenige
Funde vertreten, die meist als Einzelfunde aufgelesen worden sind oder
aus Grabhügein bzw. Horten stammen. Prächtige Grabausstattungen und
Hortfunde weisen jedoch auf gesellschaftliche Veränderungen gegenüber
der Jungsteinzeit hin: Von nun an war es möglich, persönlichen Reichtum
anzuhäufen, wozu die Besitzgüter der vorhergehenden Epochen wie Vieh,
Steinwerkzeuge, Salz etc. weniger geeignet gewesen waren. Die
überwiegende Mehrzahl der hier gezeigten Funde stammt jedoch aus der
jüngeren Bronzezeit. In dieser Periode kam es offenbar zu einer
deutlichen Bevölkerungszunahme. So sind aus vielen Teilen Westfalens
ausgedehnte Gräberfelder mit vielen Bestattungen bekannt, wobei man die
Toten nun allerdings verbrannte und den Leichenbrand unter kleineren
Hügeln oder auch ohne Überhügelung beisetzte.
Die Wohnplätze der damaligen Zeit haben sich leider wesentlich
schlechter erhalten als die im Boden geschützten Gräber. Es gibt aber
Hinweise darauf, daß die Menschen auf einzelnen Gehöften oder in
weilerartigen Siedlungen gelebt haben; größere Dörfer oder gar
stadtartige Siedlungen gab es noch nicht. Neben anderen Faktoren
brachten es die für den Metallimport nötigen Fernhandelsbeziehungen mit
sich, daß in Westfalen viele überregionale Kulturströmungen aus allen
Himmelsrichtungen ihren Niederschlag finden. Hier ist besonders der
Einfluß der eigentlich im südlichen Mitteleuropa beheimateten
„Urnenfelderkulturen" zu nennen, auf den z.B. das Aufkommen des
Brandbestattungsbrauches in der jüngeren Bronzezeit zurückzuführen ist.


Dortmund, die einzige Reichsstadt in
Westfalen
Dortmund entstand aus der Ansiedlung, die sich an einen karolingischen
Königshof und eine Burg lehnte. Aufgrund ihrer Lage an der Kreuzung des
Hellwegs mit der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung entwickelte sie sich
zu einem bedeutenden Handelsort. Auch als Pfalz und Tagungsstätte der
ottonischen und salischen Herrscher spielte Dortmund unter
verschiedenen Namen eine Rolle (Throtmanni 880/84, Tremonia 1153,
Dorpmunde 1222). Der Stauferkönig Konrad III. verlieh der Stadt
vermutlich 1145 das erste nachweisbare, 1232 verbrannte Privileg. Es
räumte den Dortmundern besondere Rechte und Zollfreiheiten ein und
ermöglichte ihnen autonomes Handeln.
Das markierte den Beginn der Bürgergemeinde Dortmund als Reichsstadt.
Diesen Status einer staatlichen Unabhängigkeit musste die Stadt in
vielen Territorial-Fehden und überregionalen Kriegen behaupten. Im 13.
und 14. Jahrhundert erlebte die Reichs- und Hansestadt Dortmund ihre
wirtschaftliche und kulturelle Blüte, die sich zunächst auf den Handel
mit dem Ostseeraum und später mit England und Flandern gründete. Hatte
die Stadt 1618 noch ca. 7000 Einwohner, sank sie durch die
wirtschaftlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges und durch den
Konflikt mit dem katholischen Reich zu einem Ackerbürgerstädtchen mit
nur 2000 Bürgern herab. 1802 verlor Dortmund aufgrund des
Reichsdeputationshauptschlusses seine Eigenstaatlichkeit und wurde 1815
in den preußischen Staat eingegliedert.

Modell der Innenstadt von Dortmund

Vom Handwerk und seinen Zünften
Die zünftischen Verbindungen der Handwerker boten bis ins frühe 19.
Jahrhundert beste Rahmenbedingungen für die Herstellung und den Verkauf
ihrer Produkte. Aber diese Personenvereinigungen, die durch einen Eid
entstanden, waren mehr als wirtschaftliche Zweckgemeinschaften. Sie
boten gegenseitigen Schutz und Beistand und erfüllten religiöse wie
gesellschaftliche Aufgaben. Neben den Handwerken, die zünftisch
organisiert waren, gab es noch andere, z.B. Töpfern und Weben. Diese
Handwerke wurden sowohl innerhalb der Stadt als auch im ländlichen
Bereich ausgeübt. Sie dienten als Nebenerwerb und deckten den eigenen
Bedarf an Tuch und Irdenwaren.
Handwerker lebten vermutlich bereits im frühen Mittelalter in Dortmund,
um für den Königshof zu arbeiten. Die erste schriftliche Überlieferung
stammt aus dem Jahr 1241. Sie belegt, dass sich Schuh- und
Fleischverkaufsbänke auf dem Markt befanden. Um 1252 werden dann in der
ältesten Stadtrechtsaufzeichnung Brauerinnen genannt. Schnell
organisierte sich das Handwerk und bildete Zünfte, die sich in Dortmund
„Gilden" und „Ämter" nannten. Gearbeitet wurde in erster Linie in
Kleinbetrieben, die sich aus einem Meister, seinem Gesellen und
Lehrlingen zusammensetzten.

Webstuhl um 1670, Holz
In zahlreichen Dortmunder Haushalten befand sich ein Webstuhl für den
eigenen Bedarf. Je nach Ausstattung und Aufbau konnten sowohl Wolle als
auch Leinen verarbeitet werden.

St. Reinoldi - Eine bedeutende
Pilgerkirche in Westfalen
Das Modell zeigt die Reinoldikirche um 1500. Mit Ausnahme des Turms
präsentiert sie sich noch heute so - trotz der Zerstörungen im Zweiten
Weltkrieg. Einen Vorgängerbau datieren archäologische Grabungen in die
zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts. Als Grablege des heiligen
Reinoldus, des sagenumwobenen Stadtpatrons, wurde Dortmunds Hauptkirche
zwischen 1235 und 1500 fortwährend ausgebaut. Die Reinoldus-Reliquien
waren wohl schon vor 1200 nach Dortmund gekommen. Wegen ihrer
angeblichen Wunderkraft zogen sie - nach mittelalterlichen Berichten -
Scharen von Kranken und Pilgern nach Dortmund.
Ab 1421 baute man den spätgotischen Hochchor als repräsentativen Rahmen
für die Grablege des Stadtpatrons. Wohlhabende Dortmunder Familien
wetteiferten miteinander bei der Ausschmückung des Baues. 1502 kam zum
Verkauf eines Ablasses so viel Volk zusammen, dass man sich in der
Kirche kaum noch umdrehen konnte. Das berichtet jedenfalls der
Dortmunder Chronist Westhoff.
St. Reinoldi zu Dortmund um 1500, Südseite geöffnet
Modellbau: Traute Winkler, 1960 Gips, Maßstab 1:100

Theodor van Thulden (1606 – 1669) Die Großmut des Scipio, um 1638
Bez. unten rechts: T (?) van Thulden fc. (unleserliche Jahreszahl) Öl
auf Leinwand 294 x 366 cm
Provenienz: Sammlung Graf A. Cerclaes, Maastricht (Limburg), 1904 beim
Kunsthändler De Heuvel in Brüssel, Familie Cremer Dortmund

Trinkschiff - Esaias zu Linden (gest. 1632), Nürnberg, um 1609, Silber,
teilvergoldet
Zierpokale dienten als „Willkomm" und mußten von den Gästen in einem
Zug geleert werden. Sie waren Prunk- und Zierstücke einer festlichen
Tafel und gehörten zu den bevorzugten Exportartikeln der Nürnberger
Goldschmiedezunft.

Tischzucht - Die Ordnung der Sitten
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelten sich neue Sitten und Regeln
für das Zusammenleben der Menschen, ihr Wohnen und ihr Verhalten bei
Tisch. Koch- und Tranchierbücher oder „Tischzuchten" verbreiteten nicht
nur die neuen Benimmregeln - sie setzten auch moralische Maßstäbe,
sangen das Lob der Mäßigkeit und der Bescheidenheit. Die Sitzordnung
bei Tisch entsprach immer der sozialen Hierarchie, auch in der Familie.
Neu war, dass jeder Gast eigenes Gerät und einen eigenen Teller
erhielt. Zuvor hatte man Brettchen gemeinsam benutzt. Neu war auch die
Gabel, die jedoch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein nur besonderen
Aufgaben diente - dem Tranchieren und Vorlegen etwa oder dem Umgang mit
klebrigem Konfekt. Zur wohlgedeckten Tafel gehörten auch Prunkgefäße -
je nach Wohlstand aus Zinn oder vergoldetem Silber. Symmetrisch
geordnet wurden sie in sogenannten Kredenzen oder Schenkschieven zur
Schau gestellt. Flaschen und Krüge standen nicht auf dem Tisch - sie
wurden bei Bedarf herumgereicht. Getrunken wurde im Alltag aus irdenen
Bechern, nur selten dagegen aus Glas. Die Tische sollten mit feinem
Leinen gedeckt sein oder mit Teppichen. Neu waren die Servietten, die
das Tischtuch als gemeinsames Mundtuch ablösten. Der Reinigung dienten
auch Handwaschbecken mit Wasserkannen, die man gemeinhin „Wasserblasen"
nannte.
Peter Meert (?) 1620-1690 - Gruppenbild
der Sint Jorisgilde aus Goes, um 1660 Öl auf Leinwand
Wie in den großen „Schützenstücken" üblich, erscheinen die Mitglieder
einer Schützengilde in prächtigen Gewändern und mit ihren Waffen. In
der Mitte der Gruppe sitzen die sogenannten Vorsteher, Verwalter der
von den Bürgern eingerichteten Stiftungen zur Unterstützung Bedürftiger.

Tulpenvase - Delft, Ende 17.
Jh., Fayence, Unterglasurmalerei
Sockel: Deckelvase -
niederländisch, Delft (?), um 1650; Fayence
Die Vase gehört zu einem Satz konvexer und konkaver Vasen, die in
symmetrischer Aufstellung allein dem Schmuck dienten. Die typische
blau-weiße Färbung der Delfter Fayence ahmte - wirtschaftlich sehr
erfolgreich - die importierten ostasiatischen Porzellane nach.
Deckelvase - Delft, 17. Jh.,
Marke I. van Duyn Fayence
Sockel: Stangenvase ,
niederländisch, Delft?, um 1650 Fayence, Unterglasur in Kobalt
Spucknapf für Pfeifenraucher -
Delft, um 1650 Fayence
Sockel: Deckelvase -
niederländisch, um 1650, Fayence
Chinesische Landschaften zieren die Vasen als Zeichen des weltweiten
holländischen Handels und der Vorliebe für das Fremde.
Zwei Stangenvasen - Delft, 17.
Jh., Marke I. van Duyn, Fayence

Die Welt im Kleinen
Die „Kunst- und Wunderkammern" entstanden an Fürstenhöfen der
Renaissance. Ihre Vorgänger waren mittelalterliche Kirchenschätze mit
Sammlungen von seltenen Naturalien, wertvollen Materialien, Exotica,
Beutegut, heidnischer Kunst, Kuriosa und Reliquien. Selbst die
Schatzhäuser der antiken griechischen Heiligtümer zählten zu ihren
Vorläufern. Vom 15. bis 18. Jahrhundert legten Herrscher diese
Raritätensammlungen an - zum Beispiel Erzherzog Ferdinand von
Österreich (1529-1595) auf Schloss Ambras bei Innsbruck, Kaiser Rudolf
II. (1552-1612) auf der Prager Burg oder Zar Peter I. (1672-1725) in
St. Petersburg. Reiche Patrizierfamilien wie die Prauns und Imhoffs in
Nürnberg oder die Hainhofers in Augsburg ahmten diese Praxis mit ihren
Wundersammlungen nach. Ihr Motiv war das Streben nach umfassender,
enzyklopädischer Bildung. Zudem wollten sie Vorbilder für Künstler und
Handwerker liefern. Geordnet nach Material, Technik oder Größe der
Objekte sollten die Kunst- und Wunderkammern die Ordnung der Welt
widerspiegeln. Gleichzeitig bewiesen sie Freude an der Vielfalt der
göttlichen Schöpfung wie am Erfindungsreichtum des Menschen und
belegten die Welterfahrenheit der Sammler. Der Allgemeinheit wurden die
Sammlungen allmählich geöffnet. Aus der Kunst- und Wunderkammer
entwickelte sich das Museum als Institution.
oben v. l. n. r.:
Doppelscheuer - süddeutsch, um
1570 Silber, getrieben, gegossen
Hl. Norbert - in
Schildpattrahmen Fr. Wilhelm Pluym, süddeutsch, 1653 Holz, Schildpatt,
Silber
Kokosnussbecher - süddeutsch,
15. Jh.; Wurzelholz, Silber
Die Inschrift am Becherrand Es kam frow even nicht ze guot/Sie hett ein
apfel gebrochen/ Din unsteten wankeln muot/Das hat got dik gerochen"
wurde später hinzugefügt.
Vase mit Blumenstrauß - Raimund
Laminit (gest. 1600) Augsburg, um 1570 Silber, getrieben, graviert
Pokal in Eulenform - mit
abnehmbarem Kopf deutsch oder holländisch, um 1550 Silber, getrieben,
ziseliert
Die Eule steht auf einer Flöte und ist ein Beispiel eines kostbaren
Tischspielzeuges. Sie stammt aus dem Besitz der Familie von Druffel,
Haus Wellbergen, Kreis Steinfurt, Westfalen.
Becher mit Fuß - Bremen, Ende
16. Jh., Silber, gegossen, ziseliert
Das Unterteil mit drei Löwen ist mit dem Corpus über Riegel verbunden.
Diese Becher waren als Hochzeitsgeschenke beliebt und galten als
edles Gebrauchsgeschirr für Wein und Bier.
Kokosnuss - Silbermontierung,
Schnitzerei
Das mit einem silbernen Stöpselchen verschließbare Gefäß stammt aus dem
außereuropäischen Raum.
Straußeneipokal - Josef
Zehnder, Zofingen (Kanton Aargau) 1606; Silber, getrieben , graviert
Drei weibliche geflügelte Hermen bilden die Fassung. Auf dem Deckel
befindet sich eine Statuette des Evangelisten Johannes mit der
Umschrift: SAND JOHANNES. Im Deckel die Inschrift: HANS STRUB ZU
DRIM-BACH 1606 und Wappen der Familie Strub.
Elfenbeinpokal - Nürnberg,
Anfang 17. Jh. Silber, getrieben, Elfenbein
Im komplizierten Handwerk, in der runden, zugleich eckigen Form und im
Zusammen-spiel verschiedener Materialien zeigt sich ein typisches
Kunstkammerstück.
Reiterbildnis Kaiser Maximilians II.
(1527-1576, Kaiser ab 1564), als Erzherzog süddeutsch (?), um 1560,
Silber, Ebenholzrahmen
Der Reiter ist durch die Inschrift auf dem Rahmen als österreichischer
Erzherzog Maximilian gekennzeichnet. Das im Wind flatternde Tuch, die
Feldbinde, und der Stab in seiner Rechten weisen ihn als Feldherren aus.
Kokosnussbecher - Köln, um 1500
Silbermontierung
Dies ist der älteste bekannte Kokosnusspokal mit geschnitzten
figürlichen Darstellungen, die auf Holzschnitte zurückgehen: Der
schlafende Ritter Paris wird von Hermes geweckt/Paris überreicht Venus
den Apfel/Hochzeit des Paris und der Helena.
Birnpokal mit Deckel - Tobias
Wolff (tätig 1604-1623) Nürnberg, Anfang 17. Jh. Silber, getrieben,
gegossen, graviert, punziert, vergoldet
Aus dem Spiel mit den Formen der Natur entstand dieser zierliche Pokal.
Mit hoher Handwerkskunst wurden filigrane Pflanzen und eine menschliche
Figur gestaltet, die mit einer Axt bewehrt den Stamm der Birne
erklettert. Deckelpokal mit
Putto - Sachsen, 2. Hälfte 16. Jh. Silber, getrieben, vergoldet
Ergänzungen von 1904
Deckelpokal mit römischem
Krieger LT, Nürnberg, um 1570
Erdteil-Schale - Johann
Potthoff 1. (Meister 1587-1605), Münster, um 1600 Silber, getrieben
Die drei Medaillons mit den Brustbildern eines bärtigen und eines
schwarzen Mannes sowie einer Frau stehen stellvertretend für die im
Mittelalter bekannten Erdteile Europa, Afrika und Asien. Die um 1600
längst eritdeckten Amerika und Australien fehlen.
unten v. l. n. r.:
Doppelbecher als Fässchen -
deutsch, Hamburg (7), Ende 16. Jh. Silber, vergoldet
Die Gravierungen wurden nach Vorlagen Hans Sebald Behams angelegt.
Kokosnuss-Humpen - süddeutsch,
um 1600 vergoldete Silbermontierung
Allegorie der Mäßigkeit -
flämisch, um 1600, Silber, getrieben, graviert
Die Tafel zeigt eine vornehme Gesellschaft aus eleganten Damen und
gerüsteten Herren bei Tisch. Im Himmel darüber erscheinen Venus und
Amor auf einer Wolke und Diana in ihrem von Hirschen gezogenen Wagen.
Humpen (Hansekanne)
norddeutsch, 1566, Silber, getrieben, gegossen
Die Daumenrast wird von der Halbfigur einer Meerjungfrau zwischen
Akanthus zweigen gebildet. Der reich geschmückte Griff und Deckel
machen aus einem schlichten Zylinderbecher dieses aufwändige Trinkgefäß.
Birnpokal mit Bauernfigur -
Nürnberg, nach 1548, Silber, getrieben, gegossen, graviert, punziert
Dieser Vexierbecher wurde für Jakob Ramminger gefertigt. Sein auf dem
Birnencorpus dargestelltes Wappen war ihm erst 1548 verliehen worden.
Das exquisite Trinkgefäß spielt mit der Idee, dass ein Bauer die
Riesenbirne nach der Ernte auf seinem Rücken über ein Feld voll kleiner
Lebewesen trägt.
Allegorie des Sommers flämisch,
um 1600 Silber, getrieben, graviert
Die Tafel stammt möglicherweise aus einem Jahreszeitenzyklus an einem
reich gearbeiteten Kabinettschrank, Apollo auf dem Sonnenwagen
überwacht musizierende Hirten, die Getreideernte und den Fischfang.
Trinkbecher (Haufebecher) -
Hans Heinrich Byhel Schaffhausen, um 1550 Silber, getrieben, graviert
Den hohen Lippenrand verzieren gravierte Kriegerköpfe, ein Frauenkopf
und Ornamente.
Kokosnusspokal -
süddeutsch oder schweizerisch um 1570, Kupfer, vergoldet
Ähnlich den Birnpokalen ist die Nuss mit einem Stiel versehen. Ein
Holzfäller hat sie mit seiner Axt abgehackt und trägt sie fort. Dieser
spielerische Kunstgriff macht eine menschliche Figur zum Fuß des Pokals.
Schmuckschatulle - süddeutsch,
um 1550 Apfelholz, vergoldetes Kupfer

Unter der Haube
Die bäuerlichen Höfe konnten sich um 1800 aus den Abgabeverpflichtungen
an den Grundherrn „freikaufen". Größere Bauern wirtschafteten nach der
Ablösung von der „Herrschaft" unabhängig. Hatten sie Erfolg, stellten
sie mit neuem Selbstbewusstsein ihren Reichtum - Kleidung, Schmuck und
anderen materiellen Besitz - zur Schau. Die Frauen trugen reich
bestickte Hauben, je nach Stand und Anlass. Bis zu sechs Hauben
bildeten die Grundausstattung. Es gab bunte, silber-und goldbestickte
Hauben für den Alltag und den Sonntag, für die Arbeit und das Fest, für
die Freudenzeiten und die Trauerzeiten. An der festlichen
Kirchgangskleidung zeigte sich auch, ob eine Frau verheiratet oder
unverheiratet war. Der Schmuck der verheirateten Frau war als
persönlicher Besitz oft mit ihrem Monogramm gekennzeichnet. Aus
Musterbüchern bestellte man bei den Juwelieren modernen Schmuck oder
traditionelle Zierformen. Als Halbfertigprodukte wurden ganze
Garnituren industriell hergestellt.
Münsterländer Goldkappen -
protestantisch und katholisch
Diese Haubenart war für die Sonn- und Feiertage reserviert, sie hatte
farbige Mundbänder aus Seide. An den langen Nackenbändern aus
Goldlitze, dem schmalen Spitzenstrich und der herzförmigen Form des
Haubenbodens erkennt man die protestantische Frau. Das in Schlaufen
gelegte Nackenband, die etwas größere Form und der breitere Strich
kennzeichnet die Haube einer katholischen Frau.
Drigpandsmütze/Goldkappe - Osnabrücker Land, Goldborte, Leinen, um 1880
Drigpandsmütze/Goldkappe - Osnabrück, Goldborte, Leinen, um 1880

Des Christen idealer Lebenslauf
Im 19. Jahrhundert brachte die rasante Veränderung gewohnter
Lebensweisen und Werte, der Umbruch von einer ständisch-agrarisch
geprägten Welt zu einer Industrie- und Marktgesellschaft, viele und
andauernde Probleme.
Zu Bevölkerungswachstum und Hungerkrisen kamen noch soziale
Orientierungslosigkeit, Zukunftsangst und Verunsicherung. Beneidenswert
erschien das klare Leben in der „guten alten Zeit", in der kulturelle
Stabilität, christliche Sittlichkeit und Moral geherrscht hätten. Auf
dem Land, so schien es, war das Leben einfach und klar gewesen. Alles
hatte seine Zeit gehabt, seine Jahreszeit und seine Zeit im Leben,
einen klaren Anfang und ein sicheres Ende. Fest und Alltag wechselten
im vorgegebenen Rhythmus.
Das tägliche Leben war durchdrungen von Religion, die
Gesellschaftsordnung nach Geburt und Stand geregelt. Religiöse
Vorschriften und kirchliche Riten setzten den Rahmen, die weltliche
Obrigkeit sorgte, z.B. durch Fest- und Kleiderordnungen, für ein
diszipliniertes Leben. Standesdenken, Zugehörigkeiten zu Familien und
Konfessionen regelten was sich gehörte und jedes Leben lag in Gottes
Hand, lebte man nun am Rande der Gesellschaft oder im Reichtum. Dinge
aus dem Leben der bäuerlichen Oberschicht schienen diese Welt zu
repräsentieren und wurden nun gesammelt. So wollte man Reste eines
vermeintlich idyllischen Landlebens retten.
Westfälische Bauernhochzeit -
Franz Kels (1828-1893), Derendorf, Öl auf Leinwand
Die Braut trägt eine Brautkrone, ältere Frauen gehen dem Paar entgegen,
in der Hand einen Wassereimer. Im 15.-17. Jahrhundert stellte man in
der Malerei vor allem den derben, „unzivilisierten" Bauern dar, um den
„zivilisierten" Städter und Aristokraten abzuheben. Seit dem 18.
Jahrhundert wurden die Bauern auch in der Kunst romantisiert.
Genrebilder vermittelten das Bild einer heilen Bauernwelt.

Das Flett - Leben im Rauch
In den niederdeutschen Hallenhäusern lebten mancherorts bis in das 20.
Jahrhundert Mensch und Vieh gemeinsam unter einem Dach. Als Mitglied
einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft hatte der Einzelne sich einer
klaren Arbeitsteilung und Rangordnung einzufügen. Das Zentrum des
Hauses bildete die Feuerstelle in der Diele, das Flett. Dort befanden
sich oft die größten und wichtigsten Möbel. Das Kammerfach, der
Wohnbereich hinter dem Flett, bestand meist aus Schlafräumen. Seit Ende
des 18. Jahrhunderts bauten reichere Bauern Stuben ein, die durch
Hinterladeröfen vom Flett her beheizbar und damit rauchfrei waren.
Dorthin verlagerte sich nun ein Teil des Lebens. In ärmlichen
Verhältnissen hat sich das Flett bis in das 20. Jahrhundert kaum
verändert.
Die Herdstelle galt als Maßeinheit für Familienzählungen und
Steuerabgaben. In der ländlichen Oberschicht waren die Haushalte größer
als bei den Unterschichten. Auf überlieferten Abbildungen zeigt die
Anzahl der Stühle die Bewohnerzahl an. Der Platz an der Wärmequelle war
abhängig von der Hierarchie. Nahe am Feuer und seitlich durch die
Rückwand geschützt saßen der Haushaltsvorstand und die Gäste. Sie
hatten den besten Überblick über Haus, Vieh und Gesinde. Seitlich von
der Feuerstelle befand sich der Essplatz, an der gegenüberliegenden
Seite der Waschplatz. Die Nahrung war wenig abwechslungsreich. Über dem
offenen Feuer hing an einem Haken ein Kessel. In diesem einen Topf
wurde gekocht - Eintopf. Kochen war allein schon wegen des Gewichts der
Gerätschaften eine Schwerstarbeit. Die Höhe des Kessels über dem Feuer
regelte die Zubereitungstemperatur, die durch einen Kesselhal verstellt
werden konnte. Mit Aufkommen der Kochmaschine boten sich neue
Möglichkeiten, „getrennt" zu Kochen, die aber nur selten, zu Festtagen,
genutzt wurden. Zum Eintopf aß man Brot und gekochte oder geräucherte
Fleischprodukte. Die Abendmahlzeit wurde meist in einer Pfanne
zubereitet. Eiserne Pfannen wurden am Pfannenhal aufgehängt, dort
Pfannkuchen gebacken und Wurste- und Möppkesbrot, Bratäpfel und
Bratkartoffeln gebraten. Die Häuser hatten keinen Schornstein. Der
Rauch verteilte sich im ganzen Haus und konservierte dabei
Nahrungsmittel und Ernte, der Wiem schützte vor Funkenflug. Dort wurde
das Fleisch geräuchert.

Für die Serie - Möbeldesign im 20.
Jahrhundert
Die Ausgestaltung des privaten und öffentlichen Lebensraums hat im 20.
Jahrhundert an Bedeutung gewonnen. Sie steht in einem engen Verhältnis
zur Architektur. Entscheidende Impulse im Möbeldesign gehen deshalb von
Architekten aus. Im Gegensatz zu dekorativen Tendenzen des späten 19.
Jahrhunderts sind Möbelentwürfe heute verstärkt auf die Anforderungen
ihrer Nutzer ausgerichtet. Der amerikanische Architekt Louis Henry
Sullivan hatte die neue Richtung bereits vor der Jahrhundertwende mit
seiner These „form follows function" (Die Form folgt der Funktion) auf
den Punkt gebracht. Sie hat das Möbeldesign des 20. Jahrhunderts
maßgeblich beeinflusst, wenn auch immer wieder gegenläufige Tendenzen
festzustellen sind. Die ästhetische Qualität eines Möbelstückes wird
nicht nur durch die Form, sondern auch durch das Material definiert.
Neben Holz fanden neue Materialien wie Glas und Stahl Verwendung, in
der zweiten Jahrhunderthälfte kam der stetig wachsende Bereich der
Kunststoffe hinzu.

Georg Wrba - Diana auf der Hirschkuh, 1899, Bronze

Kunsthandwerk und Design im 20.
Jahrhundert
Als Design bezeichnet man heute ganz allgemein die Gestaltung von
Industrieprodukten nach ästhetischen und funktionalen Prinzipien.
Oberstes Kriterium im Design ist der künstlerische Entwurf, entwickelt
vom Designer als maßgebender Persönlichkeit. Ergebnis ist das
industriell hergestellte Serienprodukt. Anders als beim Kunsthandwerk
liegen Entwurf und Ausführung beim Design in verschiedenen Händen. Der
Anspruch, die Form eines Gegenstandes habe seiner Funktion zu folgen,
führte in der Designgeschichte des 20. Jahrhunderts anfangs zur
Bevorzugung des Funktionalen: Die einfache Form und ihre Ästhetik
wurden entdeckt, dem Design soziale Aufgaben abverlangt. Gegen die
rationalen Formen richtete sich in den siebziger und achtziger Jahren
die Forderung nach einer neuen sinnlichen Beziehung zwischen Benutzer
und Produkt. Am Ende des 20. Jahrhunderts ist das Design zu Einfachheit
und Sachlichkeit zurückgekehrt. Gleichzeitig übernimmt es immer mehr
Aufgaben. So zählen zu seinen Anwendungsbereichen heute nicht nur
Computerprogramme, sondern auch die Erscheinungsformen von Unternehmen
oder die Gestaltung von Lebensmitteln. Die ungebrochene Wertschätzung
des handwerklich hergestellten Einzelstücks hat zur Folge, dass im 20.
Jahrhundert neben dem Design auch das Kunsthandwerk lebendig geblieben
ist.
Tänzerin Ruth St. Denis
Entwurf: Albert Dominique Rosé, 1911
Ausführung: Friedrich Goldscheider, Wien, 1922-1945 Vorbild war die
Tänzerin Ruth Saint Denis (1877/79-1986) mit ihrem Tanz „Radha" aus
„Tanz der fünf Sinne", Uraufführung 1906, Fayence

Porzellan - Farbenschmelz und zarter
Glanz
Die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts hatten Europa die Kunst
fremder Kulturen näher gebracht. Besonders die bis ins 19. Jahrhundert
in Europa weitgehend unbekannte Kultur Japans übte eine große
Faszination aus.
Auf dem Gebiet des Porzellans nahm als Erste die Königliche
Porzellanmanufaktur Kopenhagen Anregungen aus der japanischen Kunst
auf. Entwickelt wurde eine breite Skala an Unterglasurfarben, die bei
hohen Brenntemperaturen fest mit dem Porzellanscherben verschmolzen.
Sie verleihen dem Jugendstilporzellan seinen unvergleichlichen Schmelz
und zarten Glanz der Farben. Auch bei der Porzellanplastik,
insbesondere bei Tierdarstellungen, übernahm Kopenhagen eine
Vorreiterrolle. Die Tierfiguren des Jugendstils zeichnen sich durch
große Naturnähe und lebendige Wirkung aus. Bei der Darstellung
menschlicher Figuren griff man zeitgenössische Gesellschaftsthemen auf
oder versuchte eine Umsetzung großplastischer Vorbilder in die
kleinformatige Porzellankunst.
Braut (Europa auf dem Stier)
Aus dem Tafelaufsatz Hochzeitszug, 1904/1905
Entwurf: Adolf Amberg, 1904/1905
Ausführung: Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM), 1911,
Porzellan

Keramik - Die Kunst aus dem Feuer
Beeindruckt von den schlichten Formen und kunstvollen Glasuren
japanischer Gefäße gelangten die Künstler des Jugendstils besonders auf
dem Gebiet der Keramik zu neuen Lösungen. Am Anfang standen
französische Keramiker wie Clément Massier oder Adrien Dalpayrat, die
in ihren Werkstätten Kunstwerke von großer Individualität schufen. Mit
neuartigen Glasurtechniken arbeiteten in Deutschland Max Laeuger,
Richard Mutz und Julius Scharvogel. Henry van de Velde und Richard
Riemerschmid waren als Entwerfer für die traditionell mit Salzglasuren
arbeitenden Keramikwerkstätten m Westerwald tätig. In den
niederländischen Fayencefabriken von Gouda und Rozenburg entstanden
Gefäße, deren farbige Bemalung sich an ostasiatischen Vorbildern
orientierte. Strengere Formen und Dekore entwickelten die
österreichisch-böhmischen Keramikwerkstätten, denen Wiener Künstler die
Entwürfe lieferten.
Gegossen, geschmiedet, gehämmert -
Edles Metall in Alltag und Kunst
Bronze hat in der Kunst traditionell eine wichtige Bedeutung als edles
Material für monumentale Bildwerke. Um 1900 entdeckte man die
Möglichkeiten kleinformatiger Darstellung in Bronze und anderen
Metallen. Große Kunst sollte damit für ein breiteres Publikum
erschwinglich werden. Auch die Medaillenkunst wurde wieder belebt, z.B.
für Auszeichnungen bei den zahlreichen Wettbewerben der Zeit. Kostbares
Silber stand lange nur für die luxuriöse Tischkultur einer kleinen
Gesellschaftsschicht zur Verfügung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
entwickelten Silberwarenhersteller neue Verfahren, die sich für eine
preiswerte Massenproduktion eigneten. Ihr Ziel war, künstlerisch
gestaltetes Gerät für den alltäglichen Gebrauch zu schaffen. So zog der
strahlende Glanz des Silbers um 1900 auch in die bürgerlichen Haushalte
ein.

Schönheitsideal und Ornament - Die
Kunst als Schmuck des Lebens
Der Begriff der Schönheit spielte im Jugendstil eine besondere Rolle.
Nach dem Vorbild der Natur wurde die bewegte Linie zum Symbol des
Lebens erklärt und für die Gestaltung der gesamten Umwelt verwendet.
Durch das Ornament sollten alle Bereiche des Lebens zu einem neuen
Zusammenklang gebracht werden. Entnommen aus der Welt der
Pflanzen oder Insekten konnten naturalistische oder stilisierte Motive
die Gegenstände des alltäglichen Lebens schmücken und verschönern.
Daneben widmeten sich die Künstler dem Thema des „ewig Weiblichen".
Kostbare Materialien und die fließenden Linien der Ornamentik brachten
Schönheit und Sinnlichkeit zum Ausdruck und trugen zur Idealisierung
der Frau bei. Schmuck und Accessoires dienten diesem Zweck ebenso wie
die der Weiblichkeit huldigende Literatur der Zeit.
Büste König Jérômes in großer Uniform
Modell: Karl Heinrich Schwarzkopf
Ausführ.: J. L. Wille, Fürstenberg, um 1810, Biskuit Jerôme Bonaparte
(1784-1860), der jüngste Bruder Napoleons, König von Westphalen von
1807-1813, residierte mit seiner Frau Katharina von Württemberg in
Kassel.
Büste der Friederike Catharina Sophie
Dorothea Königin von Westphalen, geb. Prinzessin von Württemberg
Ausführung: Johann Leopold Wille, Fürstenberg, um 1810, Biskuit

Schlafen wie Kaiserin Joséphine
Joséphine (1763-1814) war die Tochter eines Hafenkapitäns und Gattin
des Vicomte de Beauharnais. Nach ihrer Scheidung heiratete sie 1796
Napoleon Bonaparte, der sie 1804 zur Kaiserin krönte. Die in ganz
Europa wegen ihrer Schönheit gerühmte Frau kaufte 1799 das Schloß
Malmaison westlich von Paris und ließ es vollständig im Empire-Stil
einrichten. Dort lebte sie auch nach der aus dynastischen Gründen
vollzogenen Scheidung von Napoleon ab 1809. Ihr von einem Adler
bekröntes und mit Schwänen verziertes Ruhebett, ihre Möbel mit
ägyptisierenden Dekorationen und die aufwändigen, zeltähnlichen
Wandbespannungen zeigen dort den Stil noch heute in Reinform. Manche
Details dieses grandiosen Stils fanden Eingang selbst in die
westfälische Möbelproduktion. Elegante Möbel aus edlen Hölzern in
schlichten Formen, mit polierten Oberflächen und bronzenen
Schmuckelementen gab es auch hier.

Biedermanns Wohnzimmer
Die rein bürgerliche Epoche des Biedermeiers begann mit dem Erstarken
des Bürgertums im Vormärz seit 1815 und endete je nach Definition
stilistisch um 1835, politisch im Revolutionsjahr 1848. Der Begriff
„Biedermeier" ist, wie so oft in der Geschichte, ursprünglich als
Spottname geprägt worden. Die Möbeltypen, die Materialien und das Dekor
des Biedermeiers waren ganz auf die bürgerliche Wohnung und die
Bedürfnisse der Familie abgestimmt. Typisch für diese Zeit waren
Zimmerensembles mit multifunktionalen Möbelstücken, die zweckmäßig und
bequem waren. Beliebt waren praktische Möbel wie Nähkästchen oder die
Pfeilerkommode mit sieben Schubfächern, eine für jeden Tag der Woche,
sowie zusätzlichen Geheimfächern. Die überschaubaren Grundformen dieser
Möbel wurden bescheiden mit klassizistischen, antikisierenden
Schmuckelementen dekoriert und bestechen durch die lebhafte Maserung
der furnierten einheimischen Hölzer wie Nussbaum, Kirsche, Pflaume oder
Birne. Das Zentrum des Biedermeier-Stils lag in Wien. Hier wurde auch
der Schreibschrank erfunden, die wichtigste Möbelinnovation des
Biedermeiers. Der Stil hielt sich lange und wird heute noch gern
genutzt. Im Design unserer Zeit finden sich wieder Zitate.

Der
große Ball im Bürgerhaus
Kunst- und Musikliebhaber, Industrielle, Kaufleute und Bankiers, die
vor dem Ersten Weltkrieg zu Wohlstand gelangt waren, sahen in der
Einladung in den Salon oder zu Hauskonzerten mit Diners oder Soupers,
zu Bällen oder Theateraufführungen eine gesellschaftliche
Verpflichtung. Ob die musikalische Darbietung oder die Bewirtung im
Vordergrund stand, wurde unterschiedlich gehandhabt. Großbürgerliche
Villen verfügten für derartige Anlässe über ein Musikzimmer mit
mehreren angrenzenden Salons, die für den großen Ball von störendem
Mobiliar freigeräumt wurden. Bei besonderen Hauskonzerten nahmen die
Zuhörer dort nach Geschlechtern getrennt Platz. Die Einladungen dienten
der Kultivierung der Freundschaft, förderten den geselligen Umgang und
betonten großzügige Gastlichkeit. Gleichzeitig bildete sich eine
bürgerliche Musikkultur heraus, die eigene Genres wie das Lied
hervorbrachte und die zur Erbauung, zur inneren Anteilnahme und zum
Vergnügen führen sollte. Nach den Schicklichkeitsregeln des 19.
Jahrhunderts durften Frauen nicht ohne männliche Begleitung ausgehen.
Das eigene Haus bedeutete Sicherheit, die Außenwelt Gefahr. Dieser
Konvention entsprechend bat die Dame des Hauses in ihren Salon zum
Bridge, zum gemeinsamen Musizieren und Theaterspielen, zu Scharaden
oder Tanzsoiréen. Der Salon repräsentierte damit zwei Leitwerte des
Bürgertums: Geselligkeit und Urbanität.

Empire - Des Kaisers neue Mode
Empire ist die im Kaiserreich (franz.: Empire) Napoleons I. (1804-1815)
in Frankreich ausgebildete Stilrichtung. Sie nahm Formen der römischen
und ägyptischen Kunst auf. Ihre strenge und feierliche Wirkung läßt
sich vor allem im Kunstgewerbe, der Innendekoration, in Mode und
Ornamentik feststellen. Möbel wurden aus geraden Grundformen über
Sockeln aufgebaut. Fabelwesen aus der Antike wie Sphinxe, heroische
Tiere wie Löwen und imperialer Schmuck wie Lyra-Formen bildeten die
Vorlagen für Lehnen oder Möbelbeine. Während der napoleonischen
Herrschaft dominierte das Empire die Innenraumdekoration europäischer
Schlösser. Dort unterstrich sogar die Wahl der Wandfarben den an der
römischen Kaiserzeit orientierten Charakter dieses Stils: Gold und
Purpurrot, Grasgrün und Azurblau, die unvermittelt nebeneinander
gesetzt werden konnten. Edle Materialien wie Marmor, Gold und Mahagoni
sollten Strenge, Größe und Macht veranschaulichen. Die Mode war
kurzlebig und erreichte ihren Höhepunkt 1812 mit dem Erscheinen des
Musterbuches von Napoleons Lieblingsarchitekten Fontaine und Percier.
In der Provinz hielt sich der Stil bis um 1830. In Deutschland blieb er
als Repräsentationsstil auf die Höfe beschränkt. Die bürgerlichen
Schichten bevorzugten den josephinischen (benannt nach dem
österreichischen Kaiser Joseph II.) und den nachfolgenden
Biedermeierstil aus dem Möbelzentrum Wien.

Ein altdeutsches Speisezimmer -
Nationalstil Neugotik
Wie kein anderer Bereich spiegelte die Wohnung das neuerlangte
bürgerliche Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts wider. In
historischen Stilen gearbeitete Möbel standen für Tradition und
Geschichtsbewusstsein. Gewerbeausstellungen und Einrichtungsbücher
lieferten die Vorbilder. Dunkle Farben, gedämpftes Licht und eine Fülle
an Dekor waren typisch für die bürgerliche Inneneinrichtung in der
zweiten Jahrhunderthälfte. Die historischen Stile sollten den
Funktionen der Wohnräume angemessen sein. So galt der Salon als Ort der
Repräsentation, in dem Glanz und Pracht entfaltet werden durften. Für
das Speisezimmer dagegen gaben die Einrichtungsbücher eine ruhige und
ernste Möblierung vor. Die im neugotischen Stil gehaltenen Möbel des
ausgestellten Speisezimmers stammen aus einem großbürgerlichen
Dortmunder Haushalt. Sie wurden um 1860 gefertigt nach der
Mustereinrichtung auf einer Dresdener Gewerbeausstellung. Die Vorliebe
für gotische Stilelemente entsprang einer allgemeinen Begeisterung für
das Mittelalter, das man als heile vorindustrielle Welt empfand. Im 19.
Jahrhundert suchten viele Staaten in ihrer Geschichte nach einer
nationalen Identität. In Deutschland wurde die Gotik als Nationalstil
gesehen und zum „altdeutschen" Stil erklärt.

Ein neuer Schatz für das alte Dortmunder Rathaus
Unter Ratssilber versteht man
den aus Lehens- und anderen Geschenken angesammelten Schatz aus
kostbaren Geräten, die in den Rathäusern der Städte verwahrt wurden.
Mit jedem Stück verbanden sich komplizierte Sachverhalte, Rechtsgründe
und Abhängigkeiten. Sie waren gleichsam dingliche Zusätze zu Urkunden
oder mündlichen Absprachen. Gleichzeitig boten sie einen wertvollen
Metallvorrat, der leider im Laufe der Geschichte häufig geplündert
wurde, um die Verpflichtungen der Stadt hinsichtlich
Kriegskontributionen u. a. zu bezahlen. Jede Reichsstadt war stolz auf
den Prunk, den sie zum Beispiel bei Kaiserbesuchen entfalten konnte.
Hierzu gehörte immer auch die Präsentation des Ratssilbers, meist
bestehend aus Bechern, Pokalen, Schalen, Kannen und Leuchtern.
Dortmunds historischer Ratsschatz bestand ursprünglich aus einigen
Leuchtern und dem Becher des Freiherrn von Bodelschwingh, der bereits
1895 dem Dortmunder Museum übergeben worden war. 1897 beschloss die
Bürgerschaft, die Hafeneinweihung im Jahr 1899 höchst feierlich in
Anwesenheit des Kaisers zu begehen und zu diesem Zweck zuerst einen
„Ehrenbecher" und letztendlich ein neues Ratssilber anzuschaffen.
Ausgeführt wurde dieser Plan unter der Anleitung von Stadtbauinspektor
Friedrich Kullrich, der für diesen Zeitpunkt auch die historisierende
Renovierung des Rathauses abgeschlossen haben wollte, in dem der Kaiser
empfangen und das Ratssilber präsentiert werden sollte.
Die Stadt Dortmund hatte drei anerkannte Künstler um Entwürfe gebeten:
Rudolf Mayer aus Karlsruhe, Otto Seubert von der Kunstgewerbeschule
Stuttgart und Hugo Leven aus Düsseldorf. Nicht beachtet wurde vorerst
Gabriel Hermeling aus Köln, der den dortigen Ratsschatz erneuert hatte.
Erst die Dortmunder Bierbrauereien gaben ihm den Auftrag für ihre
Leuchter. Die Dortmunder Industrie und einzelne Bürger brachten zum
Teil enorme Summen für Rathaus und Ratssilber auf.
Leuchterpaar der Dortmunder
Bierbrauereien, 1899
Entwurf und Ausführung: Gabriel Hermeling, Köln Silber, gegossen,
getrieben, ziseliert, graviert, vergoldet, poliert, Lapislazuli,
Malachit, Koralle, Emaille
Leuchterpaar mit je sechs Brauerfiguren. Auf den Deckeln finden sich
der Dortmunder Stadtpatron Reinoldus und ein Standartenträger mit
Adlerfahne.
Ein Paar Jahreszeitenschalen,
1914-1915
Entwurf: K. Eyth, Karlsruhe, Modelleur: Rudolf Mayer, München,
Ausführung: F. Harrach und Sohn
Silber, gegossen, getrieben, ziseliert, graviert, vergoldet, poliert,
Bergkristalle, Emaille, Palisandersockel
Auf den Schalenrändern symbolisieren sitzende Figuren die vier
Jahreszeiten. Inschrift: „Zur Friedenszeit ward ich er-dacht/ In großer
Kriegszeit dann gemacht/Deutschland vertrau auf Gottes Macht!" Die
angehängten Medaillen zeigen die Personifikationen der Tremonia und des
Reinoldus, sowie die Porträts von Wilhelm II. und Karl des Großen. Auf
den quadratischen Plaketten mit Kohlekugeln sind bei einer Schale das
wiederhergestellte Rathaus und die St. Marienkirche dargestellt. Bei
der anderen Schale ist der Freistuhl und das ehemalige Haus Hammacher
am Ostenhellweg zu Dortmund abgebildet.

Was immer hilft - Mittel der ersten
Wahl
Als Schmerz- und Wundermittel schlechthin galt vom 13. bis zum 18.
Jahrhundert der Theriak, eine Paste aus bis zu 60 Zutaten. Betäubendes
Opium und Bilsenkraut wurden, zum Teil unter staatlicher Kontrolle, mit
Goldstaub, Schlangenfleisch, Honig und verschiedenen Mineralien
gemischt. Theriak und Medikamente aus der „Dreckapotheke" - tierische
und menschliche Substanzen wie Mäusedreck, Knochenmehl, Menschenfett,
Teile von Mumien oder seltenen Tieren - gab es auf Jahrmärkten und in
Apotheken. Ohne Vertrauen in Gott, ohne Gebet und Segen konnte niemals
Gesundung erfolgen. Geistige und körperliche Reinigung wirkten
zusammen, Aderlassen, Schröpfen und Klistieren dienten der inneren
Reinigung. Da die Oberschicht des 17. Jahrhunderts durch Überfluss an
Nahrung und Luxus zunehmend unter Verstopfung litt, war das Setzen von
Klistieren eine zusätzliche Einnahmequelle der Apotheker.
Apotheke - Pharmazie
Die Einrichtung einer Apotheke hatte sich nach rechtlichen Vorschriften
zu richten. Dem Arbeits- und Verkaufsraum, der Offizin, schloss sich
das Laboratorium mit Destillierapparatur und Dauerbrandofen an. In der
Stoßkammer wurden die Stoffe zerkleinert und im Arzneikeller gelagert.
Der Eintritt in die Offizin war verboten, die fertigen Produkte reichte
man durch ein Fenster. Am Rezepturtisch in der Offizin wurde unter
Aufsicht eines Arztes oder nach Vorgaben aus einem Arzneibuch die
Medizin gemischt. Die Standorte der Substanzen waren in einem Register
verzeichnet. Die Regale mit den Arzneigefäßen gliederten sich in drei
Abteilungen - Preciosa (kostbare Mineralien), Galenica (Organisches),
Chymica (künstlich hergestellte Stoffe). Die Konsistenz der Substanzen
bestimmte Form und Material der Aufbewahrungsgefäße. In Kannen aus
Fayence oder Porzellan lagerten Sirupe und Honig, in Glasflaschen mit
engen Öffnungen dünnflüssige Öle, Wässer, Essenzen und Spiritusse, in
luftdurchlässigen Holzgefäßen Blüten, Wurzeln, Drogen und Teile von
Tieren. Im „Albarello", einer chinesischen Gefäßform mit weiter
Öffnung, bewahrte man Salben, Wachse und Pulver auf.

Museum für Kunst und Kulturgeschichte: Das älteste Museum seiner Art im
Ruhrgebiet präsentiert sich in einem historischen Gebäude als
Kombination aus Kunst- und Geschichtsmuseum. Von der Ur- und
Frühgeschichte bis ins 20. Jahrhundert – das Museum beherbergt
bedeutende Sammlungen zu Malerei und Plastik bis 1900, Möbel,
Kunstgewerbe und Design bis zur Gegenwart, Grafik, Fotografie,
Textilien, Stadtgeschichte, Archäologie und Vermessungsgeschichte.
Kulturgeschichte im Zeitraffer: von der Antike bis zum modernen Design.

Hörder-Bach-Allee - Am Kai in Hörde

Die Kulturinsel Phoenixsee ist
eine kleine Insel mit regelmäßigen Kunst- und Musikveranstaltungen in
der südwestlichen Ecke des künstlich angelegten Phoenix-Sees. Sie wurde
2010 mit Wasser in die Grube gefüllt, in dem die kontaminierte Erde der
entfernten Phoenix Stahl-Fabrik gekippt wurde. Verbunden mit der
Hafenpromenade mit einer permanenten Brücke, eingerahmt von dem
künstlerischen Corten Steel Tor, ist die Insel auch der ständige
Aufstellungsort der Thomasbirne oder Thomas Converter, die hier bis
1964 verwendet wurde, um geschmolzenen Stahl in Formen zu gießen.

Thomas-Konverter
Das erste Roheisen wurde in Hörde, wenige Meter von dieser Stelle
entfernt, in Puddelöfen zu Rohstahl veredelt. Kräftige Puddler rührten
mit einer Eisenstange von Hand das flüssige Roheisen, um unerwünschte
Schadstoffe abzusondern. Ab 1864 erfolgte in Hörde die Veredlung in
Bessemer-Konvertern, die wegen ihrer Form „Birnen" genannt wurden. Bei
diesem Verfahren wurde Luft durch die Bodensteine der Birne geblasen.
Braunroter Rauch verfärbte dabei den Himmel über Hörde. Beim
Bessemer-Verfahren konnte ausschließlich aus hochwertigen und teuren
Import-Erzen erzeugtes Roheisen verarbeitet werden.
Dem Engländer Sidney Gilchrist Thomas gelang es 1877, durch eine
besondere Ausmauerung der Thomasbirne und durch den Zusatz von Kalk,
den unerwünschten Phosphor abzuscheiden. Dieses Verfahren erlaubte den
Einsatz preiswerter heimischer Erze. Die phosphorhaltige Schlacke wurde
zu „Thomasmehl" zermahlen und als Düngemittel in der Landwirtschaft
eingesetzt. Am 22. September 1879 wurde in Hörde, zeitgleich mit
Duisburg-Meiderich, die erste Thomasschmelze in Deutschland erblasen.
Diese Thomasbirne ist die letzte, die 1954 in der Hörder Kesselschmiede
gebaut wurde. Sie war bis zur Schließung des Thomasstahlwerkes im Jahre
1964 im Einsatz. Dem Verein zur Förderung der Heimatpflege e. V. Hörde
wurde die Thomasbirne von der ThyssenKrupp Stahl AG kostenlos
überlassen. Der Verein hatte die Kosten für Transport und Aufstellung
zu tragen. Die Birne wiegt 68 Tonnen und ist etwa sieben Meter hoch.
Sie wurde am 25. Mai 2002 der Öffentlichkeit als Industriedenkmal
übergeben.

Die Stiftskirche St. Clara - Der Ziegeldom zu Hörde - ist eine
römisch-katholische Kirche im Dortmunder Stadtteil Hörde.

Uhrenkandelaber "Schlanke Mathilde"
Die Schlanke Mathilde ist viel mehr als eine historische Laterne mit
einer vierseitigen Uhr auf dem zentralen Marktplatz in Dortmund Hörde.
Sie repräsentiert zeitgleich die lange Geschichte einer Stadt die in
Dortmund eingemeindet wurde und die Zukunft des Stadtteils der in den
letzten 20 Jahren den sichtbarsten Strukturwandel im Ruhrgebiet
hingelegt hat.Die gusseiserne Uhr wurde 1983 nach historischem Vorbild
von der Ausbildungswerkstatt “Phoenix” der Hoesch Hüttenwerke AG
gefertigt und wiedererrichtet.
Ihren Namen trägt sie bereits seit der Einweihung der Original-Uhr im
Jahre 1908. Als der damalige Bürgermeister zur Einweihung schritt,
begleitet ihn seine nicht ganz so schlanke Ehefrau Mathilde. Die Hörder
Bürger konnten sich den Vergleich zwischen der Bürgermeisterfrau und
der im Gegensatz zu ihr “schlanken” Uhr nicht verkneifen und nannten
die Uhr fortan “Schlanke Mathilde”, sehr zum Ärger des Bürgermeisters.
Auch heute noch hat das Wahrzeichen von Hörde eine wichtige Funktion
als Treffpunkt und Ausgangspunkt für viele Erlebnisse in Hörde. Durch
Ihre zentrale Lage, genau neben dem Ausgang der U-Bahnstation, ist sie
perfekt geeignet um sich zu finden und zu begegnen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Borussia Dortmund, BVB 09 - Signal Iduna Park, April 2025
Zeche Zollern Dortmund, April 2025