web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Gloggnitz
Stadt in den Bergen, April 2023
Gloggnitz ist eine Stadt im Bezirk Neunkirchen im
südlichen Niederösterreich. Die Gemeinde liegt in der Gloggnitzer Bucht
im südwestlichen Zipfel des Wiener Beckens. Wegen der Lage am Fuße des
Semmerings und da umgeben von einem Kranz dunkelgrüner Berge trägt
Gloggnitz den Beinamen Gloggnitz, Stadt in den Bergen.
Als Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Bezirksarmenhaus wurde 1904
ein Steg errichtet, welcher Karlsteg genannt wurde. Der Steg wurde 1927
durch eine Betonbrücke des Architekten Anton Potyka ersetzt, welche vom
Staat (Bund) errichtet wurde und anfangs als Kanzlerbrücke bezeichnet
wurde. Nach der Befreiung Österreichs wurde die Brücke 1945 nach Karl
Renner benannt, der in der NS-Zeit in der Renner-Villa Gloggnitz unter
Hausarrest stand.

Gloggnitz liegt im so genannten Industrieviertel, an der Einmündung des
Weissenbaches in die Schwarza im oberen Schwarzatal. Die Entfernung von
Wien beträgt über die Autobahn 75 km.

Die Dr.-Karl-Renner-Brücke überbrückt den Fluss Schwarza in der
Stadtgemeinde Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Die
Stahlbetonbrücke mit gebürsteter Oberfläche hat bemerkenswerte
Beleuchtungsmaste aus Beton und Eisenbändern.

Weinbergstiege zur Katholischen Kirche Gloggnitz (Christkönig)

Christkönigskirche:
Moderner Bau von Prof. Dr. Clemens Holzmeister; Grundsteinweihe 13.9.1933 Konsekration am 1. 4. 1962

Die Christkönigskirche liegt auf einer Anhöhe im Wochensländerpark im
Zentrum von Gloggnitz. Das Kirchenschiff ist als Betonbasilika
ausgeführt und macht einen wuchtig monumentalen Eindruck. Über dem
Hochaltar ist ein Mosaik Thronender Christkönig von Richard Kurt
Fischer.

Gloggnitz wurde um 1094 als Stützpunkt vom Kloster Formbach urkundlich
genannt. Seit dem 12. Jahrhundert ist Gloggnitz eine Pfarre. Bis 1962
war die ehemalige Klosterkirche des Benediktinerklosters Gloggnitz
(Schloss Gloggnitz) die Pfarrkirche. 1962 wurde neue Kirche
fertiggestellt und zur Pfarrkirche erhoben.



Über Vermittlung von Kardinal Friedrich Gustav Piffl (1864–1932),
welcher auf Burg Kranichberg Sommerfrische hielt, beauftragte der
Pfarrer Bucher den Architekten Clemens Holzmeister (1927) mit der
Planung einer neuen Kirche. Von Holzmeisters Planung einer gestaffelten
Hallenkirche mit einem hochaufragenden Chorturm konnte von 1933 bis
1934 nur der Turm errichtet werden und wurde 1934 als
Kardinal-Friedrich-Gustav-Piffl-Gedächtniskirche geweiht. Für die
Fertigstellung fehlten die finanziellen Mittel. Mit einer Umplanung des
Architekten Clemens Holzmeister wurde das Bauvorhaben redimensioniert
und konnte von 1960 bis 1962 vollendet werden. Dabei wurde der
Altarraum nach Osten verlegt und der ehemalige Altarraum im Erdgeschoß
des Turmes wurde zur Eingangshalle.

Die Orgel baute Josef Mertin 1971.

Am 1. Mai 2023 wurde die Pfarre Gloggnitz um das Gebiet der ehemaligen
Pfarren Klamm am Semmering, Kranichberg, Prigglitz, Raach am
Hochgebirge und Schottwien erweitert. Die Pfarrkirche Gloggnitz ist
Pfarrkirche und Kirche der Teilgemeinde Gloggnitz.

Der Tabernakel wurde von Karl Hagenauer nach Entwürfen von Clemens Holzmeister angefertigt.


Das Schloss Gloggnitz, ein ehemaliges Benediktinerkloster, steht in Gloggnitz im südlichen Niederösterreich.

St. Othmar Kapelle:
Erbaut um 1300, davon heute nichts mehr vorhanden (Langhaus 1950
abgerissen) urkundliche Erstnennung: 17. Juli 1313 Erbauung des
spätgotischen Chores um 1460 (heutiger Bestand)





Vor 900 Jahren rückte Gloggnitz ins Licht der Geschichte. Zum ersten
Mal wird sowohl der Fluss als auch der Ort in einer Formbacher Urkunde
vom 17. Dezember 1094 (Original ist heute nicht mehr vorhanden)
erwähnt. Bei der Bestiftung des Benediktinerklosters Formbach (am Inn
in Bayern), anläßlich der Weihe des ersten Abtes, Beringar, schenkte
Graf Eckbert I. von Formbach neben mehreren Besitzungen in der Nähe von
Formbach (auch Vornbach) auch solche in östlichen Landen.

Graf Eckbert I., ein "Graf von nicht geringer Macht und Tapferkeit",
kam durch Heirat mit Mathilde (um 1055), der Erbtochter des Markgrafen
der karantansichen Mark, Gottfried, des Siegers über die Ungarn (1042)
vor Pitten, in den Besitz eines Großteils des Landstrichs von der
Piesting bis über den Semmering und von Hartberg über Pitten bis Wr.
Neustadt. Der Hauptort dieser Grafschaft "Pütten" war Neunkirchen, der
mit besonderen Rechten ausgestattet war. Geistiger, kultureller und
wirtschaftlicher Mittelpunkt war das Kloster Gloggnitz, das von den
Mönchen des Haus- und Mutterklosters der Grafen errichtet worden war
und durch Tausch, Grundkauf und fromme Stiftungen zu einer
Propstherrschaft heranwuchs. Freilich war der Abt im Mutterkloster
Formbach der eigentliche Geschäftsträger, der alles Tun und Lassen
bestimmte, jedoch tanzten die "Herren auf dem Berg zu Gloggnitz"
manchmal aus der Reihe, pochend auf ihre örtliche und wirtschaftliche
Macht.

Durch 700 Jahre, bis zur Aufhebung des Klosters (mit dem Kloster
Formbach) im Jahre 1803 ist seine Geschichte auch die Geschichte des
Ortes Gloggnitz. Das Kloster, seither Schloss genannt, wurde als
würdigstes Bauwerk zum Wahrzeichen des Ortes neben der noch älteren St.
Othmarkapelle (Marktkapelle), die aus 1001 (oder 1011) stammen soll.
Freilich ist der Ort Gloggnitz in dieser langen Zeit nicht viel größer
geworden. 1345 zählte er 21 Häuser mit 110 Einwohnern, nach der
Aufhebung des Klosters 69 Häuser mit ca. 570 Einwohnern. Doch die
Klosterherrschaft gewann immer mehr an Bedeutung. Die Fröner
bearbeiteten ihr Lehen und roboteten für die Herrschaft. Der
herrschaftliche Betrieb beschränkte sich keineswegs auf Land-, Forst-
und Weinwirtschaft (sie war die Haupteinnahmsquelle) und auch
Schafzucht, es gab auch herrschaftliche Gewerbebetriebe, Tavernen,
Mühlen, eine Schmiede, eine Säge, ein Brech- ("Walk") und ein Badhaus.

Schloß Gloggnitz:
Gründung um das Jahr 1094, gotischer Bau, 1692 barockisiert, 1730
Sakristei und 1789 gegliederter Turm mit Zwiebelturm dazugebaut.

1094 erfolgte die Erhebung des Benediktinerklosters Vornbach zur Abtei.
Im Osten ermöglichte die Schenkung von Gebieten im Raum
Neunkirchen-Pitten-Gloggnitz an die Benediktiner die Gründung eines
Vornbacher Filialklosters in Gloggnitz.

Dieser 1803 profanierte Bau, heute als Schloss bezeichnet, ist ein
dreigeschoßiger Barockbau, die Nordseite mit burgenmäßigem Charakter.
Durch zwei Torhäuser aus der Spätgotik, von denen besonders das zweite
mit seinem zweijochigen Kreuzrippengewölbe interessant ist, gelangt man
in den polygonen Hof (einst Leichenhof), in dessen Mitte die Kirche
steht. An das zweite Torhaus schließt sich die 1,5 Meter dicke und 11,5
Meter hohe mittelalterliche (15., 16. Jahrhundert) Ringmauer mit
Rechteckschießscharten an. Die frühgotische (14. Jahrhundert)
zweijochige, dem heiligen Michael geweihte Abtkapelle hat zwei Zugänge.
In ihrem unteren Teil befand sich einst ein Beinhaus (Karner). Im
kurzen Westflügel ist der Stiegenaufgang zu den Wohnräumen,
wahrscheinlich früher Gästezimmer und zur Empore der Abtkapelle.

“RENAUER SCHLÜSSEL"
Die imposante Kunstschlosserarbeit in der Form eines Schlüssels -
Gesamthöhe ca. 2,50 m - aus dem Jahr 1893 stammend, stellt das
Zunftzeichen der ehem. Gloggnitzer Paradefirma Felix Renauer,
Schlosserei-Maschinen u. Motorenfabrik, gegründet 1879, stillgelegt
1974, dar. Im Jahre 1994 wurde das im Besitz des "Museums in der
Schlosskirche" befindliche Objekt, anlässlich der 900-Jahr
Feierlichkeiten von Gloggnitz, im Schlosshof, mit Genehmigung der
Stadtgemeinde Gloggnitz aufgestellt.

Mammutbäume, Riesen-Sequoien, Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh. (Familie Sumpfzypressengewächse)
Mammutbäume sind Relikte aus dem Erdmittelalter und der subtropisch
warmfeuchten Tertiärzeit. Fossil sind sie aus Braunkohlelagerstätten,
zu denen sie im Laufe von Jahrmillionen verwandelt wurden, bekannt
„lebende Fossilien". Vor ca. 100 Millionen Jahren fast weltweit
verbreitet, konnten sie während der Eiszeit nur in klimatisch
begünstigten Relikt-Arealen, wie der Sierra Nevada Kaliforniens,
überleben. In „National Parks" leben über 80 m hohe Bäume mit
Stammdurchmesser von mehr als 9 m und einem Alter von über 3000 Jahren.
In Europa wurden sie 1853 eingeführt. Der größte österreichische
Mammutbaum wächst im Kurpark von Bad Gleichenberg (Stmk.). Er wurde
1872 gepflanzt und weist eine Höhe 52 m (?) bei einem Brustumfang von
7,20 m auf. Der Baum besitzt sogar einen Blitzableiter. Sein nächster
Verwandter ist der Urwelt-Mammutbaum (Metasequoia) Chinas, der neben
dem Eingang zum Naturpark steht!

Inmitten des Hofes steht die barocke Kloster-(Schloss-)Kirche, die
Maria Schnee (Beate Mariae Virgini ad Nives) und dem heiligen Oswald
geweiht ist, mit gotischem Kern. In einer Urkunde von 1485 heißt sie
auch Propsteikirche St. Godehard (St. Gotthard) in Gloggnitz. Der
älteste Teil ist die Frauenkapelle (wahrscheinlich die ursprüngliche
Zell, 11. Jahrhundert) mit einem Spitzbogengurt von 1260, die früher
selbständig war und erst ca. 1760 mit der Kirche verbunden wurde. Sie
ist ebenfalls gotisch. Die größte Umgestaltung erfuhr die Kirche unter
den Pröpsten Perfaller und Wenckh. 1692 wurde die Kirche barockisiert,
aus der Zeit stammt auch der angebaute 36 Meter hohe Turm mit
Zwiebeldach, der ein Jahr später die erste große Glocke (635 kg), 1724
die zweite (1330 kg) aufzunehmen hatte. Die Sakristei und das Oratorium
ließ 1730 Propst Langpartner dazubauen.

Zwischen der noch erhaltenen hohen Wehrmauer des Klosters und dem
ehemaligen Refektorium befindet sich die St. Michaels-Kapelle, ein
frühgotischer Bau, seit 1322 nachgewiesen, der in der Barockzeit nur
wenig verändert wurde. Im Untergeschoss befand sich der Karner. Ein
Außenfresko des hl. Christophorus ist, wenn auch schwer beschädigt,
noch vorhanden.

Von 1977 an wurde die Schlosskirche, die Michaelskapelle und auch der
gesamte Schlosskomplex mit Unterstützung des ehemaligen
Bautenministeriums, des Wissenschaftsministeriums, des
Bundeskanzleramtes, des Landes Niederösterreich und vieler privater
Spender renoviert bzw. revitalisiert. Auch von der Gemeinde wurden
beträchtliche finanzielle Mittel aufgebracht und von Mitarbeitern des
städtischen Bauhofes tausende Arbeiststunden geleistet. 1988 wurde die
Michaelskapelle wieder geweiht.

Den barocken Johannes-Nepomuk-Bildstock auf dem Johannesfelsen
unterhalb des Schlosses ließ Propst Franz Langpartner bei der
Barockisierung des Klosters errichten. Der seit längerem arg
beschädigte Bildstock wurde 1976 restauriert, die künstlerischen
Arbeiten führte der Bildhauer Kessler aus.

Gloggnitz hat an Bedeutung gewonnen. Dazu kam noch der Bau der
Eisenbahn Wien - Gloggnitz im Jahre 1842 und die Fortsetzung 1854 über
den Semmering, Gloggnitz wurde zu einer wichtigen Bahnstation
(Schnellzugstation). Sie brachte viele Fremde (Sommergäste, Touristen)
in den Ort. Zwei Bundespräsidenten waren Ehrenbürger der Stadt: der
Wahlgloggnitzer Dr. Karl Renner und der im nahen Aue geborene Dr.
Michael Hainisch.
Lange Zeit war nur von dem Dorfe Gloggnitz die Rede, aber 1548 wird ein
"Bürger" von Gloggnitz mit Namen genannt und 1556 ist zum ersten Male
der "Marckht" Gloggnitz verzeichnet (1622 erstmals nachgewiesen), der
laut Urkunde von 1819 das Privileg zur Abhaltung von zwei Jahrmärkten
erhalten hat. In Anbetracht seines wirtschaftlichen Aufschwungs wurde
der Markt am 20. Oktober 1926 zur Stadt erhoben.

KARL RENNER - Vom Bauernsohn zum Bundespräsidenten
Die Lebenszeit Karl Renners - 1870 bis 1950 - umfasste eine Zeit der
welthistorischen Um-, Zusammen- und Aufbrüche, gerade auch in
Österreich. Menschen, die jene Zeiten erlebten, waren konfrontiert mit
dem Zerfall der Monarchie, dem Ersten Weltkrieg, der Gründung und dem
Untergang der Ersten Republik, mit Diktatur und Nationalsozialismus,
dem Zweiten Weltkrieg und schließlich mit der schwierigen Gründung der
Zweiten Republik.
Karl Renner wuchs in ärmlichen Verhältnissen in dem fast ausschließlich
von Deutschsprachigen besiedelten Dorf Untertannowitz in Südmähren auf,
somit in einem wichtigen Brennpunkt der Nationalitätenkonflikte der
Habsburgermonarchie. All das sollte ihn sein Leben lang prägen: seine
sozial benachteiligte Herkunft, sein Deutschsein in einem
Vielvölkerstaat und die Tatsache, Bürger eines großen Reiches gewesen
zu sein. Ergänzt durch seine Verbundenheit zu marxistischen Ideen und
zur internationalistischen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung sind
so die grundlegenden Orientierungspunkte seines politischen Denkens und
Wirkens abgesteckt. Hervorzuheben ist ebenso die innige Verbundenheit
Karl Renners zu seiner Familie. Diese eröffnete ihm eine
beschaulich-stabile familiäre Privatheit, die ihm Rückzugs- und
Regenerationsmöglichkeiten bot, um in schwersten Zeiten große
Verantwortung übernehmen zu können.
Kaum eine andere österreichische politische Führungspersönlichkeit ist
so eng mit der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
verwoben wie Karl Renner; verwoben mit der Anerkennung ihrer großen
historischen Leistungen wie mit der Verantwortung für ihre historischen
Fehlleistungen, Hochverehrt und scharf kritisiert polarisiert er bis
heute. Zunächst fasziniert er als visionärer Theoretiker mit
langfristigen Zielorientierungen. Auch beeindruckt er als
volksverbundener populärer Politiker, der Menschen gewinnen und
verbinden konnte. Ebenso galt er als Tagesrealpolitiker des Ausgleichs
und des Kompromisses, jedoch mit der Bereitschaft, für seinen
Pragmatismus politische und persönliche Grenzen des Tolerierbaren sehr
weit zu ziehen. Eine Beschäftigung mit dieser zentralen
österreichischen politischen Figur wird weiterhin, jenseits einer
Heils- oder Verdammungsgeschichte, notwendig sein, will man sich nicht
eines zentralen Schlüssels zum Verständnis der Geschichte der Republik
Österreich berauben. Alles in allem bleibt er eine epocheprägende
politische Ausnahmerscheinung und eine typisch österreichische Gestalt
mit ihren Ambivalenzen.
Dr. Karl Renner 1870-1950, Gründer der 1. u. 2. Republik

Renner geht am 3.4. zur Kommandantur in Gloggnitz
„Ostersonntag, den 1. April 1945, zogen die russischen Truppen in den
Wohnsitz des Kanzlers, in Gloggnitz, ein....Nachdem ich zwei Tage und
Nächte an meiner Person und in meinem Hause das gleiche wie jeder
andere Bewohner des Ortes erfahren hatte, beschloss ich am Morgen des
Osterdienstags, zum Schutze der Bevölkerung und zur Aufklärung ihrer
ausnahmslos friedlichen Stimmung irgendeine erreichbare Befehlsstelle
im Orte aufzusuchen. Die Straßen waren menschenleer, vereinzelt standen
militärische Posten, die ich ansprach und die mich nicht verstanden.
Ich suchte die Straßen nach einer Kommandostelle ab, stieß endlich auf
zwei Männer, von denen der eine, der ein wenig Russisch sprach, mich
zum Platzkommando führte, das unauffällig in einer Seitenstraße
untergebracht war. Es gelang ihm, sich mit dem Torposten zu
verständigen, dass sie mich anmeldeten und ich dem Kommandanten und
seinem Stabe meine Vorschläge zum Schutze der Bevölkerung vortragen
konnte. Der Kommandant erklärte, in der Sache allein nicht verfügen zu
können, gab mir und den zwei mir unbekannten Zufallsbegleitern eine
Wache von vier Soldaten mit, und so marschierte ich mit dieser
Bedeckung zum nächsten Truppenkommando in das 2 km weit entfernte
Köttlach."
Zu Fuß mit Bewachung von Gloggnitz nach Köttlach
„Im Stabe dieses Kommandos fanden sich zufälligerweise Offiziere, die
meinen Namen kannten. Das hatte zur Folge, dass ich geraume Zeit zu
warten hatte, eine Zeit, die, wie mir später klar wurde, wohl dazu
benützt wurde, mit dem Oberkommando dieses Kampfabschnittes
telephonisch in Verbindung zu treten. Man eröffnete mir endlich, dass
Befehle an das Ortskommando Gloggnitz zur Abstellung von Missbrauch
hinausgehen würden, dass ich jedoch mit meinen Zufallsbegleitern per
Auto einer höheren Stelle vorgeführt werden müsse. Ich war in der
größten Sorge um meine Familie, die nicht ahnen konnte, was mir
passiert wäre - ich hatte ohne Überrock, mit dem gewohnten Spazierstock
in der Hand, früh das Haus verlassen - und Mittag war überschritten.
Nur widerstrebend bestieg ich das mit Plachen eingedeckte Lastauto, das
mich über ein Zwischenkommando auf unbekannten Wegen nach einem
unbekannten Bergort brachte."
Vom 3. bis 5.4. im Hauptquartier in Hochwolkersdorf
„Am zweitnächsten Tag... wurde ich abgeholt, in einen geräumigen
Bauernhof... geführt, wo eine überraschende Anzahl hoher Offiziere mich
begrüßte. Nur einige Namen der Anwesenden konnte ich später
feststellen, unter ihnen den des Generalobersten Scheltow und des
Obersten Piterski. Der Generaloberst richtete nach der Begrüßung durch
einen höheren General, der den Vorsitz führte, seine Rede an mich und
fragte, ob ich mich imstande fühle, zugleich meinem eigenen Lande und
der Roten Armee einen Dienst zu erweisen. Diese wolle nichts von
Österreich und stehe auf dem Boden der Krimdeklaration, d.i. der
Unabhängigkeit Österreichs. Sei ich bereit, zur Abkürzung des
verlorenen Krieges beizutragen und so unter einem die Aufgabe der Roten
Armee zu erleichtern und die Leiden Österreichs zu kürzen? Ich
antwortete: Ich habe lange überlegt und mich entschlossen: Ich traue
der Roten Armee, dass sie von Österreich nichts wolle, als was die
Besiegung der Hitlerarmee ihr auferlege und was das Kriegsrecht ihr
zubillige. Ich traue mir selbst zu, das Werk der Befreiung Österreichs
vom Faschismus in Angriff zu nehmen. In diesem doppelten Vertrauen will
ich die gegebenen Möglichkeiten erörtern."
Karl Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Vom 5.-19. 4. Vorbereitung in Gloggnitz und Eichbüchl
„Nach einem gemeinsamen Abendessen brachte mich ein Auto der Roten
Armee in Begleitung des Obersten Piterski nach Gloggnitz zurück. Dort
machte ich mich an die Arbeit. Glücklicherweise traf um jene Zeit meine
Privatsekretärin dort ein, und so konnte ich die Entwürfe rasch
verfassen...Oberst Piterskis dritter Besuch erfolgte mit zwei Personen-
und einem Gepäckauto. Das Kommando der Dritten ukrainischen Front
(Marschall Tolbuchin) führte mich, meine Frau und Tochter mit wenigen
Koffern fort an einen mir vorher unbekannten Ort. Es war das abseits
von Wr. Neustadt, am Fuße des Rosaliengebirges gelegene, verlassene und
halbleere Schlösschen Eichbüchl, wo wir uns schlecht und recht mit
einem kleinen Wachedetachement unter dem Kommando von Hauptmann Garin
etablierten. Dort hörten wir, dass Wiener Neustadt eben gefallen und
hart mitgenommen sei, dass aber der Kampf um die Hohe Wand, um das
Wechsel- und Raxgebiet andauere, und das Dröhnen der Geschütze war Tag
und Nacht hörbar. In der Abgeschiedenheit dieses kleinen Ortes, dessen
bäuerliche Bevölkerung mich sofort erkannt hatte und mir und den
Meinigen mit liebevoller Verehrung begegnete, verbrachte ich,
unterstützt von meiner Sekretärin und ihrer Schreibmaschine, zwölf Tage
mit fleißiger Arbeit an den Aufbauplänen..."
Karl Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Am 20. 4. mit Startschewski von Gloggnitz nach Wien
„Wir fuhren in das kleine Gebirgsstädtchen Gloggnitz, wo nach der
letzten Mitteilung Renner all diese Jahre leben sollte. Leo Hölzl
zeigte uns den Weg. Und tatsächlich, 75 km entfernt von Wien, fanden
wir Karl Renner in diesem kleinen Ort, gelegen im Wald, in den Bergen.
In einem kleinen Häuschen erblickten wir Renner selbst. Uns entgegen
kam ein hoher älterer Mann - 65 bis 70 Jahre alt mit grauem Kopf, mit
sorgfältigem, weißem Bärtchen. Zuerst war Renner erstaunt, und er
schien sogar beunruhigt über unsere Ankunft. Aber als wir ihm die
Einladung... des Marschalls Tolbuchin zu einer Audienz ausrichteten,
war er gerne bereit, mit uns zu fahren. Ich glaube, er erriet den Grund
dieser Einladung. Auf dem Weg nach Wien sprach er, dass nur er und
niemand anderer an die Spitze der österreichischen Regierung treten
kann, und fragte mich, ob man ihn diesbezüglich ruft. Ich erwiderte
aufrichtig, dass mir nichts bekannt ist. Unterwegs erzählte ich Dr.
Renner, dass ich einige seiner Werke gelesen habe, insbesondere das
Buch „Über die kulturelle Nationalautonomie"...Ich erinnere mich:
Renner war überrascht, dass ein Frontoffizier, und dazu ein russischer,
seine Werke kennen konnte. Nach einer Stunde und 45 Minuten fuhren wir
in Wien ein, und vor Renner flogen...brennende Häuser, gesprengte
Brücken... Renner fing zu weinen an."
Erinnerungsbericht von Oberst a.D. Jakow Startschewski
Erste Dreiparteien-Verhandlungen am 22. 4. in Wien
„Ich traf in Wien am 21. April 1945 ein und wurde in Hietzing, Lainzer
Straße 28 oder Wenzgasse 2 installiert. Die Auswahl des Hauses erfolgte
mit Rücksicht auf das wahrscheinliche Bedürfnis, daselbst größere
Besprechungen abzuhalten. Oberst Piterski... übernahm es auch, für den
nächsten Tag die führenden Persönlichkeiten der demokratischen Parteien
in die Wenzgasse zu bestellen. Als erster erschien Leopold Kunschak...
seine demokratische Gesinnung ist immer unbestritten gewesen... Die
erwähnte Konferenz der politischen Vertrauensmänner in der Wenzgasse
konnte nicht anders enden als mit dem einmütigen Beschluss aller
nichtfaschistischen Parteien, das, was in vielen Gemeinden schon
geschehen war, im ganzen Staate zu verwirklichen, ganz Österreich gegen
den Faschismus aufzurufen, die Wiedergeburt der demokratischen Republik
zu verkünden und die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs
wieder herzustellen. Es bedurfte kaum eines Wortes, um die einhellige
Entschlossenheit aller festzustellen... Die Besprechung war sich sofort
einig, „durch die Parteien sofort eine Provisorische Staatsregierung
einzusetzen, die österreichische Republik wieder als selbstständigen
Staat aufzurichten und ihm alle seine Behörden und Ämter neu zu
schaffen."
Renner, Denkschrift zur Unabhängigkeitserklärung

Die Renner-Villa
Die Villa wurde 1894 erbaut. Im Jahr 1910 erwarb Karl Renners Ehefrau
Luise diese um 14.000 Kronen von Frau Katharina Stobl. Karl Renner
suchte sich in „seinem" Neunkirchner Wahlkreis einen Wohnsitz, um von
hier aus 1911 seine Wiederwahl in das Abgeordnetenhaus des Reichrates
zu bestreiten. In diesem Wahlkreis wurde er bereits 1907 mit der
Einführung des allgemeinen gleichen Männerwahlrechts gewählt. Der
Ausbau der Mansarde erfolgte 1929/30. Die „Herzkammer" des Museums ist
die original erhaltene Bauernstube aus Zirbenholz. Sie wurde von Karl
Renner unmittelbar nach dem Villenankauf in Auftrag gegeben. Einen
Blickfang bildet das kunstvolle Glasfenster. In der Bauernstube spielte
Renner oft mit Freunden Bauernschnapsen und Schach. Ebenso fanden hier
regelmäßig Hausmusikabende statt. Die Stehlampe aus Eisen mit
Traubenmotiven war ein Geschenk zu Renners 80. Geburtstag.

Karl Renner wurde am 14. Dezember 1870 als 18. Kind von Maria und
Matthäus Renner in Unter-Tannowitz, dem heutigen Dolní Dunajovice,
geboren. Aus der Taufmatrik geht hervor, dass Karl einen
Zwillingsbruder namens Anton hatte, der jedoch schon bald gestorben
war. Renners Eltern waren verarmte Weinbauern. Die frühkindlichen
Erfahrungen von Armut und Mangel prägten Renners Leben und Weltsicht.
Trotz ärmlicher Verhältnisse absolvierte Renner die acht Stufen der
Volksschule in Unter-Tannowitz in nur fünf Jahren. Anschließend
besuchte er das Gymnasium in Nikolsburg, dem heutigen Mikulov. Anfangs
ging er die zwei Stunden Schulweg täglich hin und zurück. Er maturierte
im Schuljahr 1888/89. Als Klassenprimus erhielt er schließlich
„Freitische" und ein Stipendium. Es wurde ihm so auf Anraten der Lehrer
und Förderer der Weg zum Studium der Rechtswissenschaften in Wien
ermöglicht, das er 1896 erfolgreich abschloss.
Karl Renner lernte seine aus Güssing stammende Frau Luise (geb.
Stoisits) 1890 als Student in Wien kennen. Sie lebten zunächst im
„Konkubinat", bis sie im Jahr 1897 heirateten. Karl verdingte sich als
Hauslehrer und Luise als Stubenmädchen. Luise Renner war 1947
Mitbegründerin der „Volkshilfe Österreich". 1945 meinte Renner über
seine lange Beziehung zu ihr: „Und auch das ist ein Stückerl
Sozialismus, so wie ich ihn verstehe." Die Tochter Leopoldine wurde
1891 geboren. Sie erlernte mehrere Sprachen und genoss eine höhere
Bildung. 1913 heiratete Leopoldine den um dreizehn Jahre älteren
Zivilingenieur und Leiter der Hammerbrotwerke Hans Deutsch, der
jüdischen Glaubens war. Dieser Ehe entsprangen die Kinder Hans (1913),
Karl (1917) und Franziska (1920). Mit der Machtergreifung des
Nationalsozialismus in Österreich floh das Ehepaar Deutsch-Renner mit
ihren Kindern vor dem nationalsozialistischen Rassenwahn zunächst nach
England. Leopoldine kehrte 1939 zu ihren Eltern nach Österreich zurück,
Hans erst 1947. In der Villa lebten oft drei Generationen der Familie
Renner zusammen. Sie wurde 1978 nach dem Tod der Tochter (1977) von den
Enkelkindern an den von Bruno Kreisky initiierten Verein
„Dr.-Karl-Renner-Gedenkstätte" verkauft und ab 1979 als Museum genutzt.

Der Sozialdemokrat
Als Student in Wien wandte sich Karl Renner bei der Maifeier 1893 der
1888/89 gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu und wurde
schließlich ein Vertreter der österreichischen Denkschule des
„Austromarxismus". Ihn inspirierten die Ideen Ferndinand Lassalles und
ein Leben lang das Gedankengebäude Karl Marx'. In der praktischen
Politik bewies er sich mehr als humanistisch-demokratischer Reformer
denn als indoktrinärer Theoretiker. Renner wirkte in
sozialdemokratischen Studentenzirkeln. Er wandte sich der
Arbeiterbildung zu und engagierte sich ab 1903 in der ersten Wiener
Arbeiterschule „Zukunft". Im tiefen Glauben an das Recht des
Proletariats auf Gesundheit, Freizeit und Erholung verfasste er 1895
die Statuten der „Naturfreunde" und wurde so ihr Mitbegründer.
Besonders verbunden fühlte er sich der Genossenschaftsbewegung. Bereits
1911 wurde er mit kurzer Unterbrechung (zwischen 1919 und 1920) bis
1934 zum Obmann des Zentralverbands österreichischer Konsumvereine
gewählt. Im Jahr 1922 gründete Karl Renner die Arbeiterbank AG.
Nationalitätenfrage
Karl Renner wurde im Jahr 1895 Bibliothekar der Reichsratsbibliothek.
Er schuf sich so eine stabile materielle Basis und konnte sich der
Politik und seinem publizistischen Schaffen widmen. Als kaiserlicher
Beamter schrieb er oft unter Psyeudonym, um nicht seine Stelle zu
gefährden. Renner begann sehr früh, sich mit der nationalen Frage und
den nationalistischen Konflikten der Monarchie zu beschäftigen. Eine
Nation war für ihn eine Sprach-, Kultur- und Geschichtsgemeinschaft von
Personen und kein geschlossenes Siedlungsgebiet als einheitlicher
Nationalstaat. Karl Renner definierte deshalb ein Personalitätsprinzip.
Die nationale Autonomie sollte in der Verfassung verankert sein und die
kulturelle Autonomie vollständig an die Person gebunden werden. Renner
ging sogar so weit, dass er ein Bekenntnisprinzip, also eine freie
Nationalitätserklärung des Individuums, daran knüpfte. Ein
übernationaler Gesamtstaat war sein Ziel. Er strebte nach einer
grundlegend reformierten Habsburgermonarchie als „demokratische Schweiz
im Großen mit monarchischer Spitze".
Das Arbeitszimmer stammt aus
Renners Wohnung in der Taubstummengasse in Wien. Dort wohnten nach
Renners Tod weiterhin seine Witwe Louise und Tochter Leopoldine.
Nachdem auch Louise Renner gestorben war, zog sich Leopoldine
Deutsch-Renner nach Gloggnitz zurück. Das Wiener Arbeitszimmer kam als
zentrales Schaustück für eine Gedenkstätte in die Verwaltung des
Konsumverbandes in Wien. Seit 1979 wurde es Teil des Renner-Museums.
Die schweren Tapeten und Vorhänge wurden der Wiener Wohnung
nachempfunden. Die Vase mit den Metallrosen widmeten Renner Arbeiter
der Schoeller-Bleckmann in Ternitz. Den Lehnsessel erhielt er vom
Bundesmobiliendepot zum 80. Geburtstag.

Krieg und Zerfall
Die Sozialdemokratische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung in Europa
hatte sich von Anfang an als internationalistisch verstanden und trat
pazifistisch auf. Mit Kriegsbeginn 1914 scheiterte diese Haltung und
spaltete sie in Kriegsgegner und Kriegsbefürworter. Für Karl Renner war
der Weltkrieg eine Epochenwende und im Moment des Ausbruchs nicht zu
verhindern. Der Krieg führe zur „Durchstaatlichung der Wirtschaft"
sowie zur „Verwirtschaftung der Staatsgewalt" und sei somit eine
Vorbereitung für den Sozialismus. Dies hielt er für die wirtschaftliche
Basis eines anzustrebenden friedlichen Weltstaats. Sein 1917
erschienenes Werk „Marxismus, Krieg und Internationale" brachte ihm den
Vorwurf des „Kriegssozialismus" ein. Renner versuchte das
Vielvölkerreich als übernationalen Staat durch Demokratisierung,
Verwaltungsreform und Abschaffung der Kronländer zu retten. Als im
Oktober 1918 klar war, dass der Krieg das marode Reich zerstört, wurde
er zur strukturierenden und treibenden Kraft der Republiksgründung.
Republiksgründung
Im Chaos des Zerfalls der Monarchie wurde Karl Renner auf Grund seines
Rufs, ein strukturierter Denker und Praktiker sowie ein
kompromissbereiter Brückenbauer zu sein, am 21. Oktober 1918 zum
Staatskanzler. Er zeichnete für den „Entwurf des Beschlusses über die
grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt" vom 30. Oktober und für
das „Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich"
vom 12. November verantwortlich. Er forcierte das allgemeine gleiche
Männer- und Frauenwahlrecht und die so genannten „Habsburgergesetze".
Schließlich leitete er auch die Delegation bei den
Friedensverhandlungen in Saint-Germain-en-Laye. Nach der Wahl zur
Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 führte Renner
bis zum Juli 1920 eine Koalition zwischen Sozialdemokratischer
Arbeiterpartei und Christlichsozialer Partei an. Nach dem diese
zerbrochen war, schrumpfte schrittweise die Kompromiss- und
Kooperationsbereitschaft zwischen den politischen Lagern.

Antisemitismus
Die rücksichtslose Kriegsführung im Ersten Weltkrieg machte in seinem
Verlauf 13 Millionen Menschen in Europa zu Flüchtlingen. In
Österreich-Ungarn waren es ca. 1,5 Millionen. Im Zuge der
Grenzziehungskriege 1918/19 kam es in Polen und in der Ukraine zu
Pogromen gegen jüdische Minderheiten. Zu den Kriegs- kamen nun auch
Pogromflüchtlinge. Diese flohen als Staatsangehörige der
Habsburgermonarchie in die mittellose und hungernde Republik
Deutschösterreich. Die rund 30.000 „ostjüdischen" Geflüchteten in
Ostösterreich wurden politischer Spielball und agitatorisches
Instrument für antisemitische Hetze. Organisationen wie der
„Anti-Semitenbund" (1919) wurden gemeinsam von christlichsozialen und
deutschnationalen Politikern gegründet. Beide Parteien hatten den
Antisemitismus als ideologisches Versatzstück in ihren Parteiprogrammen.
Der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich - Albert
Sever - versuchte im September 1919 per Erlass, alle Flüchtlinge ohne
„Heimatrecht" des Landes zu verweisen. Die christlichsozialen
Forderungen, Jüdinnen und Juden bei Volkszählungen als „eigene Rasse"
zu führen und „Konzentrationslager" für jüdische Flüchtlinge zu
schaffen, radikalisierten ebenso die Debatte. Bei der ersten
Nationalratswahl im Oktober 1920 gelang es den bürgerlichen Parteien,
den Antisemitismus zum wahlentscheidenden Thema zu machen. 1921 wurde
Jüdinnen und Juden schließlich auf Betreiben der Deutschnationalen die
österreichische Staatsbürgerschaft verwehrt, da sie „rassisch" keine
„Deutschen" seien. Dieser rigide Antisemitismus blieb als schweres
innenpolitisches Erbe zurück und war fruchtbarer Boden für die spätere
nationalsozialistische Agitation.
Ende der Demokratie
Karl Renner widmete sich nach dem Ausscheiden aus der Regierung 1920
intensiv der Arbeit im Nationalrat, seiner Vortragstätigkeit und der
Genossenschaftsbewegung. In der Sozialdemokratie vertrat er eine
moderate Linie der Reform, des Ausgleichs und der Kooperation mit
anderen Parteien. Im Schatten der Weltwirtschaftskrise Anfang der
1930er Jahre wuchs die Gefahr eines Bürgerkrieges. Bis an die Grenzen
der Selbstaufgabe gehend, versuchte Renner diese Eskalation mit
Kompromissbereitschaft zu durchbrechen. Am 4. März 1933 trat Karl
Renner als Erster Präsident des Nationalrats im Zuge einer
parlamentarischen Auseinandersetzung zurück. Seine beiden
Stellvertreter folgten ihm. Die damit verbundene Geschäftsordnungskrise
des Parlaments wurde vom christlichsozialen Bundeskanzler Engelbert
Dollfuß genutzt, um die junge österreichische Demokratie schrittweise
zu beseitigen. Nach den Ereignissen des Bürgerkrieges im Februar 1934
errichtete er ein autoritäres System nach faschistischem Vorbild. Karl
Renner wurde am 12. Februar 1934 verhaftet und hundert Tage in Wien in
Arrest gehalten.

Ende des Staates
Als der junge österreichische Staat am 12. März 1938 im
nationalsozialistischen Deutschland unterging, sprach sich Karl Renner
in einem Interview für den „Anschluss" aus. Die Vereinigung mit dem
großen deutschen Wirtschaftsraum und der deutschen Republik war seit
1918 ein wiederkehrendes politisches Ziel geworden.
Renner selbst betonte stets, ohne Zwang und aus Überzeugung gehandelt
zu haben. In einem Artikel in der britischen Zeitschrift „World Review"
im Mai 1938 argumentierte Renner, dass sich jetzt nur vollziehe, was in
Saint-Germain-en-Laye illegitimer Weise durch die Siegermächte
verhindert worden war. Es sei schlimm für ihn, dass dies nun unter den
diktatorischen Vorzeichen eines „unfassbaren Rassenregimes" und nicht
wie 1918 demokratisch geschehe. Renner meinte: „Staaten bleiben, aber
Systeme wechseln". Dieser Logik folgend, würdigte er in einer
unveröffentlichten sehr problematischen Broschüre ebenso das von
Großbritannien und Frankreich unterzeichnete Münchner Abkommen vom 29.
September 1938 als Großtat. Er legitimierte somit die Zerstörung der
Tschechoslowakei. Vom Nationalsozialismus und seinen Methoden
distanzierte er sich stets eindeutig. Die Zeit während des Zweiten
Weltkriegs verbrachte er zurückgezogen in Gloggnitz.

Wiedererrichtung
Das Dritte Reich lag in den letzten Zügen und die Rote Armee erreichte
am 29. März 1945 ehemals Österreichisches Territorium. Karl Renner bot
den Sowjets am 2. April 1945 in Hochwolkersdorf seine Mitarbeit am
demokratischen Wiederaufbau Österreichs an. Stalin signalisierte Renner
Unterstützung. Dieser agierte von Schloss Eichbüchl aus bereits wie ein
voll amtierender Kanzler. Vielfach konnte er auf seine Erfahrungen aus
dem Jahr 1918 zurückgreifen. In Wien traf Renner auf die
reorganisierten Parteien. Am 27. April 1945 bildete er mit der ÖVP, der
SPÖ und der KPÖ eine Konzentrationsregierung und wurde erneut zum
Staatskanzler. Gleichzeitig wurde Österreichs Unabhängigkeit
proklamiert - mit dem Ziel der Wiedererrichtung der Österreichischen
Republik im Geiste der Verfassung von 1920. Renner überwand das
Misstrauen zwischen den Parteien und gewann das Vertrauen der
westlichen Alliierten. Ihm gelang die Durchsetzung österreichweiter
demokratischer Wahlen bereits für November 1945. Seine Fähigkeit,
politische Vision und pragmatischen Realitätssinn strategisch-wendig zu
vereinen, retteten die Einheit Österreichs.
Mit der Bildung der ersten Konzentrationsregierung unter der Führung
Karl Renners am 27. April 1945 wurde auch Österreichs Unabhängigkeit
proklamiert (o.). Jenes Land, das laut Moskauer Deklaration der
Alliierten aus dem Jahr 1943 das erste Opfer von Hitlers
Angriffspolitik gewesen war. Das in der Deklaration geforderte
Bekenntnis Österreichs an der Mitverantwortung am Krieg war in der
Unabhängigkeitserklärung noch enthalten. Zunächst aus strategischen
Gründen, um auf Sicht die völlige Souveränität wiederzuerlangen, wurde
ein Geschichtsbild ins Leben gerufen, das Österreich ausschließlich als
Opfer sah. Auch die Konflikte der Ersten Republik und die
Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus wurden
ausgeblendet. Bewusst zaghaft wurden die österreichischen
Kriegsverbrecher verfolgt. Der Umgang der Bundesregierung und anderer
maßgeblicher Institutionen mit dem Schicksal der jüdischen Opfer und
Vertriebenen erfolgte absichtlich ignorant bis abweisend und bleibt ein
Schatten auf der erfolgreichen Wiedergründung der Republik Österreich.

DIE HABSBURGERMONARCHIE - Völkerkerker oder Versuchsstation für den übernationalen Staat?
Das Habsburgerreich war ein seit dem Mittelalter gewachsenes
Länderkonglomerat und Ergebnis vormoderner dynastischer Politik. In den
großen Staaten Westeuropas vollzog sich mit der Herausbildung
zentralistischer Verwaltungsstaaten, der Industrialisierung und der
Entwicklung neuer Alltagskulturen ein umfassender
Modernisierungsprozess. Dieser passte durch vielseitige
Vereinheitlichungen die Sprachgrenzen den Landesgrenzen an. Dadurch
entstand die Vorstellung, eine „Nation" umfasse in erster Linie ein
gemeinsames Territorium und in diesem ließe sich sozialer Zusammenhalt
nur über gemeinsame Abstammung bzw. Tradition und kulturelle
Übereinstimmungen herstellen.
Im Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie verstand sich im späten 19.
Jahrhundert „Nation" nur als „Sprachnation". Weder die historischen
politischen Einheiten noch die religiösen Trennlinien erwiesen sich als
nationenbildend. So beherbergte das Land zehn große „Nationalitäten":
Deutsch- (23,4%), Ungarisch- (19,6%), Tschechisch- (12,5%), Polnisch-
(9,7%), Kroatisch- und Serbisch-(8,5%), Ruthenisch- (7,8%), Rumänisch-
(6,3%), Slowakisch- (3,8%), Slowenisch-(2,4%) und
Italienisch-Sprechende (1,5%); dazu weitere 4,5% der Bevölkerung, die
sich zu keiner der „landesüblichen Sprachen" der Monarchie bekannten.
Komplexe Konflikte zwischen den verschiedenen Nationalitäten um den
Erhalt von Vorrechten bzw. um kulturell-politische Gleichstellung auf
allen gesellschaftlichen Ebenen bestimmten das Geschehen. Brennpunkte
waren Auseinandersetzungen um das Schulwesen und die Amtssprachen. Oft
verknüpften sich wirtschaftliche und soziale Spannungen mit
nationalistischen Gegensätzen.
Die Ideologie des Nationalismus mit ihrer Vorstellung von Homogenität
und Einsprachigkeit betonte die kulturellen Unterschiede zwischen den
Merischen. Das Gemeinsame des gedeihlichen vielsprachigen Alltagslebens
und des vielfältigen innovativen Kulturschaffens in der Monarchie wurde
überblendet. Die Reformunwillig- und Reformunfähigkeit des
Herrscherhauses verstärkten die zahlreichen Konflikte. Die wachsende
Heftigkeit der Auseinandersetzungen und schließlich der Erste Weltkrieg
führten dazu, dass die verschiedenen Nationalitäten die Lösung ihrer
Probleme außerhalb der staatlichen Ordnung der Donaumonarchie suchten.
Deren endgültiger Zerfall 1918 beseitigte jedoch viele der nationalen
Konflikte in den Nachfolgestaaten nicht.
Die Republik Deutschösterreich:
Alle deutschsprachigen Abgeordneten des letzten 1911 gewählten
Reichsrates traten in Wien zur Provisorischen Nationalversammlung für
Deutschösterreich zusammen und riefen am 12. November 1918 die Republik
aus. Das Staatsgebiet der neuen Republik sollte im Sinne des
„Selbstbestimmungsrechts der Völker" alle deutschsprachigen Gebiete der
österreichischen Reichshälfte umfassen. Sie sehen eine Karte der
Republik Deutschösterreich.
Der „Anschluss" an die junge Weimarer Republik war allgemeines Ziel,
wurde jedoch von den Siegermächten durch ein „Selbstständigkeitsgebot"
untersagt. Was blieb, war eine Identitätskrise und ein nur schwacher
Grundkonsens über den Sinn und die Ausgestaltung des neuen Gemeinwesens
der Republik Österreich.
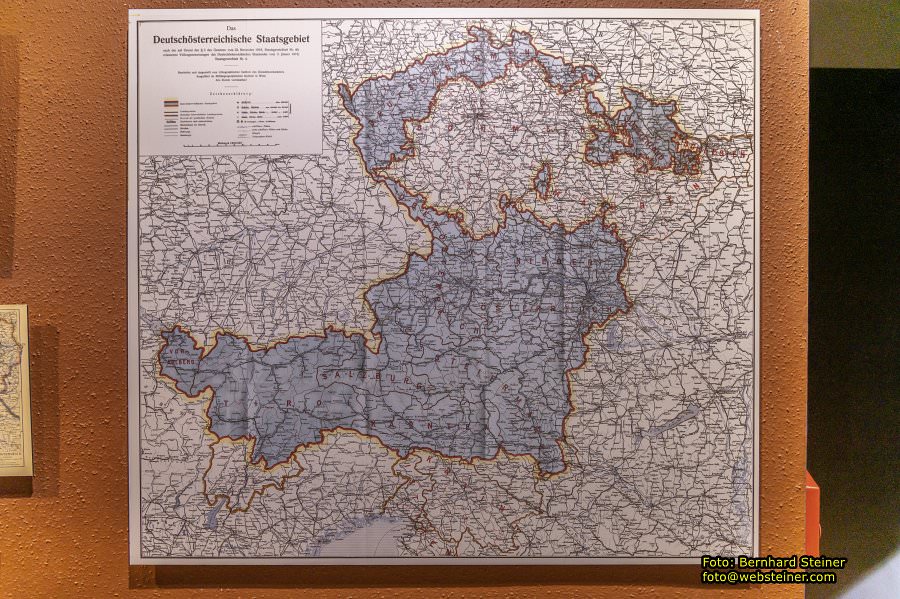
Allgegenwärtig war auch der Antisemitismus. Bei der Nationalratswahl
1920 wurde er radikal als Wahlpropaganda eingesetzt, wie das
christlichsoziale Wahlplakat eindringlich zeigt. So verweigerte die
bürgerliche Regierung 1921 ca. 75.000 aus den Nachfolgestaaten
zugewanderten deutschsprachigen Juden und Jüdinnen die
Staatsbürgerschaft, da sie nicht als „deutsch" galten.
Das deutschnationale Wahlplakat aus dem Jahr 1919 symbolisiert die
weitverbreitete und intensive Betonung des „Deutschseins" Österreichs.
Dies reichte von demokratischen, kulturromantischen und
wirtschaftspolitischen bis hin zu völkisch-rassistischen Motiven.

Spottgedicht „Ernährungsglaube":
„Ich glaube an den Herrn Ernährungsminister, an die allein selig
machende Mairübe, die Ernährung der rayonierten Volksmassen. Ich glaube
an die stammverwandte Runkel- und Steckrübe, empfangen von dem heiligen
Ernährungsamte, gelitten unter der Zentral-Einkaufsgenossenschaft,
gesammelt, gepreßt und verdorben, zur Erde niedergefallen, am dritten
Tage auferstanden als Marmelade, von dannen sie kommen wird als
Erfrischungsmittel für die in langen Reihen angestellten Hungerleider.
Ich glaube an den heiligen Profit und Rebbach, an die allgemeine
Wuchergemeinschaft der Hamsterer, Erhöhung der Steuern, Verteuerung des
Fleisches und an den ewigen Kriegszustand. Amen."
„Apostolikum" von Josef Redlich, 1918.
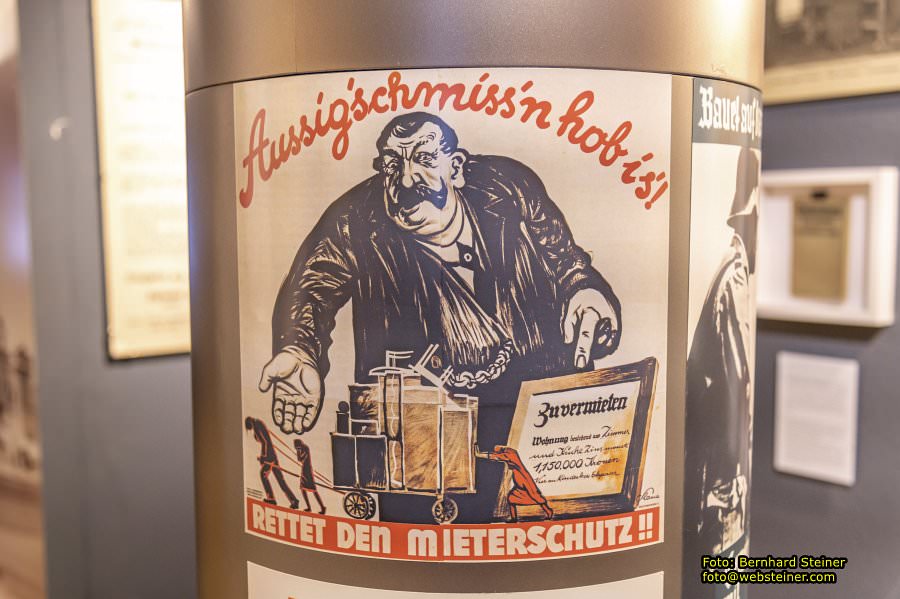
Firmenschild oder Staatswappen?
Die junge Republik suchte Staatssymbole für sich. Bereits 1918 wurde
ein Emblem gesucht, „das die Hauptstände der Gesellschaft, Bürger,
Bauer und Arbeiter symbolisch darstellt und in der Wahl der Farben
schwarz, rot und gold die nationale Zusammensetzung der Republik
Deutschösterreich versinnbildlicht."
Alle Entwürfe erinnerten zu sehr an „moderne Firmenzeichen". Daher
wurde im Mai 1919 auf den zunächst als monarchisch abgelehnten Adler
zurückgegriffen. Die Ständesymbole blieben leicht verändert und die
großdeutschen Farben stark reduziert erhalten - bis heute.

DIE ERSTE REPUBLIK - Ein Staat zwischen zwei Katastrophen
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrte in weiten Teilen Europas 1918
kein Frieden ein: Revolutionen und Konterrevolutionen, Bürgerkriege,
Verfolgung bzw. Vertreibung ethnischer und religiöser Minderheiten und
blutige Grenzziehungskriege zwischen den neu entstehenden
Nationalstaaten prägten das chaotische Bild. Fast zehn Millionen
Menschen in Europa wurden zu Flüchtlingen. Althergebrachte Ordnungs-
und Autoritätsvorstellungen zerbrachen. Radikale Sehnsucht nach alles
umstürzender Neuordnung der Gesellschaft und fundamentale Angst davor
standen sich gewaltbereit gegenüber.
Im Sinne des Selbstbestimmungsrechts der Völker sollte aus allen
deutschsprachigen Teilen der österreichischen Reichshälfte die Republik
Deutschösterreich entstehen. Die Vereinigung mit Deutschland war
allgemeines Ziel. Der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye schlug jedoch
viele Gebiete den neuen Nachbarstaaten zu und untersagte den
„Anschluss". Der vermeintliche „Rest" - die Republik Österreich -
erschien vielen als ein „Zwergstaat" ohne nationale Identität und
wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Dennoch wurden in den Jahren des
Umbruchs eine parlamentarische Demokratie und ein moderner Rechts- und
Sozialstaat etabliert. Auch in Belangen der Wissenschaft und Kultur
erwarb sich die junge Republik ihre Verdienste. Zwei große politische
Lager waren bestimmend: Die Christlichsoziale Partei repräsentierte den
politischen Katholizismus und das besitzende Bürger- und Bauerntum. Sie
orientierte sich an einem vormodernen Ideal einer gottgewollten
ständischen Ordnung und der katholischen Soziallehre. Die
Sozialdemokratie hingegen stand für die modernistische Veränderung
aller Lebensbereiche im Sinne des Proletariats und die demokratische
Überwindung des Kapitalismus mit dem Ziel des Sozialismus. Im Schatten
der nicht zu bändigenden Weltwirtschaftskrise zweifelten immer mehr
Menschen an der Demokratie. Ein Teil des bürgerlich-bäuerlichen
politischen Spektrums begann die Errichtung eines autoritären Regimes
anzustreben. In den radikaler werdenden Auseinandersetzungen erwuchs
als dritte Kraft der Nationalsozialismus. Dieser gewann ab den 1930er
Jahren durch wachsende Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und
Ordnungssehnsucht breiter verunsicherter Gesellschaftsschichten immer
mehr Rückhalt in der Bevölkerung.
Die Beseitigung des Parlaments, Verfassungsbruch, Einschränkung der
Bürgerrechte und schließlich ein Bürgerkrieg zwischen christlichsozial
geführter Regierung und oppositioneller Sozialdemokratie waren Etappen
auf dem Weg zur gewaltsamen Errichtung einer an ständisch-klerikalen
und faschistischen Ideen orientierten Diktatur. 1934 war somit die
junge österreichische Demokratie beseitigt. Nach der Annexion
Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland 1938
verschwand unter Zustimmung von großen Teilen der Bevölkerung
schließlich auch der österreichische Staat.
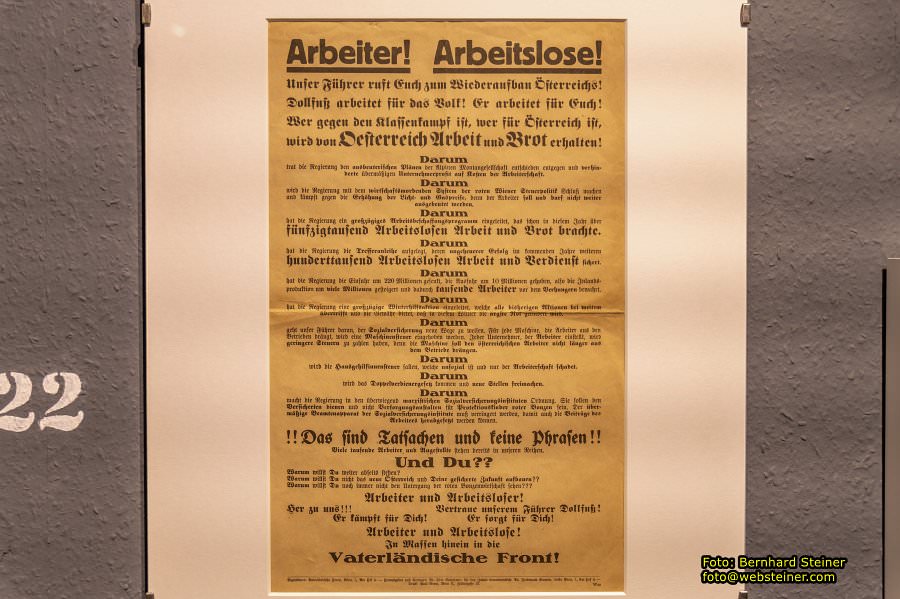
Blut auf den Straßen: Seit 1920 standen sich stets eine bürgerliche
Regierung und eine oppositionelle Sozialdemokratie gegenüber.
Demokratische Regierungswechsel kamen nicht vor. Gewalt war Teil des
politischen Lebens in der Ersten Republik. Im Jänner 1927 wurde in
Schattendorf ein sozialdemokratischer Demonstrationszug von
antidemokratischen „Frontkämpfern" beschossen. Zwei Tote waren zu
beklagen. Die Schützen wurden in Wien bei einem Schwurgerichtsprozess
am 15. Juli 1927 freigesprochen. Es folgten Demonstrationen mit
schweren Ausschreitungen und einem drastischen Polizeieinsatz mit 89
Toten. Diese Ereignisse waren für viele die Vorboten eines Bürgerkriegs.
Bürgerkrieg und Diktatur: Teile der Regierung erwägten immer offener
die Errichtung einer Diktatur als Option zur „Lösung" der Probleme der
Republik. Eine Politik der Deflation, des Sparzwanges und der
Lohnkürzungen verschärfte die wirtschaftliche Situation und die soziale
Lage weiter Teile der Bevölkerung. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß
orientierte sich am faschistischen Italien und stärkte die Heimwehren,
um die parlamentarische Demokratie zu beseitigen und autoritär regieren
zu können. Nach kurzem blutigen Bürgerkrieg wurde mit der sogenannten
„Mai-Verfassung" 1934 die junge österreichische Demokratie durch die
bürgerliche Regierung endgültig gewaltsam beseitigt.
Engelbert Dollfuß wurde im September 1933 am Cover des Time-Magazines abgebildet.

Begeistert untergehen: Nach der Annexion Österreichs durch das
nationalsozialistische Deutschland im März 1938 verschwand unter
begeisterter Zustimmung von Teilen der Bevölkerung der österreichische
Staat. Im April 1938 fand eine Volksabstimmung statt, deren Regeln und
Ablauf allen demokratischen Grundsätzen widersprachen. Dabei votierten
offiziell 99,73% der österreichischen und 99,08% der deutschen
Bevölkerung für den „Anschluss". Eine Propaganda- und Gewaltwelle
erfasste das Land. Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung und
Andersdenkende folgten der Deutschen Wehrmacht auf dem Fuß.
Hellsichtige erkannten die verheerenden Ausmaße nationalsozialistischen
Denkens. Wir zeigen eine französische Propagandapostkarte aus dem Jahr
1939: „Hitlers Traum".
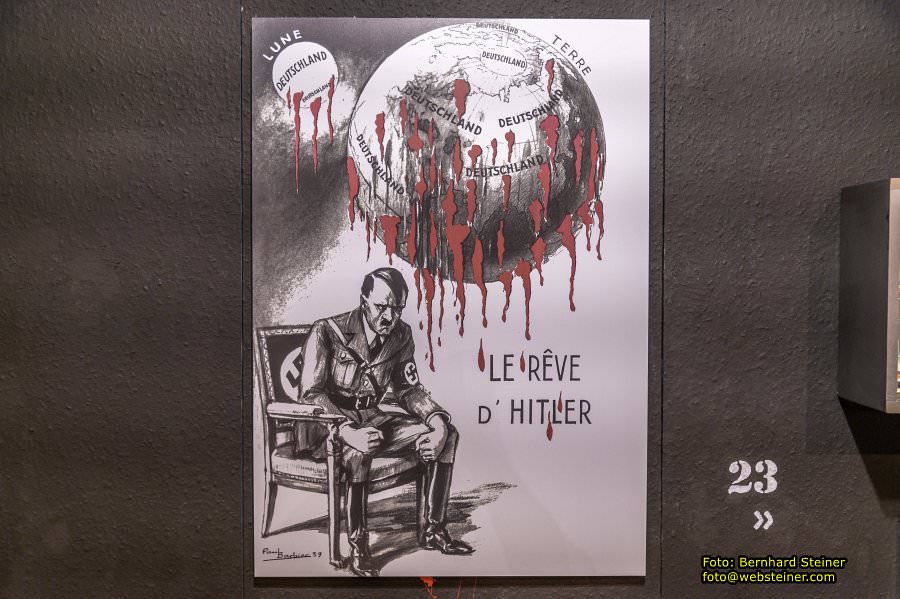
Von alten Hüten und Elefanten: Die erste Nationalratswahl in der
wiedererrichteten Republik fand am 25. November 1945 statt. Sie wurde
von der ÖVP unter Leopold Figl mit dem Erreichen einer absoluten
Mandatsmehr heit klar gewonnen. Die SPÖ unter Staatskanzler Karl Renner
unterlag. Die KPÖ blieb deutlich hinter den Erwartungen. Von dieser
Wahl waren rund 500.000 ehemalige Mitglieder der NSDAP und der
NS-Wehrverbände ausgeschlossen. Die ÖVP setzte im Wahlkampf auf die
Themen „Freiheit" und „Zukunft" mit starkem Österreich-Bezug. Die SPÖ
thematisierte die Vergangenheit des Austrofaschismus und
Nationalsozialismus; auf den Wahlplakaten symbolisiert durch „alte
Hüte".
Karl Renner prägte das Bild der vier Besatzungsmächte als vier
Elefanten, die im kleinen Ruderboot Österreich Platz genommen haben.
Oberste strategische Ziele waren die Etablierung einer stabilen
demokratischen und wirtschaftlichen Ordnung und eben das Erreichen der
völligen Unabhängigkeit.

Das Kriegsende: Für die US-amerikanischen Truppen in Übersee wurde eine
eigene „Pony-Edition" des Time Magazines herausgegeben. Die Ausgabe vom
7. Mai 1945 hatte ein ikonisches Coverbild, das Hitlers Tod
verlautbarte. Die Umstände seines Ablebens blieben länger ungewiss und
so wurde er erst am 25. Oktober 1956 durch das Amtsgericht
Berchtesgaden offiziell für tot erklärt.
Am 14. Mai 1945 titelte das Magazin mit „The big three - One job done"
und verkündete so das Kriegsende in Europa. Am 8. Mai 1945 trat die
bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht in Kraft. In Asien
endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Japans
am 15. August 1945. Dieser gingen die zwei verheerenden
US-amerikanischen Atombombenabwürfe in Hiroshima und in Nagasaki voraus.

DIE ZWEITE REPUBLIK - Erfolgsgeschichte zwischen West und Ost und zwischen Einsicht und Verdrängung
Die Folgen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs waren
verheerend. 247.000 Österreicher waren als Soldaten in der Deutschen
Wehrmacht gefallen oder blieben vermisst. Die Zivilbevölkerung hatte
ca. 24.000 Opfer durch Bombenangriffe und Kriegshandlungen auf
österreichischem Territorium zu beklagen. Durch politische Verfolgung
waren etwa 32.000 Österreicher/innen gestorben. Rund 65.000
österreichische jüdische Mitbürger/innen waren ermordet worden, rund
120.000 konnten fliehen oder wurden vertrieben. Der materielle Schaden
durch Annexion und Krieg wird mit circa 11,6 Milliarden Euro beziffert.
Zum Vergleich: Das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) des
Jahres 1950 betrug 3,8 Milliarden Euro. Die Aussage Karl Renners als
Bundespräsident im Jahr 1950 „Wir Österreicher glauben an uns", wirkt
in diesem Zusammenhang wie eine beschwörende Formel der Hoffnung
inmitten eines zerstörten und von den vier Siegermächten besetzten
Landes.
Um sich von der konflikt- und gewaltbeladenen Ersten Republik
abzuheben, wurde ein demokratischer Grundkonsens und eine breite
Kooperation der beiden großen politischen Lager - SPÖ und ÖVP -
geschlossen. Proporz und Konkordanz bildeten in den staatlichen
Institutionen und der politischen Praxis zentrale Säulen. Unterstützt
vom US-amerikanischen European Recovery Program (ERP) gelang der
wirtschaftliche Wiederaufbau Österreichs. Zum friedlichen Ausgleich der
Interessengegensätze zwischen Arbeit und Kapital gründete sich die
Sozialpartnerschaft. Aus Österreich wurde eine erfolgreiche Demokratie,
Wohlstandsgesellschaft und Volkswirtschaft. Schrittweise etablierte
sich ein starkes Österreich- und Demokratiebewusstein unter weiten
Teilen der Bevölkerung.
Das BIP betrug im Jahr 1960 bereits 11,8 und im Jahr 1980 76,4
Milliarden Euro. 1965 besaßen von hundert Haushalten 30 einen eigenen
Fernseher und 33 einen eigenen PKW. 1985 konnten bereits 87 Haushalte
einen Fernseher und 90 einen PKW ihr Eigen nennen. Die politisch
erfolgreichen Großparteien repräsentierten fast gänzlich die
österreichische Bevölkerung, was sich 1975 in 93,3 Prozent der
Wähler/innenstimmen für SPÖ und ÖVP und einer Wahlbeteiligung von 91,9
Prozent ausdrückte. Begünstigt wurden Österreichs Unabhängigkeit und
Aufstieg durch seine geografische Lage zwischen „Ost" und "West" im
entstehenden „Kalten Krieg" und durch eine expandierende
Weltwirtschaft. Die Konflikte der Ersten Republik und die
Mitverantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus wurden
jedoch ausgeblendet. Ein Geschichtsbild, das Österreich ausschließlich
als Opfer sah, wurde gepflegt.
VEREINIGTES EUROPA? Eine historische Lernprovokation
Der Erste Weltkrieg wurde begonnen, ohne die Folgen der modernen
industrialisierten Kriegsführung klar abschätzen zu können oder zu
wollen. Die Illusion eines kurzen Krieges erwies sich als falsch, mit
katastrophalen Folgen. Der europäische Krieg wuchs sich zu einem
Weltkrieg aus und trug Züge eines totalen Krieges: die Mobilisierung
aller zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Kontrolle von Wirtschaft
und Gesellschaft, die Radikalisierung der Kriegsziele sowie die
Ausuferung der Gewalt. Im Krieg starben rund 9,6 Millionen Soldaten.
Unter der Zivilbevölkerung gab es 5,6 Millionen Opfer. 20 Millionen
Menschen wurden verletzt. Materieller und wirtschaftlicher Schaden sind
kaum in Zahlen zu bemessen, erst recht nicht das menschliche Leid. Die
Gewalterfahrungen an der Front und das Elend hinter der Front ließen
Millionen Menschen als psychisch und/oder physisch invalid zurück und
bereiteten den Boden für totalitäre Ideologien. Der Zweite Weltkrieg
steigerte die Dynamik der Zerstörung. Industrialisierter Massenmord,
systematische Kriegsverbrechen und millionenfache Vertreibung
eröffneten neue Dimensionen kriegerischer Gewalt. Für die durch direkte
Kriegseinwirkung und -verbrechen Getöteten werden Schätzungen bis zu 71
Millionen weltweit angegeben, davon mehr als die Hälfte zivile Opfer.
Der europäische Kriegsschauplatz forderte mit rund 40 Millionen Toten
den höchsten Blutzoll.
Diese Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten bei der
Mehrheit der politischen sowie wirtschaftlichen Eliten und bei weiten
Teilen der Bevölkerung zu einer „historischen Lernprovokation" (Oskar
Negt). Die Bereitschaft zu Frieden und gemeinsamem Wiederaufbau
unterschied 1945 von 1918. Die Etablierung stabiler rechtsstaatlicher
Einrichtungen, parlamentarischer Demokratien und sozialstaatlicher
Marktwirtschaften waren die Lehren aus den Katastrophen. Die Vision
eines friedlichen vereinten Europas fußte auf den Erfahrungen des
Krieges. Der französische Außenminister Robert Schuman schlug im Mai
1950 die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
vor und proklamierte: „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage
herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird
durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der
Tat schaffen." Der Grundstein zur europäischen Vereinigung war gelegt.
Geraten diese schmerzhaften Ursprungsquellen der Vision eines vereinigten Europas in Vergessenheit?
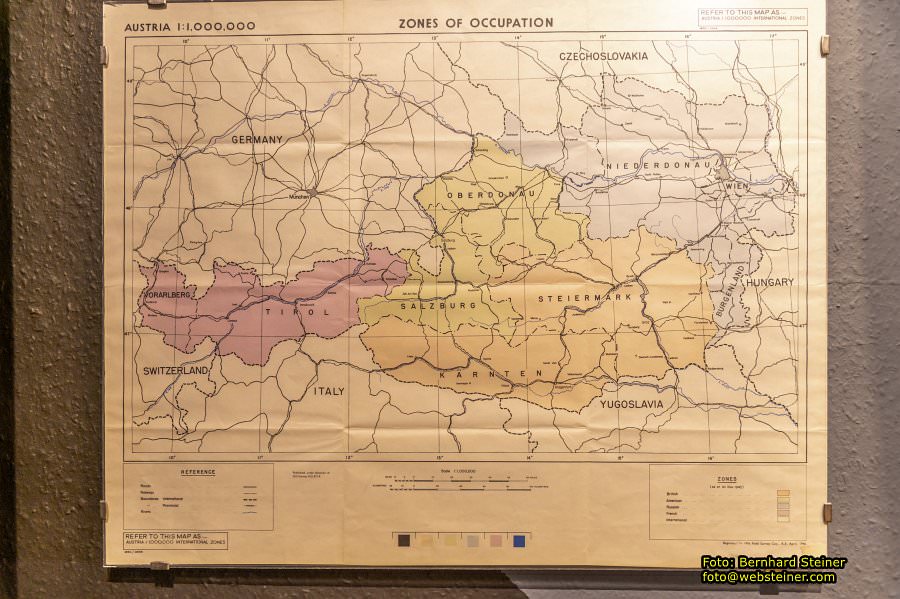
Pionierinnen
1918 die erste Gemeinderätin in NO: Marie Brunner (SDAP)¹, Baden bei Wien
1919 die ersten Frauen als Abgeordnete:
Anna Boschek (SDAP)
Hildegard Burjan (CSP)2
Emmy Freundlich (SDAP)
Adelheid Popp (SDAP)
Gabriele Proft (SDAP)
Therese Schlesinger (SDAP)
Amalie Seidel (SDAP)
Maria Tusch (SDAP)
1927 die erste Vorsitzende des Bundesrates:
Olga Rudel-Zeynek (CSP)
1945 die erste Frau in der Bundesregierung: Helene Postranecky (SDAP/KPÖ)
1948 die erste Bürgermeisterin: Kreszentia Hölzl (SPÖ), Gloggnitz
1966 die erste Bundesministerin: Grete Rehor (ÖVP)
1996 die erste Frau Landeshauptmann: Waltraud Klasnic (ÖVP), Steiermark
2006 die erste 1. Präsidentin des Nationalrats: Barbara Prammer (SPÖ)
2017 die erste Landshauptfrau in NÕ: Johanna Mikl-Leitner (ÖVP)
Die erste Bürgermeisterin:
Kreszentia „Zenzi" Hölzl (1893-1958) arbeitete in der Tabaktrafik in
Gloggnitz, die ihr Mann als Kriegsinvalide des Ersten Weltkrieges
erhalten hatte. In der Zeit des Austrofaschismus war die Trafik ein
Treffpunkt illegaler sozialdemokratischer Aktivisten und Aktivistinnen.
Von 1945 bis 1949 war Hölzl Abgeordnete im niederösterreichischen
Landtag. Im Jahr 1948 wurde sie Bürgermeisterin in Gloggnitz und war
damit die erste Bürgermeisterin Österreichs. Sie übte dieses Amt bis
1958 aus. In ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin setzte sie sich für die
Erbauung des Alpenbades Gloggnitz ein, errichtete eine
Mutterberatungsstelle und forcierte die Erneuerung der Wasserversorgung.
Das Gemälde wurde vom hiesigen Maler Franz Trimmel angefertigt. Er
ergänzte seine Politiker/innenportraits gerne mit bekannten Werken von
Karl Renner.

Ein vorläufiges Schlusswort: Kaum eine andere österreichische
politische Führungspersönlichkeit ist so eng mit den Zusammen-, Um- und
Aufbrüchen der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
verwoben wie Karl Renner; verwoben mit der Anerkennung ihrer großen
historischen Leistungen wie mit der Verantwortung für ihre historischen
Fehlleistungen. Hochverehrt und scharf kritisiert polarisiert er bis
heute. Zunächst fasziniert er als visionärer Theoretiker mit
langfristigen Zielorientierungen. Auch beeindruckt er als
volksverbundener populärer Politiker, der Menschen gewinnen konnte,
wobei sein Entgegenkommen gegenüber Volkes Meinung sehr weit gehen
konnte. Ebenso galt er als Tagesrealpolitiker des Ausgleichs und des
Kompromisses, jedoch mit der Bereitschaft, dafür seine politischen und
persönlichen Grenzen des Tolerierbaren sehr weit zu ziehen. Alles in
allem bleibt er jenseits aller Heils- und aller
Verdammungsgeschichtsschreibung eine epocheprägende politische
Ausnahmerscheinung und eine typisch österreichische Gestalt, mit allem
Drum und Dran.
Karl Renner, Totenmaske, abgenomme von Johann Berger im Auftrag von Gustinus Ambrosi, 1950
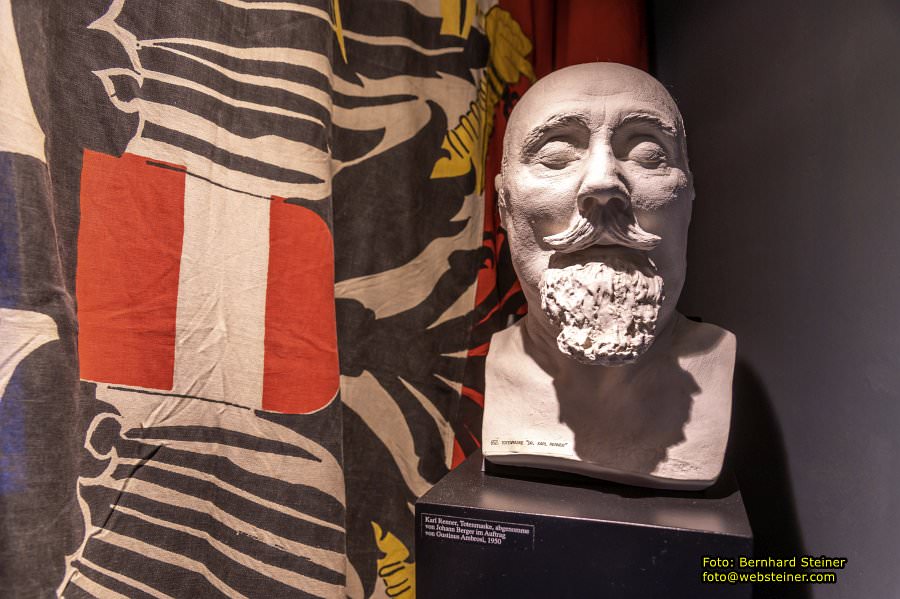
Renner-Linde - Zur Erinnerung an den bedeutenden Staatsmann Dr. Karl
Renner; gepflanzt von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer am 2. April 2005

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: