web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Volkskundemuseum am Paulustor
in Graz, Dezember 2022
Das Volkskundemuseum am Paulustor nimmt mit seiner
Dauerausstellung "Welten – Wandel – Perspektiven" menschliche
Lebenswelten in Zeiten von Veränderungen in den Blick: Was prägt und
bewegt die Menschen? Womit identifizieren sie sich, wie gestalten sie
ihr Leben, ihre Umwelt, die Gesellschaft? Und wie gehen sie mit
Ungewissheit und Krisen um?
Die Antoniuskirche mit Gemälden von Pietro de Pomis und Hans Adam
Weißenkircher ist in den Ausstellungsrundgang eingebunden und der
Trachtensaal aus den späten 1930er- Jahren wird seit 2022 in einer
veränderten Lesart als vielschichtiger volkskundlicher Wissens- und
Erfahrungsraum präsentiert.

Das Paulustor ist eines der bedeutendsten erhaltenen Renaissance-Stadttore im deutschsprachigen Raum.
Die Paulustorvorstadt im nordöstlichen Teil von Graz wurde ab 1578
bewusst geplant, um die Stadt vor den Osmanen zu schützen. Das neue
Viertel war durch die mittelalterliche Verteidigungsmauer vom Stadtkern
getrennt und nur über das Innere Paulustor erreichbar. Dieses lag
zwischen dem Palais Saurau und dem ehemaligen Gasthaus zur Goldenen
Pastete und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts abgetragen. Das äußere
Paulustor jedoch blieb erhalten und gehört zum architektonisch
markanten Umfeld des Volkskundemuseums.
Volkskundemuseum
„Volkskundliche Abteilung bewilligt!!!" So schrieb Viktor Geramb, der
Gründer des Volkskundemuseums, 1913 in seinen Kalender. Als Grundstock
dafür konnte er die „bäuerliche Sammlung" aus der Kulturhistorischen
Abteilung des Joanneums herauslösen. Die Räume wurden für den
Museumsbetrieb adaptiert und die erste Ausstellung nach dem Ersten
Weltkrieg eröffnet. Bauliche Erweiterungen und inhaltliche
Neuausrichtungen prägten die Jahrzehnte danach: In den 1930er-Jahren
kam ein neuer Trakt mit dem Trachtensaal dazu, 2003 wurde nach einem
Umbau die Dauerausstellung „Wohnen - Kleiden – Glauben" eröffnet. Seit
2021 sind die Antoniuskirche und der Innenhof für den Museumsbetrieb
geöffnet, die neue Ausstellung widmet sich Fragen der Gegenwart. Auch
in Zukunft will sich das Volkskundemuseum stetig an den Bedürfnissen
der Gesellschaft weiterentwickeln.

Der 209 m² große „Heimatsaal"
am Fuße des Schloßbergs wurde im Zuge der Errichtung des neuen
Gebäudetraktes in den späten 1930er-Jahren erbaut. Nach den
Vorstellungen des Museumsgründers Viktor Geramb sollte der Saal die als
bedroht wahrgenommene „eigene Kultur" stärken, wurde jedoch erst nach
1945 in Betrieb genommen. Neben Sing-, Tanz- oder
Theaterveranstaltungen des Museums fanden hier auch Präsentationen des
„Steirischen Heimatwerks" statt. Später wurde der Saal auch von
Veranstaltern wie dem Katholischen Bildungswerk für
Schulveranstaltungen und Diavorträge genutzt. Für die Neueröffnung 2021
wurde der „Heimatsaal" renoviert und barrierefrei erschlossen. Damit
öffnet sich das Museum einer Vielfalt an Formaten und Inhalten, die den
Diskurs zu gesellschaftsrelevanten Themen beleben.
Das Kapuzinerkloster in der
Paulustorgasse war das erste dieses Ordens auf dem Gebiet der heutigen
Steiermark. Wie andere Orden auch, sollten die Kapuziner die
katholischen Landesherren beim Kampf gegen den Protestantismus
unterstützen. 1605 zogen die ersten Ordensbrüder ins Kloster ein. Die
Kapuziner – ein Bettelorden haben dafür klare Bauvorgaben formuliert,
die bis heute gelten: Einfach und schlicht, aber beständig, stabil und
praktisch sollen ihre Klöster sein. Alles soll Armut, Demut und
Bescheidenheit zeigen. Die Kapuziner wurden wegen ihrer volksnahen
Predigten, Kranken- und Seelsorge und ihrem bescheidenen Lebensstil
bald beliebt. Mitte des 17. Jahrhunderts war die katholische Religion
im Gebiet der heutigen Steiermark wieder fest verankert.

Mit der musealen Geschichte des Hauses verbunden ist diese Rauchstube,
die Viktor Geramb im Jahr 1914 aus Oberrohrbach auf der Pack in das
Museum übertragen ließ. Damals wie heute ist dieser historische
Wohnraum ein bedeutendes Sammlungsobjekt für das Museum, das über
Wohnverhältnisse in früheren Jahrhunderten Aufschluss gibt. In der
Rauchstube spielte sich ein Großteil des bäuerlichen Lebens ab: Heizen,
Kochen, Essen, Körperhygiene, Kinderbetreuung, Kleintierhaltung,
Arbeiten, geselliges Zusammensein, religiöse Andacht, auch Schlafen und
vieles mehr. Von dieser „Einraumwohnung" lassen sich Fragen ableiten,
die auch für heutige Wohnmodelle interessieren, etwa zu
gesundheitlichen und sozialen Aspekten, zur Organisation des
Zusammenlebens und Taktung des Alltags oder auch Fragen zu
Privatsphäre, Intimität und Sexualität. Der Rauchstube angeschlossen
ist ein Hörraum, der eine quasi 1:1 in Schaumstoff übersetzte
Rauchstube abbildet. Zur Eröffnung des neuen Volkskundemuseums wurden
Mitarbeiter*innen interviewt, die über das renovierte Museum, seine
Räume und die neue Ausstellung sprechen.





Uns geht es gut!? - Beispiel Steiermark
Die Steiermark ist heute eine aufstrebende mitteleuropäische Region und
Teil eines der wohlhabendsten Staaten der Welt. Stetig steigender
Konsum und Fortschritt, wachsende Lebensqualität, Bildung und Mobilität
widerspiegeln ein breites Verständnis westlicher Wohlstandsentwicklung
und gehören zum Selbstverständnis vieler Bewohner*innen dieses Landes.
Was aber können diese messbaren „Uns geht es gut"-Faktoren konkret über
das Land erzählen? Welche Auswirkungen haben Wohlstand und Fortschritt,
eine westliche Konsumpraxis oder mehr Mobilität auf Umwelt und
Gesellschaft? Und können alle, die hier leben, von diesen
Wohlstandsentwicklungen gleichermaßen profitieren?
Dieser Ausstellungsteil durchleuchtet gegenwärtige „steirische"
Selbstbilder und ihre Entstehung. Er erkundet ihre Intentionen und
Nutzungen anhand ausgewählter kulinarischer Aushängeschilder, des
Bildungssektors, einer beliebten Tourismus- und Gesundheitsregion, am
Beispiel von Industrieprodukten mit hohem Imagewert und prägenden
Entwicklungen im Bereich der Mobilität. Im Mittelpunkt stehen
Akteur*innen der Geschichte, die Veränderungen herbeiführ(t)en und
gesellschaftliches Geschehen beeinfluss(t)en.
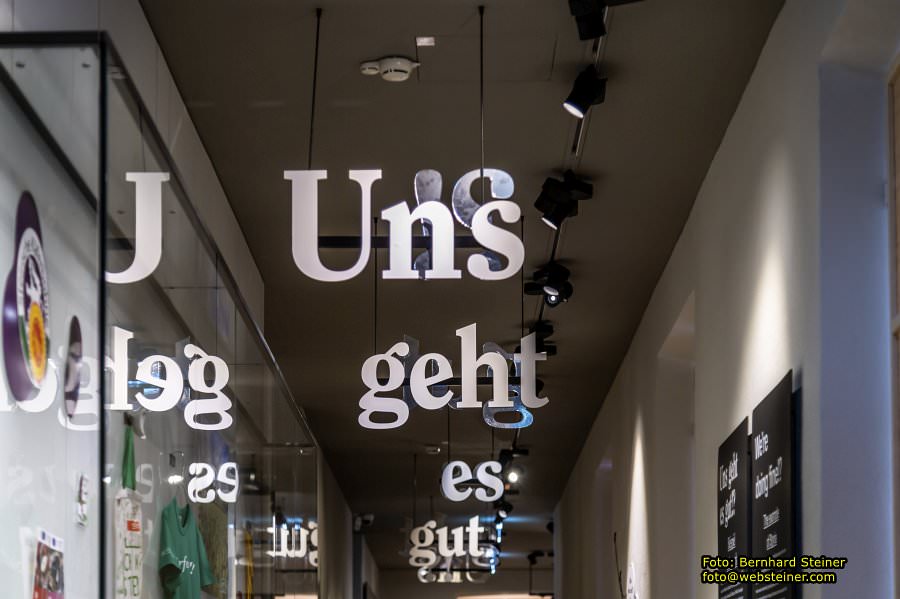
Grazer Tafel
Unterrichtstafel Homo (Der Mensch) für Erzherzog Ferdinand Karl, Wien,
1760, Inhalt: Philipp von Rottenberg, Gestaltung: Jacques Roëttiers |
Kulturhistorische Sammlung am Universalmuseum Joanneum
Als Teil der „Grazer Tafeln" vermittelte dieses Unterrichtsmaterial dem
jungen Aristokraten die drei standesgemäßen Bildungswege. Diesem
Bildungszugang der Eliten wurde ab 1774 die Bildung der breiten
Bevölkerung in Form der Allgemeinen Schulpflicht zur Seite gestellt.
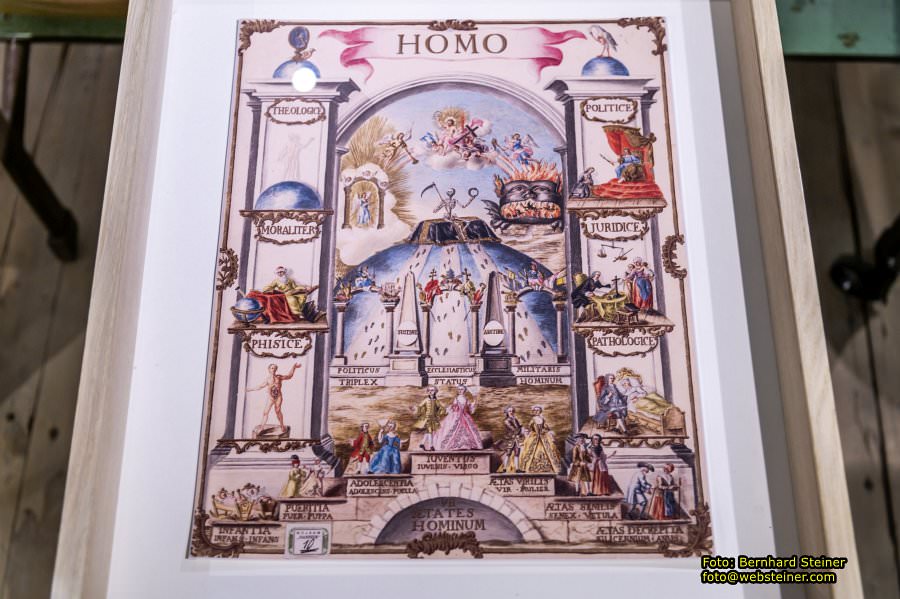
Nahrung mit Signalwirkung
Steirische Äpfel, Käferbohnen und Kürbiskernöl, steirisches Backhendl,
Steirerkäse und Vulcanoschinken - diese Produkte aus dem „Feinkostladen
Steiermark" und den deklarierten Genussregionen vermitteln Gefühle und
Bilder von „Heimat" und „Regionalität". Regionale Erzeugnisse werden zu
unverwechselbaren Aushängeschildern: Versprochen wird das „gute Leben",
nachhaltige Wertschöpfung, authentisches, qualitätsvolles, ja
vielfältiges Essen. Regionalität als Konzept ist eng mit
Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen verbunden sowie Teil
eines kulturellen Ordnungssystems. Ob „steirischer Apfel" oder
„steirisches Backhendl" - was heute als „regionale Besonderheit"
beworben wird, ist Produkt historischer wie gegenwärtiger (land)
wirtschaftlicher, sozialer und politischer Entwicklungen im Kontext von
Nahrungssicherheit, Nahrungsmittelproduktion und -konsum.
Auch die Mensch-Umwelt- und Mensch-Tier-Beziehungen unterliegen dem
Wandel. Veränderte Vorstellungen einer ethisch korrekten Tierhaltung,
neues Nahrungswissen, eine zunehmende Auseinandersetzung mit den
Bedingungen in der Nahrungsmittelproduktion, mit Umwelt- und
Klimaschutz beeinflussen auch jene Produkte, die seit Langem mit dem
Label „regional" versehen sind. Die Ausstellung möchte diese
Entwicklungen deutlich machen und greift zwei Beispiele heraus: den
steirischen Apfel und das Altsteirer Huhn.


Mobilität und Mobilitätserfahrungen
Sich fortzubewegen ist ein Grundprinzip von Leben und Überleben.
Menschen bewegten sich immer schon aus ökonomischer und ökologischer
Notwendigkeit, aus Furcht vor Unheil und Bedrohung oder aus Neugier und
Entdeckungsfreude. In der Nachkriegsgesellschaft wurde Mobilität durch
zunehmende Motorisierung zum Inbegriff von Unabhängigkeit, Abenteuer
und Erfolg. In der Steiermark ist die Möglichkeit der Fortbewegung
historisch wie gegenwärtig eng mit den großen Industrien des Landes
verbunden. Einzelne Firmen und ihre Erzeugnisse stehen für
jahrzehntelange, auch überregionale Anziehungskraft bei
Konsument*innen, der Maschinen- und Fahrzeugbau ist der größte
Arbeitgeber in der Region. Steigende Mobilität und Verkehr gehen
allerdings zulasten von Umwelt und Ressourcen. Die ökologischen
Probleme des motorisierten Transports bedrohen die Erde, Lösungen im
Sinne einer Energie- und Verkehrswende werden auch in der Steiermark
gesucht. Nicht alle Menschen haben das Privileg, selbstbestimmt mobil
zu sein. Der Arbeitsmarkt macht viele gerade aus strukturschwächeren
Regionen zu Berufspendler*innen. Flucht vor Krieg und Gewalt, Armut
oder auch Auswirkungen des Klimawandels zwingen Millionen Menschen,
ihre Regionen unter teils lebensbedrohlichen Umständen zu verlassen.
Anhand ausgewählter Objekte erzählt die Ausstellung Aspekte von
Mobilitätsgeschichte, verknüpft sie mit individuellen Erfahrungen und
lädt dazu ein, die eigene Mobilitätspraxis zu reflektieren.

Hölzernes Fahrrad mit Tretkurbelnm, Rupert Greimer/Greiner, um 1898
Volkskundemuseum/UMJ
Velozipede waren im 19. Jahrhundert in Westeuropa Kult geworden,
überall versuchte man Fahrräder schneller, leichter und sicherer zu
machen. Sie waren Transportmittel und Symbol für Spaß, Freude und
Freiheit. Diese Faszination hat auch den Almhirten Greimer (geb. 1876
in Pöllau) aus der Obersteiermark erfasst. Eines seiner Modelle
gelangte 1924 ins Museum.


Hebammen-Set von Resi Hainzl

Puch-Moped MS 50L, Baujahr 1954 | Familie Unger
Gegenstände können über ihren Zweck hinaus Erinnerungen hervorrufen
oder prägen mitunter ganze Generationen. Zum Beispiel ein Puch-Moped:
Für die Familie des Vorbesitzers ist es mit Erzählungen über den
Urgroßvater verknüpft. Andere lässt es an das eigene erste Moped
denken, an Freiheit und Freizeitvergnügen. Motorräder der Marke Puch
werden nicht mehr erzeugt, der Name ist jedoch vielfach mit
nostalgischen Gefühlen verknüpft.


Mobiltelefone verschiedener Hersteller und Epochen - Die Podcasts zeigen: Smartphones sind als mobile digitale
Begleiter fixer Bestandteil des Alltags. Menschen tragen diese Geräte
fast immer bei sich, verinnerlichen damit verbundene Berührungsmuster,
Tastenentfernungen und Haptik des Displays. Was mit mobiler Telefonie
und SMS begann, erfüllt heute unterschiedlichste Funktionen. Die
Sammlung alter Mobiltelefone zeigt die Historizität von Technik und
weckt Erinnerungen: Ist Ihr erstes Handy dabei? Welche Erinnerungen
verknüpfen Sie mit Ihrem ersten Mobiltelefon?
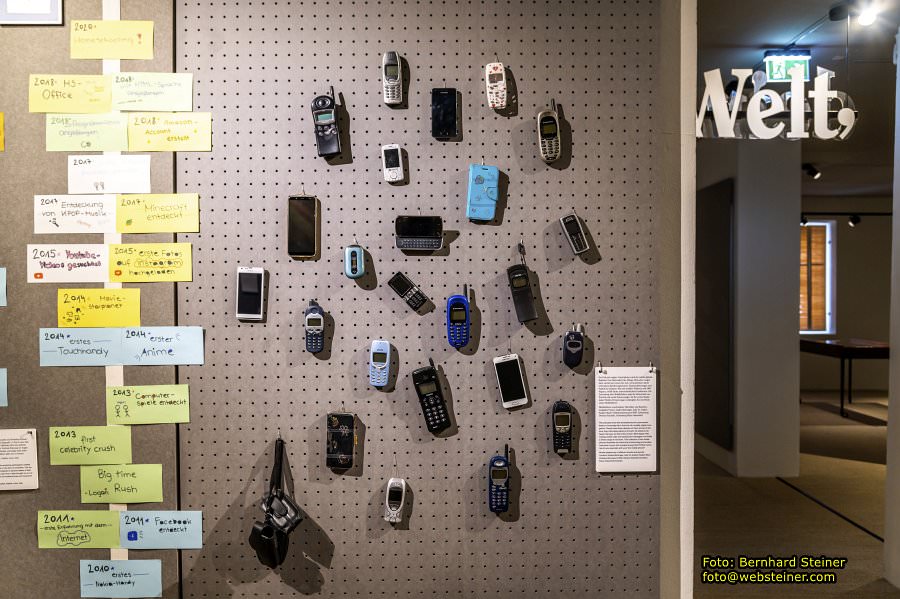
Ideen verbinden. Handeln im Sinne der Menschenrechte
Seit 2001 trägt Graz den Titel „Stadt der Menschenrechte". Verschiedene
Einrichtungen wurden seither etabliert, so das Europäische Trainings-
und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie (ETC), der
Menschenrechtsbeirat oder zuletzt das UNESCO-Zentrum zur Förderung der
Menschenrechte in Gemeinden und Regionen. Die Geschichte der
Menschenrechte in der Steiermark reicht zurück bis ins Jahr 1948, als
die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete.
Akteur*innen der internationalen Liga für Menschenrechte wollten das
aus der NS-Zeit stammende Image von Graz als „Stadt der Volkserhebung"
wenden und gegen Rassismus und Diskriminierung auftreten. Sie begannen
ab den 1980er-Jahren, die verdrängte Geschichte von
NS-Endphasenverbrechen in Graz aufzuarbeiten. Dabei rückte auch das
Haus Paulustorgasse 8 in den Fokus: Gegenüber dem Volkskundemuseum
befand sich das gefürchtete Gestapo-Hauptquartier mit Gefangenenhaus.
Diese Forschungen wurden mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet.
1998 beschloss die Stadt Graz im Zeichen eines „interreligiösen
Dialogs" den Bau einer neuen Synagoge am Ort der im November 1938
zerstörten alten Synagoge und übergab sie im Jahr 2000 der jüdischen
Gemeinde. Menschenrechte sind universell und in Österreich geltendes
Recht. Aktivist*innen, NGOs und öffentliche Einrichtungen kämpfen für
ihre Einhaltung und helfen, das Wissen um ihre Relevanz für das eigene
Lebensumfeld zu festigen.

Von der Aufklärung bekämpft - Krisenbewältigung durch Glauben
Die menschliche Existenz ist ständig gefährdet durch kollektiv oder
individuell erfahrene Bedrohungen. Heute versuchen Wissenschaften,
diese Bedrohungen realistisch einzuschätzen und mit überprüfbaren
Methoden zu bekämpfen. Diese Errungenschaft der Aufklärung hat in
Europa seit dem späten 17. Jahrhundert Rationalität zur Maxime
menschlichen Handelns gemacht. Gefahren lauerten überall: Seuchen,
Hungersnöte, Armut, Krankheiten, aber auch Machtmissbrauch und
kriegerische Auseinandersetzungen machten das Leben fragil. Wo heute
Wissenschaft, Medizin und Technik die Nöte des Lebens zu lindern
versuchen, stand den Menschen damals vorrangig die Tröstung der Kirche
zur Verfügung. Wenn Glaube und Gebet, Wallfahrt und Spende keine
Linderung brachten, blieb immer noch die Hoffnung auf ein besseres
Leben im Jenseits.
Daneben gediehen aber in allen Kreisen der Bevölkerung weltliche
Denkweisen und Praktiken der Selbsthilfe, die viele mühelos in ihre
religiöse Praxis einbauten. Sie wurden von Beobachtungen aus der Natur,
Analogien des Denkens, mit Restformen antiker und mittelalterlicher
Anschauungen gespeist und boten einen reichhaltigen Schatz an
praktischem Wissen, um drohende Schicksalsschläge abzuwenden oder
erlittene zu mildern. Teile dieses Denksystems mit seinen eigenen
Logiken durchzogen selbst die katholische Religionsausübung der
Gegenreformation. Der andere, weit größere Teil wurde von der Kirche
als „Aberglaube" bezeichnet und bekämpft.
Hl. Florian, Steiermark, 1928

Was wird sein? Krisen und Krisenbewältigung in früheren Zeiten
Immer wieder in der Vergangenheit sahen sich Menschen radikalen
Veränderungen ausgeliefert und waren Bedrohungen ausgesetzt. Solche
Krisenzeiten, seien sie persönlich oder gesellschaftlich, führen zu
Umbrüchen bestehender Ordnungen. Gegen die Unsicherheit in Phasen des
Übergangs entwickeln Menschen Methoden zur Bewältigung ihrer Ängste.
Erlernte Glaubenspraktiken, die Verwendung erprobter oder neuer
Hilfsmittel oder auch die Entwicklung neuer Strukturen und Denkweisen
sollen in Krisenzeiten schützen, stärken und helfen. So wie heute
unterschiedliche Deutungsinstanzen oder Akteur*innen Orientierung im
Umgang mit der Covid-19-Pandemie anbieten, wurden auch in vergangenen,
als krisenhaft verstandenen Zeiten Lösungsangebote entwickelt oder
verstärkt.
Was wird sein? widmet sich am Beispiel von vier ausgewählten
historischen Epochen in der Steiermark Formen der individuellen und
gesellschaftlichen Krisenerfahrung und ihrer Bewältigung:
- Formen der Welterklärung vor der Zeit der Aufklärung und die aus diesem Denken heraus entwickelten Hilfsangebote
- die Bemühungen Erzherzog Johanns um eine wirtschaftlich schwach ausgebildete Region
- die politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich brisanten
1930er-Jahre und die in dieser Krise von Politik und Volkskunde
ideologisch gestützten Identitätsangebote
- die Transformationen der 1980er-Jahre in der obersteirischen Industrieregion im Kontext einer weltweiten Stahlkrise
Die Ausstellung entlässt Sie wieder in die Gegenwart und zur Auflösung unserer interaktiven Umfrage „Was meinst du?".

Politische Krise - Das Volkskundemuseum als Ressource in der Zwischenkriegszeit
In den frühen 1930er-Jahren zeigten sich in vielen Ländern Europas
gesellschaftlich-politische Spannungen, die Ablehnung von Demokratie
und Parlamentarismus. Die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und der
Weltwirtschaftskrise ließen auch in Österreich soziale Konflikte und
eine politische Krise sichtbar werden. Mit der Etablierung des
autoritären „Ständestaats" (Austrofaschismus) im Jahr 1933/34 gingen
weitreichende Veränderungen auf allen Gebieten des politischen Lebens
einher. Die Einengung der Kultur auf „christlich und deutsch" diente
dabei der Durchsetzung politischer Interessen. In der Steiermark wurde
durch Landeshauptmann Karl Maria Stepan das Steirische als Gegenpol zur
ungeliebten Hauptstadt Wien stark propagiert. In dieser Zeit bot das
Volkskundemuseum mit Viktor Geramb an der Spitze der Politik die
gewünschte kulturelle Ressource und erhielt im Gegenzug politische
Aufmerksamkeit. Mit der Etablierung des Steirischen Heimatwerks im
„Stöckl"-Gebäude und der Planung und Durchführung des landesweiten
„Steirischen Volkstages" war der Volkskundler Geramb aktiv am Aufbau
und der Stärkung einer spezifischen Idee des „Steirertums" beteiligt.
Insbesondere über „wahre und echte" Tracht, über Volkslied und
Volkstanz vermittelten die volkskundlichen Akteur*innen in der
Paulustorgasse ganz im Sinne der Politik kulturell gestützte
Identitätsvorstellungen - auch nach 1945.

Erzherzog Johann - Verwertbares Wissen als Antwort auf die Krise
Um 1800 befand sich das Land Steiermark in einer ökonomisch und sozial
prekären Situation. In einem sich rasant entwickelnden Europa blickte
man auf die Steiermark als ein zurückgebliebenes „Armenhaus". In dieser
Lage fand der vom Wiener Hof aus politischen und militärischen Ämtern
verdrängte Erzherzog Johann (1782-1859) in der Steiermark ein reiches
Betätigungsfeld. Um das Land zu reformieren, bediente sich der
Habsburger moderner wissenschaftlicher Methoden: Er initiierte eine
statistische Umfrage, um damit in weiterer Folge Reformen einleiten und
die Situation für alle verbessern zu können. Auf seiner England- und
Schottlandreise 1815/16 sammelte er Erfahrungen und Wissen, die seine
Modernisierungsprojekte prägten. Beeinflusst vom Geist der Aufklärung
und ihren erzieherischen Bemühungen, wurde Erzherzog Johann zum
Reformer und Förderer von Industrie, Landwirtschaft, Eisenbahnwesen und
sozialer Fürsorge in der Steiermark. Zugleich wollte er kulturelle
Traditionen pflegen und berücksichtigte nicht, dass diese gerade aus
der alten, ländlichen Lebensweise entstanden waren und durch seine
Modernisierungsbestrebungen ihre Grundlage verloren. Als Erneuerer und
zugleich Bewahrer wurde er auch später immer wieder in Erinnerung
gerufen, besonders von den Vertretern des Volkskundemuseums.
Büste Erzherzog Johanns
Wilhelm Gösser, 1933, Spende von Dr. Felix Alexander Mayer,
Mitbegründer der Humanic Leder- und Schuh-AG Wien-Graz
Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz/UMJ
Die Skulptur des Leobener Künstlers (und NSDAP-Mitglieds) Wilhelm
Gösser wurde dem Volkskundemuseum Anfang des Jahres 1933 von einem
wohlhabenden Spender und Gönner des Museums geschenkt, der allerdings
in der Öffentlichkeit anonym bleiben wollte. Die Person Erzherzog
Johanns war die perfekte Identifikationsfigur in einer Zeit massiver
innen- und außenpolitischer Krisen.

Die Legende vom weisenden Kultbild
Die Empore wurde beim Umbau 2020/21 mit einem hölzernen Steg neu
gestaltet. So öffnet sich ein neuer Blickwinkel in den Kirchenraum. Wie
die Ausstattung des Inneren nach Fertigstellung des Sakralbaus 1602
aussah, ist bisher nicht bekannt, da Abbildungen aus dieser Zeit
fehlen. Bekannt ist: Als Stifter unterstützte Ferdinand II. den Bau mit
„reichlich Mitteln", wie aus der Abschrift einer Quellensammlung zum
Kloster hervorgeht. Darin findet sich auch eine Legende zur Ortswahl:
Maria Anna von Bayern, Mutter des Erzherzogs, war ebenso eine Gönnerin
des Kapuzinerordens. Vor Beginn der Bauarbeiten entspann sich ein
Streit um den Standort: Die Abschrift berichtet, dass „mehrere
Kriegsräte" sich entschieden gegen den Neubau stellten. Bei feindlichen
Angriffen auf den Schloßberg sei er bei der Verteidigung lediglich ein
Hindernis. Die Erzherzogin intervenierte daher zugunsten des Ordens.
Eine Marienstatue aus ihrem Besitz habe zu ihr Folgendes gesprochen:
„Zwischen Tiefe und Höhe soll eine geistliche Burg erstehen, damit kein
Feind wage, die Burg von Graz anzugreifen noch sie zu besiegen."
Daraufhin gaben die Kriegsräte ihren Widerstand auf, Kirche und Kloster
wurden hier errichtet. Diese Legende verweist auf das Motiv des
sogenannten weisenden Kultbilds, das oft zur Standortwahl von Kirchen
herangezogen wurde. Sie ist vielleicht auch ein Grund, warum im
Altarbild links oben der Schloßberg samt Kapuzinerkloster und
Antoniuskirche abgebildet ist.

Antoniuskirche
Die Grundsteinlegung für die Kirche erfolgte am 10. August 1600 im
Beisein des Habsburgers Ferdinand II., seit 1595 Landesherr von
Innerösterreich. Er war tief katholisch und ein kompromissloser Gegner
der protestantischen Lehren. Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der
Protestant*innen rief er den Kapuziner Laurentius von Brindisi nach
Graz. In Ferdinands Auftrag gründete er Kloster und Kirche. Der Ort
wurde angeblich gewählt, weil hier laut Quellen zwei Tage davor 10.000
protestantische Bücher verbrannt wurden. Ob dies tatsächlich hier
stattfand, konnte bislang nicht bestätigt werden. Das Volkskundemuseum
nutzt die Antoniuskirche seit 1916 für die Aufführung der Hirten- und
Krippenlieder. Seit 2021 ist sie barrierefrei an das Museum angebunden.
Im Museum, das seit 1913 im ehemaligen Kapuzinerkloster untergebracht
ist, erfahren Sie mehr über die bewegte Geschichte dieses Areals und
seine Nutzung im Laufe der Jahrhunderte.


Das Volkskundemuseum beherbergt heute einen der wenigen noch erhaltenen
„Trachtensäle" - ein unbequemes Erbe der 1930er-Jahre. Der
Museumsleiter, Volkskundler und „Heimatschützer" Viktor Geramb hat hier
mit 42 Figurinen in acht Vitrinen „Tracht" und mit ihr die
Steirer*innen auf ein Podest gehoben. Vorlage dafür war das von ihm
zeitgleich herausgegebene Steirische Trachtenbuch, begründet von Konrad
Mautner, Sohn Wiener jüdischer Industrieller und Sammler von
Volksliedern und Trachten. Im Sommer 1938, wenige Monate nach der
Machtübernahme der Nationalsozialist*innen in Österreich, führte Geramb
die ersten Besucher*innen durch die unfertige „Trachtenschau", an deren
musealer Inszenierung er von 1936 bis 1939/40 arbeitete.
Funktionelle Kleidung
Tracht bedeutet so viel wie „das, was getragen wird". Bis zur
Aufklärung gab es genaue Vorschriften, wer welche Kleidung tragen
durfte - je nach sozialem Stand und Geschlecht. Geprägt wurde der
Begriff aber erst Ende des 18. Jahrhunderts durch die entstehenden
Nationaltrachten. Rund 100 Jahre später bekam Tracht die Funktion, eine
heile Vorstellung von Heimat zu bewahren und die Sehnsucht nach einem
„deutschen Wir" zu wecken.
Für die Idee von Tracht als „Kleid der Heimat" machte sich auch Viktor
Geramb stark und wurde zu einem Vorreiter der „Trachtenerneuerung".
Diese beruhte auf dem Erforschen, Tragen, Zeigen, Normieren, also dem
Pflegen von Tracht in Wissenschaft, Museum und Alltag. Gerade auch
Geramb hat dabei das „Bauerntum" als „Mutterboden" einer deutschen
Kultur mythisch überhöht. Im Trachtensaal sollten die historischen
Kleidungsstücke den Besucherinnen ein Gefühl für Stil, Form und Farbe
vermitteln und dem „Kitsch" entgegenwirken - in einer Zeit, in der
Tracht vom städtischen Mode-Dirndl, von Sommerfrische und
Unterhaltungskultur stark beeinflusst wurde. Gleichzeitig stützte das
Zeigen dieser Kleiderordnung das Bild einer ständischen Ordnung: Welche
Kleidung tragen Bauer und Bäuerin, Sennerin, Landbürger oder
Hammerfrau? Der im Austrofaschismus geplante hierarchische Aufbau einer
berufsständischen Gesellschaft sollte für Stabilität und Harmonie
sorgen oder einen Klassenkampf aufgrund sozialer Schieflagen vermeiden
- je nach Sichtweise des politischen Lagers.

Trachten nach Identität
Theatralisch, leblos, unheimlich – so muten die Figurinen heute
mitunter an. Die Zeit ihrer Entstehung ist ihnen eingeschrieben:
Österreich wurde ab März 1933 autoritär regiert, orientiert am
italienischen Faschismus. Nach Ausschaltung der Opposition erließ die
Diktatur „im Namen Gottes" eine Verfassung auf vormoderner ständischer
Grundlage und erklärte Österreich zu einem „christlich-deutschen
Bundesstaat" in Abgrenzung von Nationalsozialismus und Kommunismus. Für
die Bildung und Inszenierung seiner Identität nutzte der
austrofaschistische „Ständestaat" auch die Tracht, neben dem Dirndl
insbesondere den von Erzherzog Johann popularisierten „Steireranzug",
sowie die Volkskunde als neue „Wissenschaft vom Volk". Viktor Geramb
war österreichweit wohl deren wichtigster Akteur. Katholisch und
konservativ, zugleich deutschnational bis völkisch orientiert und
vernetzt, propagierte er eine deutsche Identität und reaktionäre
Heimatbilder durch Volksbildung, Trachtenpflege und
„Heimatschutz"-Vereine wie den „Deutschen Schulverein Südmark". Im
Museum ließ er die Essenz des Gestern von Künstlern seiner Zeit in neue
Formen gießen - und die Figuren eine tragende Rolle spielen.

Zeitgemäße Verschiebungen
Der Trachtensaal verkörperte das Wunsch-bild einer homogenen
„Volksgemeinschaft“: als ständisch organisierte, antimoderne und
deutsch-steirische. Diese Idee einer „natürlich" gewachsenen
einheitlichen Identität wurde nunmehr durch eine räumliche Intervention
archiviert. Die Verschiebung und Verpackung der Vitrinen drängt die
Inszenierung des imaginierten Eigenen zurück und schafft Raum für
aktuelle Perspektiven auf den Trachtensaal und auf Tracht: an den
Vitrinen, im Wandbild und im Video.

Trachten-Modelle
Im Gegensatz zu anderen Trachtendarstellungen, die anonym oder abstrakt
blieben, entsprechen manche Gesichter im Grazer Trachtensaal realen
Personen, die zum Teil auch genannt werden. Einige von ihnen gehörten
zum Umfeld des Volkskundemuseums: Die Figur der Grundlseerin etwa steht
in Beziehung zur Familie von Konrad und Anna Mautner, jene des Ausseers
um 1870 zeigt einen der beiden damals weitbekannten und oft
porträtierten Grundlseer Pfeiferlbuam, von Brotberuf Holzknecht und
Salzarbeiter.
Der Alte Mann aus dem oberen Murtal war Geistlicher und verrichtete
religiöse Dienste in der Grazer Antoniuskirche. Durch außerordentliche
Aktivität zeichnete sich der Landbürger aus Weißkirchen bei Judenburg
aus: Er war Wirtshausbesitzer, Brau- und Bürgermeister sowie
Musikkapellengründer und so für die Entwicklung der Gemeinde von großer
Bedeutung.
Bruchstückhaft informieren die Beschriftungen über die Lebenswelten,
Tätigkeiten und sozialen Verhältnisse der Trachtenträger*innen. Doch
selten gehörte die ausgestellte Kleidung tatsächlich der dargestellten
Person. In ihrer äußeren Erscheinung verkörperten die Individuen für
Geramb indes bis in die feinen Gesichtszüge der Grundlseerin hinein
ländliche „Volkstypen" und das „sittliche Wesen" eines Kollektivs -
jenes der steirischen Bevölkerung. Dass er dabei der Ober- und
Weststeiermark eine höhere kulturelle Prägung als der Südoststeiermark
zuschrieb, spiegelt auch der Fokus des Trachtensaals wider.

Spiel-Räume
Verändert wurde der Trachtensaal erst lange nach der Ära Viktor Gerambs
in den 1980er-Jahren: Die Wissenschaftlerin des Hauses verschob
Vitrinen, tauschte Kleidungsstücke, Körperteile und Figurinen und
machte etwa aus dem Jäger um 1330 einen Bauern um 1970 - ganz im Sinne
der verstärkten Hinwendung der Volkskunde zur Gegenwart. 2003 wurde die
Inszenierung der 1940er-Jahre weitgehend wiederhergestellt und zum
„Museum im Museum" erklärt, temporäre Interventionen folgten. Deponiert
hat den Trachtensaal trotz seiner Verankerung zwischen
Deutschnationalismus, Austrofaschismus und Nationalsozialismus noch
niemand - doch 2022 wurden seine Inhalte verschoben, verpackt und neu
eingeordnet.
Was kann der Raum heute vermitteln?
Der Trachtensaal sensibilisiert für die Konstruktion von Identitäten
und Vorstellungen von „eigenen Wurzeln", die ein enges
gesellschaftliches Korsett schnüren. Heute wie früher hat der Saal
Bezüge zur Welt jenseits des Museums, denn: Dirndl und Lederhose in
unterschiedlichen Spielarten liegen wieder im Trend. Tracht vermittelt
Ordnung durch Lokalisierung in einer globalisierten Welt, sie dient der
Weitertragung traditioneller Haltungen und fester Identitäten, zugleich
zeigt sie gesellschaftliche Veränderungen an. Die Suche nach dem
„Echten" wird durch ein Spiel mit Zitaten irritiert. Mode und Design
verarbeiten die populäre Wirkung von Tracht weiter; individuelle
Aneignungen spielen mit Gender- und Machtverhältnissen, Körper- und
Kleidercodes, die sich einer eindeutigen geschlechtlichen, politischen
oder regionalen Zuordnung entziehen. Wo würden Sie sich einordnen?

Geschichte wird gemacht
Kleider machen Leute - im Trachtensaal aber auch Geschichte. Denn
Geschichte ist immer ein gegenwärtiger Blick auf die Vergangenheit. Die
Figurinen der älteren Zeit und ihre Kleidung entwickelte Viktor Geramb
anhand historischer Bildquellen wie Buchmalereien in Handschriften aus
dem Kloster St. Lambrecht, Kirchenfresken oder Bildern der Kammermaler
Erzherzog Johanns. Viele Darstellungen hatte Konrad Mautner für das
Steirische Trachtenbuch zusammengetragen, andere Vorlagen malten
Künstlerinnen für ihn ab. Anhand dieser Kopien stellte Geramb die
seiner Meinung nach typischen Kleider-Ensembles zusammen.
Melitta Maieritsch, Lehrerin, Weberin und Kunstgewerbe-Absolventin der
Grazer Ortweinschule, organisierte die Stoffe und nähte die Kleidung
nach Gerambs Vorgaben. Schuhe und Accessoires wurden bei Firmen,
zumeist in Graz, in Auftrag gegeben. Ähnlich den Naturalienkabinetten
des 19. Jahrhunderts wurden die Figurinen in Vitrinen positioniert und
in den historischen Gewändern als verkörperte Wiederkehr der
Vergangenheit inszeniert. In erster Linie sind die Figurinen jedoch das
Ergebnis zeitgenössischer Wissenschaftspraktiken: des Sammelns,
Auswählens, Fragmentierens, des Interpretierens und Neu-Herstellens,
des Inszenierens, Erzählens und Vermittelns und nicht zuletzt: des
Legitimierens.

Die Kirche Sankt Antonius von Padua
Diese Kirche ist beredte Zeugin der Religionskonflikte im späten 16.
und frühen 17. Jahrhundert. Hinter dem Glaubenskampf stand der
Machtstreit zwischen den katholischen Habsburgern und den
protestantischen Ständen. Der Landesherr Ferdinand II. (1578-1637)
unterstützte als glühender Gegenreformator den vom Papst zur
Rückdrängung der Protestanten eingesetzten Kapuziner Laurentius von
Brindisi (1559-1619) und beauftragte ihn mit der Gründung eines
Klosters in Graz. Die Grundsteinlegung der Kirche am 10. August 1600
soll in Zusammenhang mit der kurz zuvor stattgefundenen Verbrennung
Tausender protestantischer Bücher in der Paulusvorstadt stehen.

Kirche und Kloster entsprechen mit ihrer zur Schau gestellten
Schlichtheit und Bescheidenheit der strengen Bauordnung der Kapuziner.
Seit seiner Gründung genoss der Bettelorden durch Seelsorge und
Krankenpflege, zumal in Zeiten der Pest, große Popularität.


Dominant beherrscht das Altarbild des Hofmalers Giovanni Pietro de
Pomis (um 1565-1633) den Kirchenraum. Das programmatische Gemälde zeigt
Ferdinand im Harnisch am unteren rechten Bildrand. Es ruft, wie auf den
Spruchbändern zu lesen ist, zum bewaffneten Kampf gegen Andersgläubige
auf - unterstützt durch die Heiligen Leopold, Ulrich, Sebastian,
Rochus, Hieronymus, zu erkennen an ihren Attributen. Rechts in der
himmlischen Sphäre des Bildes kniet Antonius, dem die Kirche geweiht
ist. Ganz oben schwebt der auferstandene Christus, dem die Heiligen
Katharina und Johannes der Täufer die Stadt Graz zum Schutz darbieten.

Für die einen sind Apple-Produkte Kult. Für andere nur teure Fetische
der Warenwelt. Gegründet 1976 in einer Garage in Los Altos
(Kalifornien), hat Apple Geschichte geschrieben: Technik-, Industrie-,
Design- und Kulturgeschichte. Mit dem Macintosh brachte Apple den
ersten in größerer Stückzahl erzeugten PC mit grafischer
Benutzer*innenoberfläche und Maus auf den Markt. Mit dem iPhone
revolutionierte Apple 2007 die Mobiltelefonie. Und Anfang 2022
erreichte das Unternehmen den Börsenwert von drei Billionen US-Dollar...
Mit Ausnahme der grafischen Oberflächen haben Apple-Geräte heute nichts
Buntes an sich: das Design reduktionistisch; das Logo dezent. Das war
aber nicht immer so! Entworfen 1977 von Rob Janoff, war der angebissene
Apfel regenbogenfarben! Sechs Farbstreifen: Grün oben, Blau unten. Um
den Hintergrund des Logos ranken sich Legenden. Der Rede wert ist jene,
wonach es sich um eine Hommage an das britische Kryptoanalyse- und
Informatikgenie Alan Turning (1912-1954) handle: Turning lebte sein
sexuelles Interesse an Männern aus, als dies im Vereinigten Königreich
noch verboten war. 1952 wegen „sexueller Perversion" zu chemischer
Kastration verurteilt, erkrankte Turning psychisch und starb an einer
Cyanidvergiftung. Die Polizei stellte Suizid fest. Gefunden wurde ein
angebissener Apfel ...
Seinen letzten Auftritt hatte der Regenbogenapfel in der „Think
different"-Kampagne des Unternehmens, die 1997 anlief: Die in
Schwarz-Weiß gehaltenen Motive zeigten Prominente aus Geschichte und
Gegenwart. Man setzte die Botschaft >denke das Andere hinzu< und:
den bunten Apfel.

REGENBOGENSCHUTZWEG AM GRIESKAI
Gemäß Straßenverkehrsordnung ist ein „Schutzweg" ein „durch
gleichmäßige Längsstreifen gekennzeichneter, für die Überquerung der
Fahrbahn durch Fußgänger bestimmter Fahrbahnteil". Meist sind die
Streifen weiß oder gelb und bilden mit der grauen Straßenoberfläche das
Zebramuster. Seit einigen Jahren jedoch sind Zebrastreifen immer öfter
regenbogenfarben. Den Anfang machte Wien, wo der Schutzweg seit 2019
auf Höhe von Burgtheater und Rathaus eine farbige Überquerung der
Ringstraße ermöglicht. Und was Wien hat, will oft auch Graz haben, und
Innsbruck, Linz und Villach auch...
Als „wichtiges Signal für mehr queere Sichtbarkeit in Graz" bezeichnete
Gemeinderat Gerald Kuhn den Regenbogenschutzweg anlässlich seiner
Fertigstellung im Sommer 2021. Und Elke Kahr - seinerzeit
Verkehrsstadträtin, nunmehr Bürgermeisterin - postete auf Facebook ein
Foto, das sie selbst, die Dragqueen Gloria Hole und lokalpolitische
Prominenz zeigte.

FARBENLEHRE FÜR FORTGESCHRITTENE
Soziolog*innen beschreiben unsere Gesellschaft als pluralistisch und
individualisiert. Gewollt seien Selbstverwirklichung und
Selbstexpression. Kulturwissenschafter*innen konstatieren eine
wachsende Bedeutung von Identitätspolitik. Gemeint ist damit eine
politische Praxis von marginalisierten Gruppen, die sich ihrer
geteilten Erfahrungen bewusst werden, über geteilte Symbole -
sprachliche und visuelle Codes - eine kollektive Identität herstellen
und sich gegen Benachteiligungen wehren. Vor diesem Hintergrund
vervielfältigen sich die Gruppen, entstehen neue Identitäten. Wenig
überraschend, dass der Regenbogen wiederholt überarbeitet wurde und
neben ihn immer weitere Signets mit je eigenen Bedeutungen treten. Das
Poster der Beratungsstelle Courage* ist auf dem Stand von 2019.

Antoniuskirche
Ferdinand II. - seit 1595 Landesherr von Innerösterreich - war tief
katholisch und ein kompromissloser Gegner der protestantischen Lehren.
Zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Protestant*innen rief er den
Kapuziner Laurentius von Brindisi nach Graz. Die Grundsteinlegung für
die Kirche erfolgte im Beisein des Habsburgers am 10. August 1600, am
6. Oktober 1602 wurde sie dem heiligen Antonius von Padua geweiht. Der
Ort wurde angeblich gewählt, weil hier laut Klosterchronik zwei Tage
davor 10.000 protestantische Bücher verbrannt wurden. Ob dies
tatsächlich hier stattfand, konnte bislang nicht bestätigt werden. Das
Volkskundemuseum nutzt die Antoniuskirche seit 1916 für die Aufführung
der Hirten- und Krippenlieder. Seit 2021 ist sie barrierefrei an das
Museum angebunden.
