web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Josephinum
Medizinhistorisches Museum Wien, April 2023
Das Josephinum, das 1785 als militärchirurgische
Akademie gegründet wurde, zeigt seine reichen Sammlungsbestände:
anatomische Wachsmodelle aus dem 18. Jahrhundert, die Geschichte
Josephs II., jene der I. und II. Wiener Medizinischen Schule und des
Nationalsozialismus bis hin zur heutigen Hightech-Medizin.

Das Josephinum, auch Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum, war eine
medizinisch-chirurgische Akademie in Wien zur Ausbildung von
Militärärzten für die österreichische Armee. Heute ist in den Gebäuden
des ehemaligen Josephinums das Institut für Geschichte der Medizin der
Medizinischen Universität Wien untergebracht, ebenso wie andere
Institute.

Das Josephinum wurde von Kaiser Joseph II. 1784 als k.k.
medizinisch-chirurgische Josephs-Academie zur Ausbildung von Ärzten und
Wundärzten für die Armee gegründet und am 7. November 1785 eröffnet.
Die Initiative dazu hatte sein Leibchirurg Giovanni Alessandro
Brambilla ergriffen, den der Kaiser 1779 mit der Leitung des gesamten
österreichischen Militärsanitätswesens betraut hatte, in dem viel zu
reformieren war.

Das Allgemeine Krankenhaus Zentrum der Wiener Medizin
Auf zahlreichen Reisen erkundet Joseph II. auch die Spitäler anderer
Länder und hält seine Beobachtungen fest. In Paris ist er von der
zentralisierten Versorgung im Hôtel-Dieu begeistert, aber von den
sozialen und hygienischen Umständen schockiert. Für Wien plant er ein
ebenso großes, aber menschenwürdigeres Spital. Der Herrscher beauftragt
seinen Leibarzt, Joseph Quarin, mit der Umsetzung. Auf dem Areal des
Wiener Groß-Armenhauses entsteht binnen kürzester Zeit eine Anstalt mit
2.000 Betten, die eine große Innovation - jeweils nur für eine Person
vorgesehen sind. Über zwei Jahrhunderte werden in den unter Joseph
errichteten Gebäuden Millionen von Patient:innen behandelt. Mediziner
innen entwickeln hier neue Methoden der Diagnostik und Behandlung. Das
Allgemeine Krankenhaus ist das Herzstück der Wiener Medizinischen
Schule.

Joseph II., die Aufklärung und die Medizin
Die Aufklärung ist eine Zeit des Sammelns und Ordnens von Wissen. Mit
dem Ziel, die Welt auch abseits tradierter theologischer Ideen erklären
zu können, versuchen die Philosophen und frühen Wissenschaftler des 18.
Jahrhunderts, die Abläufe der Natur zu verstehen. Auch der Mensch ist
für sie Teil dieses komplexen Systems. Er darf, wie alle anderen
Lebewesen, aus seinen Einzelteilen und ihrer Funktionsweise erklärt
werden. Auch die Medizin ist Teil dieser Veränderungen und greift
zunehmend wissenschaftliche Erkenntnisse aus anderen Bereichen auf.
Maria Theresia fördert diese Entwicklung. Unter anderem holt sie
Gelehrte der berühmten Schule Boerhaaves aus Leiden nach Wien, um die
Ausbildung der Ärzte in Österreich zu verbessern. Ihr Sohn Joseph II.
macht die Medizin zum Kernprogramm seiner Regierung. Er bricht mit
Konventionen, erneuert Lehrpläne und Institutionen und prägt damit bis
heute die österreichische Medizinlandschaft.

Der bedeutende Teil der Sammlung, die anatomischen Wachsfiguren, gehen
auf Initiative von Kaiser Joseph II. zurück, welcher für das Josefinum
insgesamt 1.192 Wachsmodelle bei Wachsbildhauern in Florenz bestellen
ließ. Ende des 18. Jahrhunderts war die Region um Florenz das Zentrum
der Wachsmodellierkunst und Wachsmodelle lösten die zuvor für diesen
Zweck gebrauchten Materialien wie Terrakotta ab. Die anatomischen
Wachsmodelle wurden ab 1786 in der Akademie im Rahmen der Ausbildung
verwendet, waren aber im Sinne der Aufklärung auch für die
interessierte Öffentlichkeit zugänglich.

Das Josephinum
Das als medizinisch-chirurgische Militärakademie gegründete Josephinum
ist Ausdruck Josephs aufklärerisch-utilitaristischer Geisteshaltung. Im
neoklassizistischen Stil nach den Plänen von Isidore Canevale gebaut,
soll hier eine einheitliche und streng überwachte Ausbildung ermöglicht
werden. Die bis dahin vorwiegend außerhalb der Universität
unterrichtete Chirurgie wird aufgewertet und der Medizin als
gleichberechtigtes Fach zur Seite gestellt. Anatomische Modelle,
chirurgische Instrumente sowie zahlreiche Präparate und Bücher bilden
das Herzstück dieser Institution. Portraits berühmter Ärzte aus Antike
und Renaissance schmücken den Hörsaal und viele der anderen Räume. Sie
stellen das Josephinum in eine glorifizierte medizinische Tradition.

Die Wachsmodelle und ihre Geschichte
Auf einer Italienreise 1769 entdeckt Joseph II. die Wachsmodellkunst.
Fasziniert von den anatomischen Modellen beschließt er, eine Sammlung
für das Josephinum anfertigen zu lassen. In der Florentiner La Specola,
die von seinem Bruder Leopold begründet wurde, bestellt er rund 1.200
Modelle. Die Anatomen Felice Fontana und Paolo Mascagni sind für die
Konzeption verantwortlich. Als Vorlage dienen Leichen aus dem Spital
Santa Maria Nuova. Das Team von Wachsbildner Clemente Susini produziert
die Modelle in nur vier Jahren. Auf Maultieren überqueren die Modelle
die Alpen und erreichen nach einer beschwerlichen Reise Wien. Trotz
einiger Schäden, die in Wien behoben werden, ist die Sammlung ab 1786
in der Akademie zu sehen.

Das Josephinum ist das bedeutendste Beispiel klassizistischer
Architektur in Wien und das wichtigste bauliche Erbe der josephinischen
Ära. Es wurde 1785 von Kaiser Joseph II. als medizinisch-chirurgische
Militärakademie gegründet, um angehende Ärzte und Hebammen für den
zivilen und militärischen Bereich nach neuartigen Methoden auszubilden.
Das Josephinum beherbergt die weltberühmte anatomische
Wachsmodellsammlung, die Joseph II. in Florenz eigens für die neu
gegründete Akademie in Auftrag gab, sowie weitere Sammlungen mit
beeindruckenden Objekten, Büchern, Archivalien und Handschriften. Das
Josephinum ist das historische Eingangstor zur Medizinischen
Universität Wien und auch heute noch ein wichtiger Ort für Austausch,
Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Geschichte und Ethik in der
Medizin.

Die anatomischen Wachsmodelle aus Florenz im Josephinum
Joseph II. entdeckt 1769 auf einer Italienreise die Kunst des
Wachsmodellierens. Fasziniert von den anatomischen Modellen, die er
dort sieht, beschließt er, eine Sammlung für den anatomischen
Unterricht in seiner Akademie, dem Josephinum anfertigen zu lassen.
Rund 1.200 Modelle bestellt er beim Florentiner Museum La Specola, das
von seinem Bruder Leopold gegründet wurde. Für die Konzeption der
Modelle sind die Anatomen Felice Fontana und Paolo Mascagni
verantwortlich. Als Vorlagen dienen ihnen Leichen aus dem Krankenhaus
Santa Maria Nuova.
Ein Team um den Wachsbildhauer Clemente Susini fertigt die Modelle in
nur sechs Jahren Auf Maultieren überqueren die Modelle die Alpen und
erreichen nach einer beschwerlichen Reise Wien. Sie werden ab 1786 in
der Akademie ausgestellt.

Die Wachsmodelle sind zum besseren Verständnis mit kolorierten
Zeichnungen mit Darstellungen des jeweiligen anatomischen Präparates
und einer Erklärung komplettiert. Diese Blätter entstanden gemeinsam
mit den dazugehörigen Wachsmodellen. Für fast jedes einzelne der ca.
1.200 florentinischen Wachsmodelle, die Kaiser Joseph II. in Florenz in
Auftrag gab um seine neu gegründete militärisch-chirurgische Akademie
damit auszustatten gibt es eine korrespondierende Zeichnung die den
jeweiligen Körperteil darstellt. Zur Erklärung der Anatomie wurde mit
Zahlen, die in einem Raster angeordnet waren einzelne Beschreibungen in
deutscher und italienischer Sprache verfasst. Diese Beschreibungen
waren in den Schubladen unter den dazugehörigen Vitrinen der
Wachspräparate untergebracht und gaben den Zöglingen der Akademie und
Besuchern Orientierung, vergleichbar mit heutiger Darstellung in
3D-Wachsmodelle und Bilder.
Der Betrachter wird dabei auf eine Reise ins Innere des Körpers geführt
und sieht, was damals wie heute dem Auge verborgen ist. Mit den
Techniken der modernen Radiologie scheinen diese Bilder überholt. Was
uns erfreut, ist ihre Ausdruckskraft und Schönheit. Was wir bewundern,
ist die Kühnheit mit der uns aus vergangenen Zeiten die Kenntnis über
den menschlichen Körper in idealer Verbindung von Wissenschaft und
Kunst überliefert ist.

Das Herzstück der Sammlungen im Josephinum bilden die ursprünglichen
Bestände, die Joseph II. für die Gründung der Institution anschaffen
ließ. Die berühmte Sammlung anatomischer und geburtshilflicher
Wachsmodelle geht auf eine persönliche Initiative des Kaisers zurück.
Begeistert von den Wachsmodellen in La Specola in Florenz, die sein
Bruder der Großherzog der Toskana und spätere Kaiser Leopold II.
anfertigen hatte lassen, bestellte Joseph II. ebenso eine Sammlung für
die neu gegründete Akademie in Wien. Unter Aufsicht des Direktors
Felice Fontana und des Anatomen Paolo Mascagni wurde diese von 1784 bis
1788 in Florenz hergestellt und gelangt nach einem mühsamen Transport
über die Alpen schließlich nach Wien. Sie diente einerseits als
Anschauungsmaterial für den Unterricht, andererseits war sie bereits
damals für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Wachsmodelle sind heute
zum Großteil erhalten und werden in sieben Räumen in den originalen
Vitrinen aus Rosenholz und venezianischem Glas in ihrer historischen
Aufstellung präsentiert.

Wien und die Welt
Wien als Hauptstadt der Donaumonarchie ist durch Internationalität
geprägt. Die hiesige Medizinische Fakultät zeichnet sich durch
Pionierleistungen in der Forschung, der Lehre und der praktizierten
klinischen Medizin aus. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kommen
Studierende zunehmend nicht nur aus den habsburgischen Ländern, sondern
auch aus anderen Teilen Europas, den USA sowie Ägypten, Indien, Japan
und China nach Wien. Ab der Jahrhundertwende sind darunter auch immer
mehr Frauen. Das hier erworbene Wissen tragen sie weit über die Grenzen
Österreichs hinaus. Internationale Netzwerke entwickeln sich, diese
begünstigen länderüber greifende Reisen und Wissenstransfer. Nicht
immer ist diese Mobilität freiwillig. In manchen Phasen weichen
Mediziner:innen vor Diskriminierung und Unterdrückung nach Wien aus. Ab
1938 vertreibt das NS-Regime jüdische und politisch missliebige
Personen.

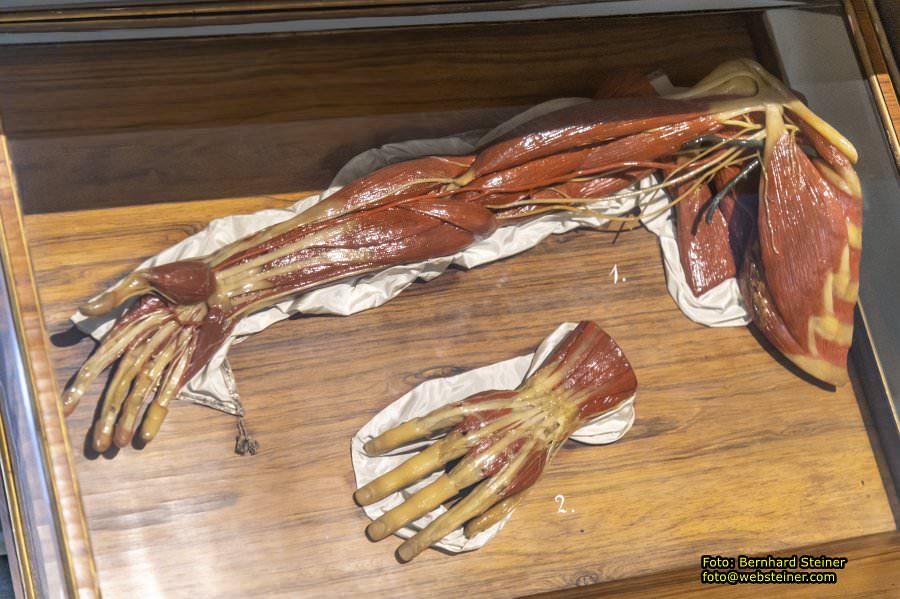
Netzwerke - Austausch -Wissenstransfer
Als Hauptstadt versorgt Wien das große Vielvölkerreich mit
medizinischem Personal. Hier treffen Forscher:innen und Studierende
verschiedenster Herkunft, Sprache, Tradition und Religion zusammen. Ab
Mitte des 19. Jahrhunderts kommen vermehrt auch nicht-europäische
Studierende nach Wien. Selbst der Erste Weltkrieg unterbricht diese
Internationalisierung nur kurzfristig und es kommt zu einem begrenzten
wissenschaftlichen Aufschwung in der Zwischenkriegszeit. Die
internationale Blütezeit weicht jedoch bald einer Herrschaft der
Wissenschaftsfeindlichkeit und Brutalität. Misstrauen und Bespitzelung
verdrängen internationale Offenheit. Unter dem NS-Regime werden mehr
als die Hälfte der Fakultätsmitglieder und ein großer Teil der
Mitarbeiter:innen und der Studierenden der Universität verwiesen.

Körperbilder
Seit Jahrtausenden beschäftigt sich der Mensch mit Bildern des eigenen
Körpers, die oft von Mythen und religiösen Vorstellungen geprägt sind.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Leichensektionen ab dem 14.
Jahrhundert etabliert sich in Europa ein neues, stärker empirisch
begründetes Körperbild. Die Anatomie fördert neue Erkenntnisse zutage.
Zudem ermöglicht die Entwicklung technischer Vorrichtungen ungeahnte
Einblicke in das Körperinnere. Mit der rasanten technologischen
Entwicklung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts können immer feinere
Einzelheiten des Aufbaus und der Funktionen des menschlichen Körpers
sichtbar gemacht werden. Die Labormedizin entwickelt immer neue
Parameter und Methoden zu deren Messung. Die Digitalisierung, die im
späten 20. Jahrhundert alle Lebensbereiche erfasst, führt auch im
Gesundheitsbereich zu einer explosionsartigen Entwicklung bei der
Erhebung, Sammlung und Speicherung von Daten.

Der nachgeahmte Körper
Präparate, Abgüsse und Modelle von menschlichen Körperteilen und ihren
Funktionen dienen zu Studien- und Forschungszwecken. Manche sind
originalgetreue Nachbildungen, andere stellen abstrahierte Modelle dar.
Sie zu erstellen, erfordert wissenschaftliche Kenntnisse, technisches
Können und künstlerische Fertigkeiten. Technologische Neuerungen
ermöglichen es, immer mehr Körperteile und ihre Funktionen immer besser
nachzuahmen und zu ersetzen. Viele Patient:innen profitieren davon, es
stellen sich aber auch Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen der
technischen Verbesserung des Menschen.
Mediceische Venus (Wachsmodell)
Das Highlight der Wachsmodellsammlung des Josephinums mit seinen fast
1200 Objekten sind zweifellos die Ganzkörperdarstellungen. Unter ihnen
sticht das Modell einer im vierten Monat schwangeren Frau besonders
hervor. Das Modell lässt sich öffnen und alle inneren Organe können
entnommen und einzeln betrachtet werden. Auchder Uterus und der darin
befindliche Fötus können entnommen werden und bieten einen
faszinierenden Blick auf die anatomischen Kenntnisse des späten 18.
Jahrhunderts.
Weibliches Ganzkörpermodell mit Lymphgefäßen des Halses, der inneren Organe, der Blase und Gebärmutter, 1785

Staat, Macht und Medizin
Zur Zeit der Aufklärung entdecken staatliche Akteure das Machtpotential
der Medizin. Ihre Erkenntnis, dass die Gesundheit der Bevölkerung
Militär und Wirtschaft beeinflusst, macht die Gesamtbevölkerung zur
Patientin des Staatsapparats, der immer mehr über ihren
Gesundheitszustand erfahren will. Die moderne Medizin soll die
Verbreitung von Krankheiten statistisch dokumentieren und mit einer
laufend erweiterten Gesundheitsversorgung den Kreislauf aus Armut,
Krankheit und frühem Tod brechen. Die Strukturen, die in diesem Prozess
entstehen, stärken wiederum die Macht des Staates. In diesem, auch vom
technologischen Fortschritt getriebenen Prozess entwickelt sich die
Medizin in neue Richtungen. Auf modernen Schlachtfeldern wird sie mit
neuen Verletzungen und der Entstellung ihrer Patienten konfrontiert.
Aus den biopolitischen Ansätzen der Aufklärung entwickeln sich im 20.
Jahrhundert auch Ideologien, die das Wissen der Medizin für grausame
Experimente und Massenmord anwenden. Das Erbe dieser Zeit und die stete
Abwägung verschiedener Interessen und Rechte sind Teil des bis heute
heftig diskutierten Themenkomplexes der Biopolitik.

Medizin und Gesellschaft
Das 19. Jahrhundert bringt enorme medizinische Fortschritte und
steigert das Ansehen des ärztlichen Standes. Riesige Krankenhäuser und
Kliniken werden nun gebaut und Ärzte, besonders jene an der
Universität, werden zu wohlhabenden Personen des öffentlichen Lebens.
Die bürgerliche Angst vor dem Spital, das früher der Armenversorgung
diente, verfliegt und es entsteht ein großer Markt für private
Dienstleister, die neueste Kuren und Therapien anpreisen. Gleichzeitig
tritt das Leid ärmerer Bevölkerungsschichten in den Fokus öffentlicher
Diskussion. Adel und Bürgertum überbieten sich mit Spenden an
Heilanstalten und Sanatorien. Auch die Ärzteschaft ist um
gesellschaftliche Repräsentation bemüht. Viele haben Kunstsammlungen
und Salons, und von offizieller Seite werden Büsten und Medaillen für
hervorragende Vertreter des Standes produziert. Hinter den Fassaden
stehen aber auch Neid und Missgunst an der Tagesordnung. Sie verhindern
wissenschaftliche Karrieren und konterkarieren den Fortschritt der
Medizin.

Modell des Wiener Allgemeinen Krankenhauses im Maßstab 1:288 - Oskar Hinterberger, Wien, 1940
Dieses Kartonmodell zeigt detailgetreu das Allgemeine Krankenhaus im
Jahr 1784. Trotz seiner Entstehungszeit weist es keine offensichtlichen
Bezüge zur NS-Zeit auf. Nur die Dachmarkierungen mit dem Schutzzeichen
des Roten Kreuzes verweisen auf den Krieg. Die 1938 im Innenraum schwer
beschädigte, aber nach außen intakte Synagoge (Hof 6) ist nicht als
solche erkennbar.

Giovanni Alessandro Brambilla
* 15. April 1728 in San Zenone al Po (IT), † 30. Juli 1800 in Padua (IT)
Brambilla stammt aus der Lombardei und beginnt 1752 ein Medizinstudium
in Padua. Er entwickelt ein besonderes Interesse für die Chirurgie und
ist im Siebenjährigen Krieg in einem österreichischen Regiment tätig.
Als erfolgreichen Militärchirurgen holt ihn der Thronfolger Joseph II.
als seinen Leibchirurgen nach Wien. Er begleitet Joseph auf zahlreichen
Reisen und ist Anfang der 1780er Jahre auch in größere Reformprojekte
eingebunden. Neben seinen Versuchen, die Militärchirurgie zu
vereinheitlichen, ist er die treibende Kraft bei der Gründung zweier
Institutionen in Wien: der militärischen Sanitätsschule (1781) und des
Josephinums.
Büste des Giovanni Alessandro Brambilla
Giovanni Alessandro Brambilla ist Gründungsdirektor des Josephinums und
ein entschiedener Verfechter chirurgischer Behandlungsmethoden. Unter
seiner Führung wird auch in Österreich die Chirurgie, die
traditionellerweise außerhalb der akademischen Medizin verortet war, zu
einem vollwertigen Teil der ärztlichen Ausbildung.

Die historische sogenannte Josephinische Bibliothek erhielt zur Zeit
der Gründung des Josephinums alles bis zu diesem Zeitpunkt
erschienenen, bedeutenden medizinischen und naturwissenschaftlichen
Werke. Mit mehr als 6.000 Bänden, die vor 1800 veröffentlicht wurden,
und etwa ebenso vielen Büchern aus dem 19. Jahrhundert, ist diese
Sammlung die größte Bibliothek historischer medizinischer Literatur im
deutschsprachigen Raum und eine der bedeutendsten Bibliotheken in
Europa. Heute sind zahlreiche weitere Sammlungen der Medizinischen
Universität Wien im Josephinum untergebracht, darunter umfassende
Instrumenten-, Bilder- und Archivaliensammlungen und Bibliotheken, die
die Geschichte der Medizin und den großen Beitrag der Wiener Schule der
Medizin zu deren Fortschritt dokumentieren.
Gerard van Swieten, Wien, 1760er Jahre

Maria Theresia als Kaiserin-Witwe - Portrait im Stile Joseph Hickels, Wien (?), um 1800
Mit Maria Theresia beginnt die enge Zusammenarbeit der Habsburger mit
ihren Ärzten. Die Regentin ist sich der Rückständigkeit des eigenen
Landes in medizinischen Fragen bewusst und holt internationale
Expertise nach Wien. Mit Van Swieten und De Haen kommen niederländische
Ärzte an ihren Hof, die Medizin nicht primär als starre Tradition
betrachten, sondern als am Krankenbett orientierte
Erfahrungswissenschaft. Der Medizinbetrieb und auch die Medizinische
Fakultät sollen nun nach diesen neuen Prinzipien ausgerichtet werden.
Die Regentin will der Skepsis der Bevölkerung entgegenwirken und selbst
ein Beispiel setzen. Ihre Kinder sind unter den ersten, die mit einem
neuen Verfahren gegen die Pocken immunisiert werden.

Institutionen der Wiener Medizin
Industrialisierung und Urbanisierung prägen Wien um 1900. Mit der Stadt
selbst wachsen auch die gesundheitlichen Probleme. Die katastrophale
Wohnsituation von großen Teilen der Bevölkerung ist Nährboden für
Krankheiten wie die Tuberkulose. Gleichzeitig bietet der medizinische
Fortschritt immer neue Möglichkeiten der Behandlung. Im Bürgertum
wächst das Vertrauen in die „Spitalsmedizin" und ein großer Markt für
private Dienstleister entsteht. Sowohl die öffentliche als auch die
private Gesundheitsversorgung wird um die Jahrhundertwende ausgebaut.

Lehre und Forschung
Das Ideal von objektiver, unabhängiger und allen zugänglicher Lehre und
Forschung gewinnt seit dem 18. Jahrhundert an den Universitäten an
Einfluss. Trotzdem bleiben Religion und Politik bestimmende Einflüsse
auf die Entwicklung der Wissenschaften. Die Frage, wer an der
Universität lehren oder lernen darf, ist zeitweilig Gegenstand heftiger
Auseinandersetzungen. Auch die Forschung selbst ist ständiger
Veränderung unterworfen. Neue Erkenntnisse bringen alte Sicherheiten
ins Wanken, lassen Fächer entstehen und wieder verschwinden und
eröffnen neue Perspektiven auf scheinbar vertraute Themen. Immer im
Fluss und ständig hinterfragt ist medizinische Wissenschaft nie bloße
Theorie. Man kann sie hören, sehen und anfassen. Die tiefgreifenden
Fragen, die sie an das Objekt ihrer Forschung - den Menschen - stellt,
werden auch in Zukunft neue Blickwinkel und Kontroversen eröffnen.

Krankheit und Gesundheit
Krankheiten werden von zahlreichen Faktoren hervorgerufen und immer
individuell empfunden. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird es zu
nehmend üblich, krankhafte Abweichungen an der Leiche zu untersuchen
und mit den klinischen Befunden in Beziehung zu setzen. Ein
medizinisches Verständnis von Ort, Ursache und Wirkung prägen das
Konzept des Krankheitsprozesses. Die Pathologie entwickelt sich zu
einer eigenständigen Disziplin. Sie wird im Laufe des 19. Jahrhunderts
zu einer der wichtigsten Säulen der Medizin. Das naturwissenschaftliche
Denken, der enorme Wissenszuwachs und der technische Fortschritt führen
zu modernen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, welche die
Grundlage der gegenwärtigen Medizin bilden.

Das Josephinum, eine unverwechselbare bauliche Ikone, ist das
historische Eingangstor zur Wiener Medizin. Es wurde 1785 von Joseph
II. im Rahmen seiner radikalen Reformen zur akademischen Ausbildung der
Militärärzte und Chirurgen gegründet und von Isidore Canevale als
herausragendes Bauwerk der Aufklärung erbaut. Es beherbergt die
international bedeutenden und einzigartigen Sammlungen der
Medizinischen Universität Wien und präsentiert sie auf zwei Ebenen.
Wesentliche Sammlungsbestände, wie die anatomischen Wachsmodelle aus
dem Jahr 1785, die Person Josephs II., die Geschichte des Josephinums
als radikale Idee der Aufklärung, die Erste und Zweite Wiener
Medizinische Schule mit Verweisen bis zur heutigen Hightech-Medizin und
die Wiener Medizinische Fakultät 1938-1945 werden in dieser permanenten
Ausstellung unter zeitgemäßer Schwerpunktsetzung gezeigt.
Das Josephinum dient heute als Plattform für Kontakt und Austausch mit
Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern. Eine wesentliche Aufgabe ist
es, das kulturelle Erbe zu sichern, zu erschließen und zugänglich zu
machen, sowie Dokumente und Objekte zu übernehmen um die Sammlungen zu
erweitern.

Apparat zur Bluttransfusion nach Reinhold Boller, Carl Reiner GmbH Wien, 1932
Das Gerät ist eine Wiener Entwicklung. Seit der revolutionären
Entdeckung der Blutgruppen durch Karl Landsteiner im Jahr 1901 werden
Bluttransfusionen zu einem immer wichtigeren Bestandteil der klinischen
Praxis. Als dieses Gerät entwickelt wird, hat Landsteiner Österreich
längst verlassen, um in New York unter besseren Bedingungen forschen zu
können.
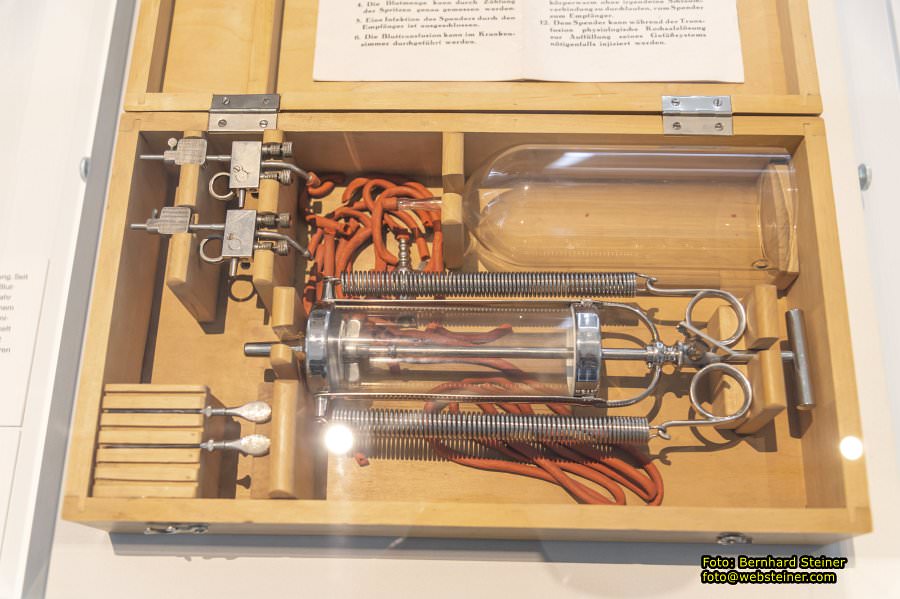
Darstellung eines Sanitäts-Eisenbahnzugs und eines Krankentransportschiffes mit Einrichtung, Um 1870
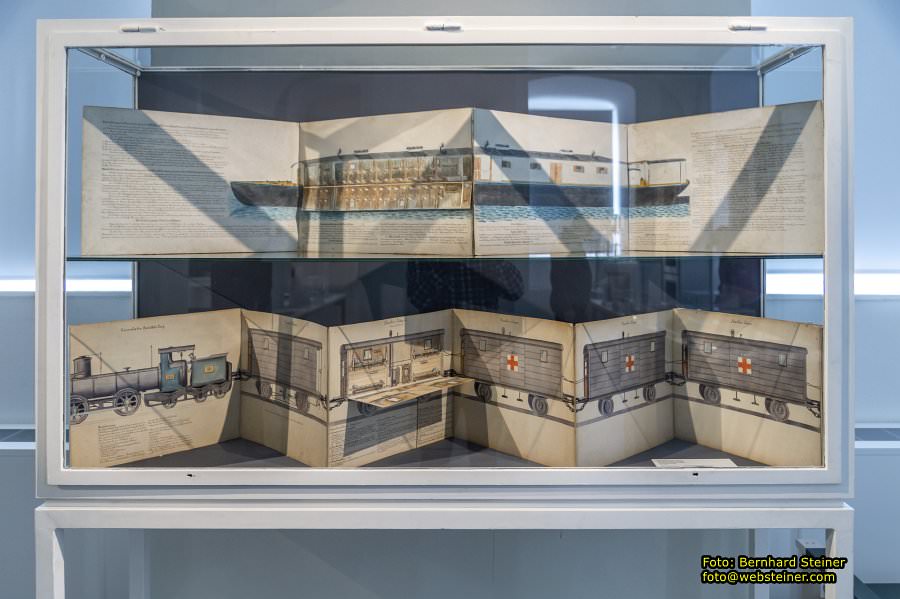
Hygiene Austria-Masken, China/Österreich, 2021/22
Masken sind in der Covid-19-Krise bald allgegenwärtig und werden zum
Verkaufsschlager. Die Möglichkeit rascher Profite führt zu manchem
Skandal. Im März 2021 fliegt bei Hygiene Austria ein massiver
Etikettenschwindel auf: „Made in China" wurde kurzerhand zu „Made in
Austria".
Notbetten in der Messe Wien, Foto: C. Jobst/PID Wien, 17. März 2020
Als Vorsorgemaßnahme lässt die Stadtverwaltung in der Messe Wien 2.240
Krankenbetten für Covid-19-Erkrankte aufstellen. Der befürchtete
Zusammenbruch des Gesundheitssystems kann verhindert werden, sodass nur
ein kleiner Teil dieser Betten tatsächlich belegt wird.
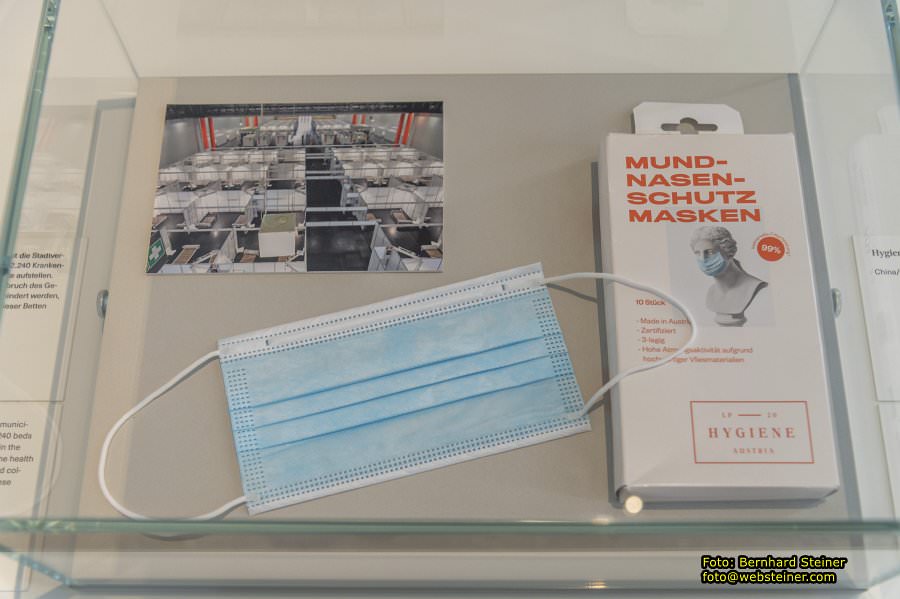
Die Choleraepidemie 1873
im 1. Wiener Gemeindebezirk von Anton Drasche Wien, Artaria & Co., 1874
Auf dieser Karte verzeichnet der Epidemiologe Drasche die
Erkrankungsfälle der Choleraepidemie von 1873. Damit lässt sich die
Verbreitung verunreinigten Wassers im 1. Bezirk erkennen. Die Eröffnung
der I. Wiener Hochquellenleitung im selben Jahr hemmt die Verbreitung
der Cholera entscheidend.

Die international bedeutenden und einzigartigen Sammlungen der
Medizinischen Universität Wien präsentieren sich auf zwei Ebenen.
Wesentliche Sammlungsbestände, wie die anatomischen Wachsmodelle, die
Person Josephs II, die Geschichte des Josephinums als radikale Idee der
Aufklärung, die Erste und Zweite Wiener Medizinische Schule mit
Verweisen bis zur heutigen Hightech-Medizin und die Wiener Medizinische
Fakultät 1938-1945 werden in dieser permanenten Ausstellung unter
zeitgemäßer Schwerpunktsetzung gezeigt.
Physiologische Objekte 1855-1932

Ernst Wertheim bei einer gynäkologischen Operation - John Quincy Adams Wien, 1907
Wertheim operiert eine durch Myome vergrößerte Gebärmutter. Ihm
assistieren Wilhelm Weibel (links), Theodor Micholitsch (rechts, mit
Vollbart) und der Narkotiseur Bartuschofsky. Weder der Name der
Patientin noch der instrumentierenden OP-Schwester ist überliefert. Die
Ordenstracht verweist auf die Barmherzigen Schwestern vom heiligen
Vinzenz von Paul. Als das Gemälde 1909 im Wiener Künstlerhaus
ausgestellt wird, entwickelt sich eine Diskussion über die
künstlerische Darstellbarkeit und Präsentation einer solchen Operation.
„Warum denn nicht?", antwortet Wertheim, das Publikum soll uns bei der
Arbeit sehen; es soll eine Vorstellung davon bekommen, wie solche Dinge
beiläufig vor sich gehen. Nur kein Geheimnisvoll-Tun in ärztlichen
Dingen!"

Büsten von Kriegsversehrten, Lublin (PL), 1914-1918
Im Lazarett Lublin dokumentiert Juljan Zilz die Verletzungen seiner
Patienten in Form von Gipsbüsten. Sie sind ein wichtiges Zeugnis für
das vom Krieg verursachte Leid sowie für die Möglichkeiten der
damaligen Kieferchirurgie, aus der die plastische Chirurgie hervorgeht.

Biopolitik der Gegenwart
Das Wort „Volkskörper" ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, aber
ein staatliches Interesse an der Gesundheit der Bevölkerung besteht
weiter. Statistische Erhebungen zur allgemeinen Konstitution und die
Dokumentation verschiedener Krankheiten sind die Grundlage für
präventive Maßnahmen und Aufklärung. Die engmaschige Kontrolle der
medizinischen Versorgung, aber auch der Bevölkerung haben die
Lebenserwartung massiv gesteigert. Doch durch unvorhergesehene
Ereignisse, aber auch mit jeder Innovation kommen neue Fragen in diesem
komplexen Themenfeld auf. Die Debatten der Biopolitik werden deshalb
auch die kommenden Jahrzehnte prägen.
Mutter-Kind-Pass, Wien, 1987
Bis in die 1970er Jahre herrscht in Österreich im Vergleich zu anderen
Industrieländern eine besonders hohe Säuglingssterblichkeit. Mit der
Einführung des Mutter-Kind-Passes, in dem Untersuchungen sowohl der
werdenden Mutter als auch des Kindes festgeschrieben sind, gelingt eine
massive Senkung.
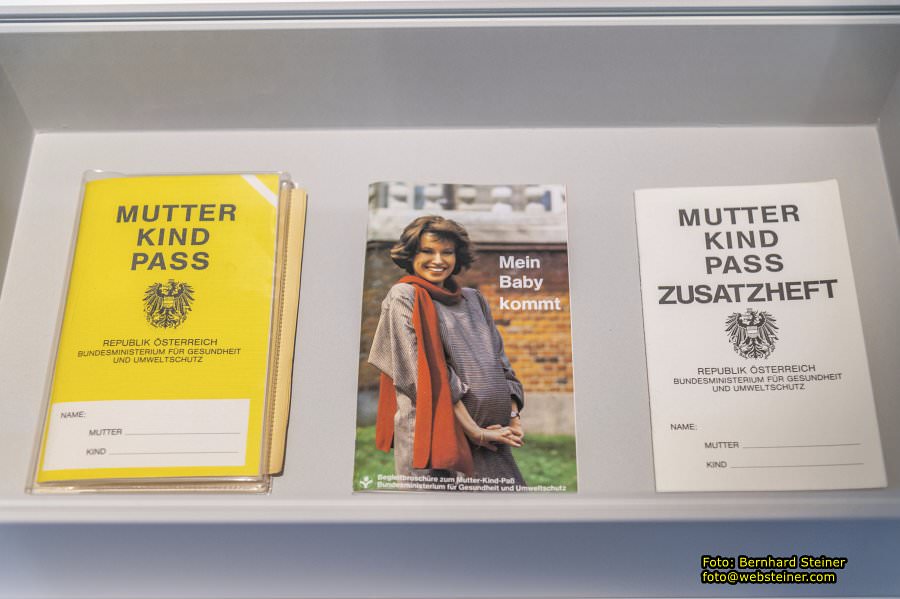
Ursprünge der Biopolitik
Lange ist die Seuchenbekämpfung die einzige staatlich organisierte
gesundheitspolitische Aktivität. Im 18. Jahrhundert kommen auch andere
Krankheiten und Fragen der Reproduktion ins Blickfeld der Obrigkeit.
Das Interesse des Staates an Medizin und dem Zustand der Bevölkerung
nimmt nun rapide zu. Immer mehr Informationen werden von öffentlichen
Stellen gesammelt, Gesundheitsberufe reguliert und die medizinische
Versorgung ausgebaut. Mit Anreizen und Information, manchmal aber auch
mit Androhung von Strafen wird versucht, auf die Bevölkerung
einzuwirken. Die Wissenschaften und ihre Erkenntnisse sind hier ein
treibender Faktor, aber moralische und medizinische Vorstellungen
verschwimmen oftmals ineinander.
Sigmund Freud - Hans Frank, Wien, vermutlich zwischen 1920 und 1930
Dieses Portrait Sigmund Freuds ist heute wenig bekannt. Seine
Geschichte steht für eine komplexe Vergangenheit und deren
Nachwirkungen. Denn während Freud Wien 1938 verlassen muss und wenig
später im Londoner Exil stirbt, beginnt für den Künstler Hans Frank
eine Zeit der Erfolge. Im Nationalsozialismus wird der Portrait-und
Landschaftsmaler von vielen Seiten gefördert und erhält zahlreiche
Auszeichnungen, wie den Kriehuber-Preis und den Ehrenpreis der Stadt
Wien (beide 1944). Nach 1945 verschwindet sein Name aus der
Öffentlichkeit. Einzig sein Freud-Portrait wird zu Werbezwecken genutzt.

Medizin und Gedächtnis
Geschichte ist das Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und
wird immer wieder neu erzählt. Historische Objekte - wie jene in den
Sammlungen des Josephinums - sind ein Rohstoff für diese Prozesse. Sie
wurden aus unterschiedlichen Gründen gesammelt: um den Ruhm einzelner
Mediziner:innen zu bewahren, um große Forschungsergebnisse zu feiern
oder Auseinandersetzungen zu dokumentieren. Einzelne Stücke landen auch
zufällig in den Sammlungen, sind Teile von Nachlässen oder Funde von
Sammler:innen mit speziellen Interessen. Zahlreiche andere Objekte
wurden nicht bewahrt aus Missgunst, aufgrund von Vorurteilen oder weil
sie in der Vergangenheit schlicht für unwichtig gehalten wurden. Die
Sammlungsbestände eines Museums und ihre Lücken eröffnen damit auch
neue Perspektiven auf die Vergangenheit. Ihre kritische Betrachtung
gibt gleichzeitig Einblicke in die gegenwärtige Gesellschaft und ist
die Grundlage für das weitere aktive Sammeln des Hauses.
Portraits 1850-1950
Diese Portraits von Vertreter:innen der Wiener Medizin sind Ausdruck
aktiv inszenierter Erinnerung. Teilweise von berühmten Künstler:innen
gemalt, sind sie auch von kunstgeschichtlicher Relevanz und
dokumentieren eine Epoche bürgerlicher Selbstrepräsentation aus der
Zeit von 1850 bis 1950.

Verehrung und Missgunst
Im 19. Jahrhundert organisiert sich die Ärzteschaft zunehmend in
wissenschaftlichen und standespolitischen Vereinigungen. Preise,
Geschenke und Erinnerungsmedaillen aus dieser Zeit verweisen auf
Praktiken gesellschaftlicher Anerkennung, manchmal sogar Verehrung.
Berühmte Ärzte erhalten Geschenke und werden in Büsten und Gemälden
verewigt. Die Kehrseite bilden Konkurrenz, Neid und Intrigen nicht
selten motiviert durch Antisemitismus, Misogynie und sonstige
Ressentiments. Diese richten sich oft gerade gegen die erfolgreichsten
Kolleg:innen und behindern so manche Innovation.
Kunst, Literatur und andere Leidenschaften
Viele Mediziner gehen um 1900 auch Tätigkeiten in anderen Bereichen
nach. Manche schreiben Bücher und Theaterstücke, andere sind als
Sammler und Kunstexperten aktiv. Die Beschäftigung mit den schönen
Künsten gilt als Statussymbol. Wer selbst kein Literat oder Mäzen ist,
kann im kunstaffinen frühen 20. Jahrhundert auch Nachdrucke berühmter
Kunstwerke im Katalog bestellen. Doch nicht nur in der Kunst sind Ärzte
tätig, manche widmen sich auch technologischen Innovationen. Sie lassen
sich in den gefragtesten Fotostudios ablichten, gehören zu den ersten
Autofahrern und einer ist auch ein Pionier der Luftfahrt.

Studierendenobjekte
Wem und auf welche Art medizinisches Wissen weitergegeben werden soll,
ist um 1900 eine heiß diskutierte Frage. Das umstrittene Frauenstudium,
praxisorientierte Zugänge, aber auch neue Kunstrichtungen beeinflussen
den Universitätsbetrieb. Medizinisches Wissen wird auch durch
vielfältige Artefakte vermittelt, die den Alltag der Studierenden
prägen und in manchen Fällen auch widerspiegeln.
Reliefs bedeutender Ärzte 1850-1930

Eduard Albert
* 20. Januar 1841 in Senftenberg/Žamberk (CZ), † 26. September 1900 in Senftenberg/Žamberk (CZ)
Der in Böhmen geborene Chirurg ist Vorreiter der Antiseptik und
Leibarzt bei Hof. Er fördert als Mäzen, Lyriker und Übersetzer die
Künste ebenso wie die tschechische Sprache. Im letzten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts wird er jedoch durch seine Streitschrift gegen das
Frauenstudium zur umstrittenen Figur. Darin schreibt er über die
angebliche mangelnde geistige Schaffenskraft der Frauen und deren
„physische und psychische Untauglichkeit" für das Medizinstudium.
Gabriele Possanner
* 27. Jänner 1860 in Budapest, † 14. März 1940 in Wien
Possanner maturiert 1887 am Akademischen Gymnasium in Wien. Als Frau
ist sie zu keinem Universitätsstudium in der Donaumonarchie berechtigt,
daher studiert sie von 1888 bis 1893 in Genf und Zürich Medizin. Nach
ihrer Promotion 1894 kehrt sie nach Wien zurück. Durch kaiserliche
Erlaubnis und nachdem sie alle theoretischen und praktischen Prüfungen
des Medizinstudiums in Wien nochmals ablegt, promoviert Possanner am 2.
April 1897 als erste Medizinerin Österreichs an der Wiener Universität.
Noch im selben Jahr eröffnet sie eine Praxis, wird erstes weibliches
Mitglied der Wiener Ärztekammer und 1928 Medizinalrätin. Durch ihren
unermüdlichen Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen trägt
Possanner wesentlich zur Öffnung des Medizinstudiums in Österreich bei.
Eduard Albert, Die Frauen und das Studium der Medizin Wien, Alfred Hölder, 1895
Portrait von Gabriele Possanner, der ersten in Wien promovierten Ärztin Wien, 1897
Die Öffnung des Medizinstudiums für Frauen ist um 1900 eine
leidenschaftlich diskutierte Frage. In der öffentlichen Debatte nimmt
der Chirurg Albert eine radikale Position ein. Er ist der „tiefste[n]
Überzeugung, dass sich der Arztberuf nicht für Frauen eignet". Allen
Widerständen zum Trotz gelingt es Gabriele Possanner 1897 ihr in der
Schweiz abgelegtes Medizinstudium nostrifizieren zu lassen und eine
eigene Praxis in Wien zu eröffnen.
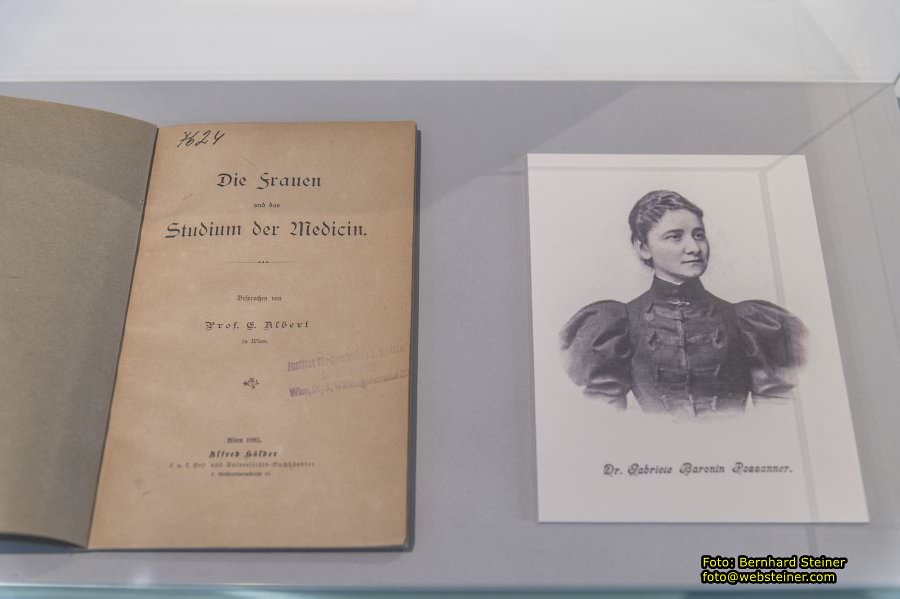
Lehre und Forschung
Das Ideal von objektiver, unabhängiger und allen zugänglicher Lehre und
Forschung gewinnt seit dem 18. Jahrhundert an den Universitäten an
Einfluss. Trotzdem bleiben Religion und Politik bestimmende Einflüsse
auf die Entwicklung der Wissenschaften. Die Frage, wer an der
Universität lehren oder lernen darf, ist zeitweilig Gegenstand heftiger
Auseinandersetzungen. Auch die Forschung selbst ist ständiger
Veränderung unterworfen. Neue Erkenntnisse bringen alte Sicherheiten
ins Wanken, lassen Fächer entstehen und wieder verschwinden und
eröffnen neue Perspektiven auf scheinbar vertraute Themen. Immer im
Fluss und ständig hinterfragt ist medizinische Wissenschaft nie bloße
Theorie. Man kann sie hören, sehen und anfassen. Die tiefgreifenden
Fragen, die sie an das Objekt ihrer Forschung - den Menschen - stellt,
werden auch in Zukunft neue Blickwinkel und Kontroversen eröffnen.
Carl Rokitansky - Gipsbüste von Viktor Oskar Tilgner, Wien, 1874
Rokitanskys Forschungsort ist der Obduktionssaal. Durch die
Klassifizierung von krankhaften Erscheinungen am Leichnam und die
Zuordnung zu den Symptomen der Patient:innen schafft er ein
übersichtliches System für die Diagnose. Er entwickelt ein
medizinisches Verständnis von Ursache und Wirkung und gilt als
Begründer der modernen Pathologie.

Hervorgegangen ist das Josephinum aus einer medizinisch-chirurgischen
Schule, die Joseph 1781 auf Veranlassung Brambillas im Militärhospital
zu Gumpendorf errichten ließ. Brambilla fungierte bis 1795 als Direktor
des Collegiums. Am 3. Februar 1786 wurde die Akademie allen übrigen
Fakultäten gleichgestellt und erhielt das Recht, Doktoren und Magister
der Medizin und Wundarznei zu graduieren. Für die Akademie wurde in der
damaligen Alservorstadt, im heutigen 9. Wiener Gemeindebezirk, in der
heutigen Währinger Straße 25, 1783 bis 1785 ein Neubau nach Plänen von
Isidor Marcellus Amandus Canevale errichtet.
