web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Kapfenberg
mit Burg Oberkapfenberg, Juli 2024
Kapfenberg ist mit etwa 22.000 Einwohnern die
drittgrößte Stadt im österreichischen Bundesland Steiermark und liegt
zwischen Kindberg und Bruck an der Mur am Fluss Mürz im Mürztal.
Bekannt wurde die im Jahr 1145 zum ersten Mal urkundlich erwähnte Stadt
vor allem durch die ansässige Stahlindustrie. Die Burg Oberkapfenberg
oberhalb von Kapfenberg ist Teil der 1145 erstmals erwähnten Burg
Kapfenberg, die im 13. Jahrhundert von den Grafen von Stubenberg als
Wohn- und Verwaltungssitz erbaut und um 1550 zur Renaissance-Festung
umgebaut wurde.

Peter Rosegger Denkmal - Dieses Denkmal befindet sich abseits der
traditionellen Orte Krieglach und Mürzzuschlag in Kapfenberg am Fuße
der Burg Oberkapfenberg
Der sogenannte Waldschulmeisterbrunnen, ein Denkmal zu Ehren von Peter
Rosegger, wurde von Hans Brandstetter geschaffen und am 21. Juli 1908
eingeweiht. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums wurde die Bronzeskulptur
umfassend restauriert.

Der heute noch erkennbare Straßenplatz an der Rückseite des Rathauses
bildete den Marktplatz der ersten Siedlung, die um 1130 von den Herren
von Stubenberg angelegt worden war. Bis etwa 1930 stand hier ein
öffentlicher Brunnen. Die Durchzugsstraße führte, von der oberen
Mürzbrücke kommend, durch die Wiener Straße, weiter über diesen
Marktplatz durch die jetzige 12.-Februar-Straße (früher Rüsthausgasse),
sowie in deren Verlängerung über die untere Brücke, die damals etwa an
der Stelle der heuti-gen Fußgängerbrücke lag. Um 1740 waren in der
12.-Februar-Straße folgende Handwerker ansässig: Schuster (Nr. 2),
Bohrerschmied (Nr. 4), Baader (Nr. 6 und 8), Tischler (Nr. 10, später
Gasthaus "Sandwirth").

Rathaus / Stadtamt
Um 1130 angelegt, ist der ehemalige Meierhof der Herren von Stubenberg
das älteste Gebäude in der Altstadt. Nach der Aufteilung der
stubenbergischen Besitzungen in die Herrschaften Ober- und
Unterkapfenberg im Jahr 1650 wurde die Gebäudeanlage mit U-förmigem
Grundriss und mächtigem Walmdach zum Schloss Unterkapfenberg ausgebaut.
Vielfach um- und nach Bränden wieder aufgebaut, zeigt das Rathaus heute
eine klassizistische Fassade, die um 1840 gestaltet wurde. Innerhalb
der Dachtraufe dieses stubenbergischen Freihauses galt nur der
Richtspruch der Herren von Stubenberg. Straftäter, die sich in diesen
(bis 1934) mit Ketten gekennzeichneten Bereich flüchteten, entzogen
sich dem Einfluss des Marktrichters. 1808 verkaufte Graf Stubenberg die
Herrschaft Unterkapfenberg mit dem Schloss sowie allen Gütern und
Rechten an den Hammerherrn Franz Michael Schragl, der sie 1813 an
Michael Göschl abtrat. 1909 erwarb die Marktgemeinde Kapfenberg das
Gebäude und baute es nach dem Entwurf von Arch. Prof. Johann Wist zum
Rathaus um. Am 25. März 1911 fand die erste Sitzung des Gemeinderats im
neuen Ratsaal statt.

Koloman-Wallisch-Platz /Hauptplatz
Um 1240 wurde der zentrale Platz im Zuge einer planmäßigen Erweiterung
der seit 1130 gewachsenen Siedlung angelegt. Die Grundmauern der Häuser
reichen in diese Zeit zurück. Die oberen Geschoße stammen meist aus dem
16. Jhdt, erfuhren aber nach dem großen Marktbrand im Jahr 1814 weitere
Veränderungen. Der Marktbrunnen befand sich bis etwa 1930 im westlichen
Teil des Platzes. Von 1738 bis 1947 stand vor dem Haus Nr. 8 eine
Pestsäule. Im 20. Jhdt führte der Durchzugsverkehr diagonal über den
Platz bis 1992 die Fußgängerzone eingerichtet wurde. 1935 erhielt der
Hauptplatz den Namen „Dr.-Dollfuß-Platz", am 9. Mai 1938 wurde er in
„Adolf-Hitler-Platz" umbenannt und seit dem 20. März 1946 trägt er den
Namen „Koloman-Wallisch-Platz".
Koloman Wallisch (1889-1934)
Als sozialdemokratischer Parteisekretär und ehem. Landtags- und
Nationalratsabgeordneter hatte er am 12. Februar 1934 auf Bitten seiner
Parteigenossen im Aufstand gegen die Dollfußdiktatur die Führung der
Kampfhandlungen in Bruck/Mur und Kapfenberg übernommen. Am 18. Februar
1934 wurde er dafür im Landesgericht Leoben standrechtlich hingerichtet.
Nr. 3: Willbacher-Hof
Ehem. Gasthof „Zum goldenen Engel". Das Einfahrtstor führt in den
geräumigen Innenhof mit zweigeschossigen Arkaden (Renaissance um 1580),
an der Brüstung Sgraffitoverzierungen.
Nr. 5: Wukitschewitsch-Haus
Ehem. Gasthof "Elefantenwirth". Das Steinquaderportal in der Grazer
Straße ist mit „1700" datiert. Seit Anfang des 20. Jhdts befindet sich
hier eine Bäckerei. 1992 wurde das Haus nach Vorlagen des aus
Kapfenberg stammenden Malers Helmut Kand bemalt.
Nr. 7: Zwittnig-Haus
Im 18. und 19. Jhdt war hier eine "bürgerliche Behausung mit realer
chyrurgischer Gerechtsame" vermerkt. Ein Rundbogenportal aus Sandstein
und eine Balkendecke aus 1638 sind erhalten.
Nr. 8: Pötsch-Haus
Im Jahr 1803 wurde „das Reale Krämerjus" (Handelsberechtigung) hierher
übertragen. Der klassizistischen Fassade ist ein Flacherker vorgebaut,
im Giebel in zwei Stuckreliefs, Neptun und Merkur. Im Hof ist eine
Arkade aus dem 16. Jhdt erhalten.

Altes Rathaus
Im Kern stammt der vierachsige Bau aus der Zeit der Markterweiterung um
1240. Die heutige stuckierte Rundgiebelfassade ist in barocker
Tradition gehalten. 1602 kaufte Hans Pölchinger, Wirt in Seiz, das
"Haus am Platz, darauf die Uhr steht". Im Turm befand sich die
Marktuhr, deren genaue Zeitanzeige und das Aufziehen schon im 16.
Jahrhundert zu den Pflichten des märktischen Schulwartes gehörten. 1604
überließ Pölchinger dieses Haus für 300 Gulden der Bürgerschaft des
Rates „damit man gemeines Marckhts gehörige Sachen, Wehren und
briefliche Urkhundten darynnen in Verwahrung behalten mag". Die älteste
Darstellung des Hauses zeigt es um 1680 mit einem hohen Turm und
Zwiebelhelm. 1814, beim großen Marktbrand, wurde der Turm zerstört und
mit ihm die darin befindlichen Urkunden des Marktes. Bis 1911 diente
dieses Gebäude als Rathaus, danach wurden im Erdgeschoss Geschäfte
untergebracht und große Auslagenfenster ausgebrochen. Mit der
Renovierung 1987 wurde die Fassade wieder zum Stil des Gebäudes passend
rückgebaut.
Wappen der Stadt
Am 15. Dezember 1639 verlieh Kaiser Ferdinand III. auf Bitten des
Marktherrn, Wolff, Herr von Stubenberg, dem Markt Kapfenberg ein Wappen
mit folgender Beschreibung:
In einem blauen Schild steht über
fließendem Wasser eine gewölbte Steinbrücke, auf deren Mitte das
Wappentier, ein goldener Löwe mit rot ausgeschlagener Zunge steht.
Dieser trägt eine Königskrone und hält in den Pranken das Wappen des
Hauses Stubenberg, einen silbernen Anker. Durch den Ring des Ankers ist
ein goldfarbener Zopf gezogen.
Der Zopf weist auf die Mitgliedschaft der Herren von Stubenberg in der
„Ritterlichen Gesellschaft vom Zopfe" hin. Das Volk hat um diesen Zopf
eine romantische Sage mit Agnes von Pernegg und Wulfing von Stubenberg
gedichtet.

MARTIN KARLIK "Straßenmusikant" 2014

Romantica über die Mur

Werbetestimonial vor dem Dieselkino

Röm.-kath. Pfarre Kapfenberg - St. Oswald
Erste urkundliche Erwähnung: 1330
Pfarrkirche: 1374
heute sichtbar: gotischer Bau (Stützpfeiler) aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts
großzügiger Umbau (1752-55), Innenausstattung: Veit Königer (1770-1780)
letzte Renovierung: ab 2003
Turm: 1710: Barocke Haube; 1834: Blitzschlag; seither: jetziges Aussehen
Glocken: 4 stählerne Glocken aus den Jahren 1916-23 (Fa. Böhler)

Die Pfarrkirche Kapfenberg-St. Oswald steht in der Stadt Kapfenberg im
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark. Die zu Ehren des heiligen
Oswald geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat
Bruck an der Mur in der Diözese Graz-Seckau.
Das Altarbild am Hochaltar, gezeichnet von J. V. Hauckh, zeigt den hl.
Oswald; die Statuen des hl. Florian und des hl. Donatus sind nach der
Art des Jakob Peyer gefertigt.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der
spätgotische Sakralbau im Jahr 1330, die Pfarre wurde 1374 errichtet.
Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche mit heute noch
erkennbaren Teilen in gotischem Stil erweitert. Das Sternrippengewölbe
des Chors ruht auf Konsolen; es hat runde Schlusssteine mit einem
Wappen der Familie Stubenberg. Die Oratoriumsloge ist im Stil des
Rokoko gestaltet. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, von 1752 bis 1755,
kam es zu einem Umbau im Stil des Barock. Der dreigeschossige Turm
stammt aus dem Jahr 1710 und trug ursprünglich eine barocke Haube,
bevor diese 1834 durch einen Blitzschlag zerstört und durch den
gegenwärtigen Spitzhelm ersetzt wurde. Die Glasfenster stammen aus den
Jahren 1912 und 1953.


Die Orgel aus dem Jahr 2015 baute die slowenische Orglarska Delavnica mit 22 Registern im historischen Gehäuse von 1776.

Die mit reicher Rokoko-Dekoration verzierte Orgel wurde um 1770 gebaut.
Der gotische Taufstein hat einen Rokoko-Aufsatz, die Kirchenbänke
stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die
Kreuzwegstationen schuf 1974 Otto Daringer.

Sämtliche Altäre und Statuen im Kircheninnenraum sind im Stil des
Rokoko (18. Jahrhundert) gehalten und stammen wahrscheinlich zum
Großteil aus der Hand des in Graz lebenden Südtiroler Bildhauers Veit
Königer, besonders jene Figuren der Seitenaltäre und das „Heilige Grab“.

Der zweijochige Chor der Pfarrkirche, der Westturm mit Spitzhelm und
einige ihrer Portale sind vom Stil der Spätgotik geprägt. Das
dreischiffige Langhaus wurde hingegen barockisiert und die Kirche von
1752 bis 1755 insgesamt barock erweitert. Die gute Rokokoeinrichtung
stammt aus der Zeit nach 1770. Das Gebäude wurde im Jahr 2018 umfassend
saniert.

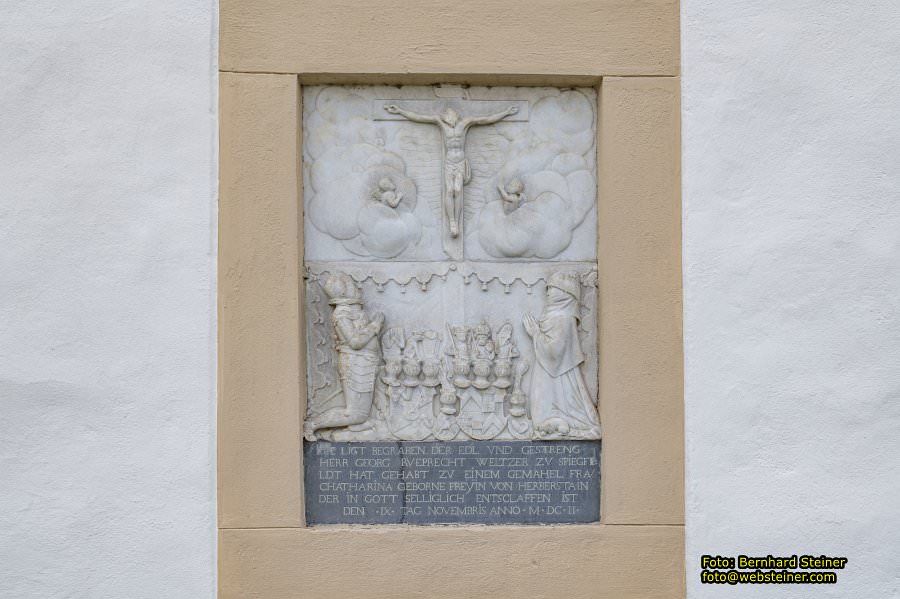
Mariensäule / Pestsäule
1738 errichtet auf dem Platz vor dem Rathaus im Auftrag des Rates zu
Kapfenberg als Erinnerung an die Errettung vor der Pest, Säule mit
Statuen geschaffen vom Grazer Barockbildhauer Johann Matthias Leitner
und dem Steinmetz Andreas Zeller
1947 aus verkehrstechnischen Gründen am Hauptplatz abgetragen
1968-1972 hier bei der Stadtpfarrkirche St. Oswald originalgetreu in
Kopie aus Kunststein wieder aufgestellt, stark beschädigte Originale
aus Aflenzer Kalksandstein verschollen
Figuren von links nach rechts:
Hl. Florian - Schutzpatron gegen Feuer
Hl. Sebastian - Schutzpatron der Sterbenden
Hl. Rochus - Schutzpatron gegen die Pest
Hl. Johannes Nepomuk - Schutzpatron gegen Überschwemmungen
Oben in der Mitte: Maria, die Gottesmutter mit dem Jesukind

Kontrollpunkt für Smartphones
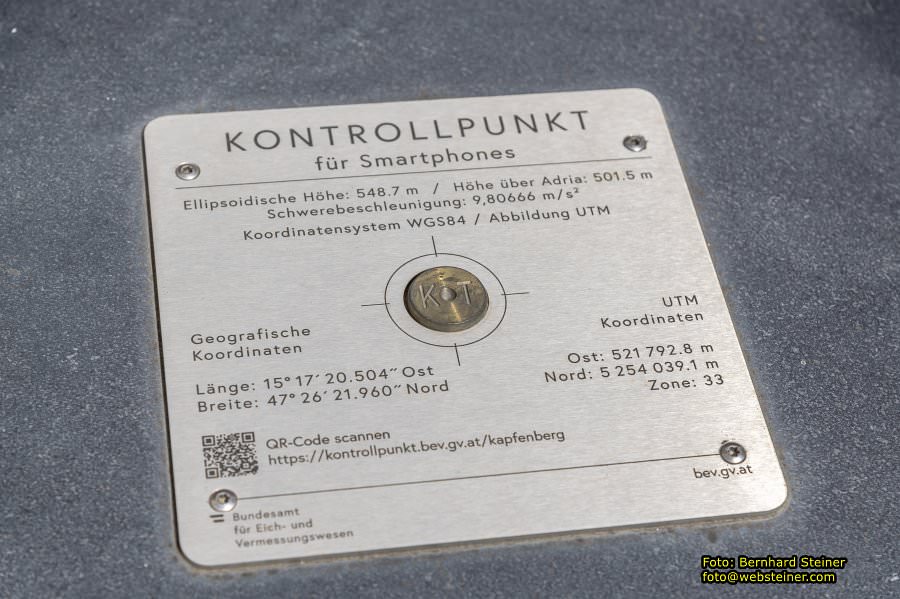
Ehem. Freihaus Stubenberg/Stadtamt, Koloman-Wallisch-Platz 1
Der Grundstein des ehemaligen Meierhofes der Stubenberger wurde um 1130
angelegt. Heute das älteste erhalten gebliebene Gebäude der Altstadt.
Der zweigeschoßige Bau ist im Grundriss u-förmig und mit einem Walmdach
versehen. Ab 1650 wurde das Haus zum Schloss Unterkapfenberg
umgestaltet und nach Bränden mehrmals wieder auf- und umgebaut. Die
Innentreppe stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Fassade wurde 1840 im
klassizistischen Stil gestaltet. 1808 verkauften die Stubenberger das
Gebäude an den Hammerherren Franz Michael Schragl, dieser veräußerte es
1813 an Michael Göschl. 1909 erwarb schließlich die Stadt Kapfenberg
das Haus und ließ es nach den Plänen des Architekten Johann Wist zum
Verwaltungsgebäude umgestalten. Das Haus galt lange Zeit auch als
Freihaus, d. h. jeder Straftäter, der sich unter sein Dach flüchtete,
unterstand rechtlich der Gerichtsbarkeit der Stubenberger und nicht der
des Marktrichters.

Lorettokapelle
1676 auf den Resten der 1173 urkundlich erwähnten ersten Burg
„Chaffenberch" erbaut. Die Kapelle ist ein rechteckiger fensterloser
Bau mit enger Sakristei und Musikchor. 1770 wurde die heutige
Rokokoeinrichtung gestaltet. Das Standbild der Maria Loretto ist eine
schlanke stehende Figur mit einem tonnenförmigen Kleid, das Jesuskind
eng am Körper haltend. Diese Maria Loretto ist eine so genannte
Schwarze Madonna. Die Kapfenberger Maria Loretto erfreute sich
lebhafter Verehrung. Zahlreiche Votivbilder im Inneren der Kapelle
zeugen von ihrer Wundertätigkeit. Die Bürgerschaft trug die Statue in
Prozessionen durch den Markt und vertraute auf ihre Hilfe gegen die
großen Gefahren der Pest und des Feuers. Die Tradition der
Loretto-Feste wird bis zum heutigen Tag einmal im Jahr, am
„Zwetschkenblühsonntag", dem 5. Sonntag nach Ostern, fortgesetzt. Der
im Jahr 2005 erneuerte, überdachte Aufgang ist der Vorlage auf einem
Votivbild aus dem 18. Jahrhundert nach empfunden.
Der Aufstieg zur Lorettokapelle wurde in der Zeit von 1.8.-12.8.2005 von der Pionierkompanie Stb B7 errichtet.
Und leider ist die Kapelle geschlossen.

Die Burg Oberkapfenberg ist
eine Höhenburg oberhalb von Kapfenberg, nordöstlich von Bruck an der
Mur in der Steiermark (Österreich). Im Jahr 1173 wurde hier erstmals
eine Burg Chaffenberch (Burg am Ausschauberg) erwähnt. Reste ihres
Oberhaues sind noch unterhalb der Loreto-Kapelle zu erkennen. Im 13.
Jahrhundert erbauten die Grafen von Stubenberg die heutige Burg als
Wohn- und Verwaltungssitz. Um 1550 erfolgte der Umbau zur
Renaissance-Festung. Nachdem die Grafen von Stubenberg im Jahr 1739
ihren Wohnsitz ins Schloss Wieden an der Mürz verlegt hatten, stand die
Burg Oberkapfenberg leer und verfiel zur Ruine. Erst 1953 begann Graf
von Stubenberg mit dem Wiederaufbau zu einem Burghotel unter
Einbeziehung der Ruinen der alten Burg. Aber im Jahr 1985 ging der
Pächter in Konkurs und die Burg stand erneut leer und begann zu
verfallen.

Die Burg Oberkapfenberg wurde im Jahre 1268 von den Herren von
Stubenberg als Wohnburg und als Verwaltungssitz für ihre großen
Besitzungen im Mürztal erbaut. Die Anlage der ersten Burg bei der
heutigen Lorettokapelle diente in Zeiten der Gefahr als
Kreidfeuerstation (Signalfeuer). Über dem Burgtor befindet sich das
Familienwappen der Herren von Stubenberg, ein gestürzter Anker, dessen
Seil in Form eines Zopfes geflochten ist. Zu den wichtigsten
Verteidigungsanlagen zählten der Burggraben, die Zugbrücke und die
Schlüsselloch-Schießscharten.

Die Burg war durch drei Burgtore gesichert. Das äußere Burgtor wird
heute noch durch ein über 300 Jahre altes massives Holztor
verschlossen, das mit handgeschmiedeten Eisenplatten beschlagen ist. In
unsicheren Zeiten wurde nur das „Mannloch" geöffnet, durch das nur
Einzelpersonen die Burg betreten konnten. Der zweite Torbogen war durch
ein Fallgitter gesichert, das bei Gefahr schnell heruntergelassen
werden konnte. Von innen konnte dieses Gitter zusätzlich mit einem
eingeschobenen Holzbalken gesichert werden. Die Ausnehmungen für den
Balken sind beidseitig im Torbogen zu erkennen. Die großen Angeln für
das dritte und innere Burgtor sind ebenfalls erhalten.

Burghof - Die Burg wurde im 16.
Jhdt. zu einer Renaissance-Festung ausgebaut. Die Verteidigungsanlagen
wurden verstärkt und die Wehrmauer erhielt ihre Rundbogennischen. Eine
schmale Treppe führte in den Heil- und Gewürzkräutergarten der
Burgfrauen. Das schmiedeeiserne Gittertor aus dem 16. Jhdt. stammt
vermutlich aus der ehemaligen Burgkapelle. Es zeigt das Monogramm für
„MARIA" und das „IHS" für Jesus. Die 7 m tiefe Zisterne diente als
Regenwasserspeicher und bildete die Wasserversorgung für die
Burgbewohner in Zeiten einer Belagerung.

Verspruchkammer - Dieser Raum
im alten Torturm lässt erkennen, wie dick die Mauern dieses Teiles der
Burg sind. In der Verspruchkammer haben schon viele Brautpaare ihr
Eheversprechen abgelegt. Das Standesamt Kapfenberg führt auf Wunsch in
den Sommermonaten Trauungen in der Burg Oberkapfenberg durch.
Symbolisch für die eheliche Treue befinden sich in der Kammer
Eisenfesseln für den Bräutigam und ein Keuschheitsgürtel für die Braut.

Burggeschichte
Die Stelle der heutigen „Loreto-Kapelle" aus dem 17. Jhdt. bildete den
höchsten Punkt der ersten Burg „Alt Kapfenberg", erbaut im Jahre 1173.
1268 wurde diese erste Burg an den Böhmenkönig Ottokar ausgeliefert,
welcher die Befestigungsanlagen und das Burgtor zerstören ließ. Bereits
im Jahre 1272 war die „Neue Burg zu Oberkapfenberg", die heutige Burg
Oberkapfenberg, fertig gestellt. Im 16. Jhdt, wurde sie zu einer
Renaissance-Festung ausgebaut. Die Burg war das Zentrum der Verwaltung
und der Gerichtsbarkeit für weite Teile des Mürztales. Im Jahr 1739
verließen die Grafen von Stubenberg die Burg und zogen in das neu
erbaute „Schloss Wieden" am Ufer der Mürz. Bis in die Mitte des 20.
Jhdt. war die Burg gänzlich zur Ruine verfallen. Vom 26. Grafen von
Stubenberg wieder aufgebaut, wurde sie von 1956 bis 1985 als Burghotel
betrieben. Im November 1992 erwarb die Stadtgemeinde Kapfenberg die
Burg. Nach einer tiefgreifenden Restaurierung wurde 1994 das
Burgrestaurant eröffnet. Seit 1999 befindet sich hier eine
Grelfvogelstation mit täglichen Vorführungen von April bis Oktober. Im
Jahre 2003 wurde der Ausstellungstrakt eröffnet und die Betriebs GmbH
Burg Oberkapfenberg gegründet. Eine Dauerausstellung, Seminare,
Mittelalterprogramme, Kindergeburtstage und verschiedenste
Veranstaltungen finden seither in den Räumen der Burg statt.

Christkönig - spanisches Crucifixus 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts, Stift St. Paul, Kopie

Erzherzog Johann beschreibt die halb verfallene Burg Oberkapfenberg
Am 9. Oktober 1832 kommt Erzherzog Johann nach Kapfenberg. Zu Fuß
wandert er zur Burg hinauf. Was er dort sieht, hält er in seinem
Tagebuch fest. Er erwähnt die Loreto Kapelle, die einst zu einer
ersten, älteren Burg gehörte. Er berichtet auch von einem Fehdekampf
oder Duell auf dem Rennfeld - heute wissen wir, dass diese Geschichte
in den Bereich der Sagen gehört. Die Burg Oberkapfenberg bot damals ein
trauriges Bild. Sie war zwar noch keine Ruine, aber im Begriff eine zu
werden. Offensichtlich hat er noch einen unterirdischen Gang
wahrgenommen, der einst Burg und Markt verband.
Doch hören, beziehungsweise lesen wir selbst, was Erzherzog Johann in sein Tagebuch schrieb:
... fuhr ich dann nach Kapfenberg,
dort stieg ich ab und ging auf einer Mittagsseite des Berges nach einem
Landwege hinauf zu einigen Bauernhöfen, dann auf die Capelle Loretto.
Diese liegt mitten auf einem erhöhten Platze, welchen die Grundfesten
starker Mauern umgeben, welche einmal die alte Burg bildete. In der
Capelle der Altar und ein Bild hinter einem versilberten Gitter. Ein
Chor, einige schlechte Malereien, 4 Fahnen, eine aus den Kreuzzügen und
eine grüne zerrissene, jene, welche Wulfing von Stubenberg am Rennfelde
geführet. An einem Eck der Fehde-Handschuh. Wenig Altertümer sonst. Von
der Loretto Capelle führet ein Steig abwärts in die neuere, obgleich
alte Burg Oberkapfenberg. Vor 15 Jahren noch gut erhalten, ist seitdem
das Dach zum Teil eingestürzt, bald ein Schutthaufen. Ist nicht ohne
Gefahr zu betreten. Kleine Gärten herum, die Rüstkammer, die Verliese,
der unterirdische Gang nach dem Markte, der mehrere Ausgänge in die
Keller der Häuser hatte, alles zusammenbrechend. Eine sehr schlechte,
lange Brücke führt über den Schloßgraben in das Schloß. Das sind die
Überreste des Stammschloßes eines der ältesten deutschen Geschlechter,
der Stubenberger. Traurig verließ ich diese Ruine und ging über den
Gangsteig hinab nach Kapfenberg, es war Mittag. Die Frau kam von
Vordernberg, wir speisten bei der Madlen, fuhren dann nach Brandhof, wo
wir um 8 Uhr abends ankamen ...

Erstmals wird die Existenz einer Burg in Kapfenberg 1173 erwähnt. Die
Burg wird als „castrum chaffenberch" bezeichnet. „Chaffen" bedeutet
„gaffen" und beschreibt den Burgberg als einen Platz, von dem man gut
das ganze Land überblicken konnte. Frei übersetzt könnte man den Ort
auch „Ausschauberg" nennen. Der als Burguntersiedlung entstandene Markt
übernahm ebenfalls den Namen Kapfenberg. Um 1269 wird eine zweite,
jüngere Burg am heutigen Standort erbaut. Nach einer erstaunlich kurzen
Bauzeit von nur drei Jahren ist die Festung fertiggestellt. Um 1550
wird diese Burg angesichts der Osmanen- und Ungarneinfälle in eine
moderne Renaissancefestung umgebaut. Zu diesem Zeitpunkt wird die alte,
obere Burg noch benutzt. Die obere Burg ist zu diesem Zeitpunkt sogar
Teil der Verteidigungsanlage, weil man dort eine große Zisterne bauen
lässt. Der Wasserinhalt sollte für 500 Personen reichen. Warum wird so
groß dimensioniert? Im Kriegsfall soll die Bevölkerung des Marktes
evakuiert werden und hinter den Burgmauern nicht nur Schutz, sondern
auch Nahrung und Wasser finden. Knapp 100 Jahre später wird die obere
Burg aufgegeben und an ihrer Stelle 1676 die Loreto-Kapelle erbaut.

Tricks der Goldmacher
Der Jesuitenpater Athanasius Kircher (1601-1680), beschreibt die Kniffe
der betrügerischen Goldmacher und die chemischen Prozesse, durch die
goldähnliche Metallpräparate entstehen:
1. Sie verbergen gefeiltes Gold oder Silber in ausgehöhlten Stöcken,
mit denen sie geschmolzenes unedles Metall umrühren. Dabei verbrennt
das Holz und das gefeilte Edelmetall wird dem unedlen beigemengt.
2. Andere benutzen Schmelztiegel mit doppelten Böden, in denen sie
wiederum gefeiltes Edelmetall verstecken. Beim Umrühren des
geschmolzenen Metalls wird diesmal der innere Boden durchstoßen und der
gleiche Effekt erzielt.
3. Oder sie präparieren die Röhre eines Blasebalgs, mit dem angeblich die Schlacke des geschmolzenen Metalls verblasen wird.
4. Auch eine große, ausgehöhlte Kohle, mit der der Schmelztiegel
zugedeckt wird, ist ein beliebtes Versteck. Die Kohle verbrennt und das
Edelmetall fällt in den Tiegel.
5. Wieder andere lösen Gold zu einer Art Wasser oder Öl auf und gießen
es auf Quecksilber. Der daraus folgende Amalgamierungsprozeß täuscht
das Publikum.
Alchemie ist eine ars (Kunst = Handwerk) und wird zur scientia(Wissenschaft). Sie hat nichts mił Magie zu tun.
Keine Alchemistin und kein Alchemist wurde je als Hexe/Hexer verbrannt.
Alchemisten endeten als Betrüger am Galgen (bzw. unter dem Schwert).
Der Goldfälscher CAEΤΑΝΟ
Don Domenico Emanuele Caetano war einer der Großen unter den
Betrugsalchemisten. Er hatte sehr wahrscheinlich mit Quecksilberamalgam
gearbeitet. Quecksilber kann bis zu 12% Silber oder Gold beigemengt
werden, ohne dass es Farbe oder Konsistenz ändert. Einer seiner
Begleiter dürfte wahrscheinlich der Bote gewesen sein, der heimlich für
den Nachschub der Edelmetalle sorgte. Caetano, um 1667/1670 geboren,
stammte aus Neapel. Nachdem er mehrfach aus Italien, Spanien und
Deutschland fliehen musste, gelang es ihm dennoch 1704 in Kaiser
Leopold I einen einflussreichen Gönner zu finden. Er nahm ihn mit hohem
Gehalt in seine Dienste und gab ihm hohe Vorschüsse für die
Ausarbeitung des Steins der Weisen. Nach dessen Tod fand er bei
Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz Unterschlupf, solange bis seine
Betrügereien entlarvt wurden. Ihm wurde schließlich der Prozess gemacht
und er wurde 1709 öffentlich gehenkt.

DIE KREUZZÜGE
Vor fast 1000 Jahren, am 27. November 1095 hielt Papst Urban II eine
folgenschwere Ansprache. Er rief das Volk auf, im Namen Gottes zu den
Waffen zu greifen und einen Kreuzzug gegen die Muslime zu führen. Auf
Kreuzzug zu fahren war sehr teuer und kostspielig. Oft musste ein
Ritter Land verkaufen oder verpachten, um sich Fahrt, Verpflegung und
den Aufenthalt in Jerusalem leisten zu können. Bereits auf dem Marsch
nach Osten, begannen die Kreuzfahrer einheimische Dörfer zu plündern
und zu berauben, um sich Essen und Trinken zu beschaffen. Die Reise
nach Jerusalem dauerte viele Monate. Immer wieder starben unterwegs
Menschen an Hitzschlag, Hunger oder bei Kämpfen. Nachdem Jerusalem von
den Kreuzfahrern erobert worden war, kehrten viele Kreuzfahrer nach
Europa zurück. Manche aber ließen sich im Heiligen Land nieder. Sie
lebten in Kreuzfahrerstaaten, die knapp 200 Jahre bestanden. Jerusalem
selbst wurde schon viel früher von den Muslimen zurück erobert. Es gab
insgesamt sieben Kreuzzüge in den Orient. Alle diese Kriege haben
großes Leid über die Menschen gebracht und sind bis heute ein sehr
trauriges Kapitel des Christentums.
Man glaubte, wer den „Stein der Weisen" besitzt, kann Gold herstellen, also unedles Metall in Gold verwandeln.
Dabei war der Stein der Weisen gar kein richtiger Stein, sondern nur
rotes Pulver. Aber dafür soll dieses Pulver ein wahres Wunderding sein:
Mit ihm kann man Gold machen, man bekommt die ewige Jugend und kann ein
ewiges Licht erzeugen. Kein Wunder, dass jeder Alchemist nur eines
wollte: Den Stein der Weisen herstellen!

Die Tricks der Goldmacher!
Die Alchemisten konnten nicht ein einziges Gramm Gold erzeugen, aber
manche versuchten mit Betrug reich zu werden. Sie täuschten Fürsten und
Herrschern vor, dass sie Gold machen könnten und kassierten dafür sehr
viel Geld.
Der doppelte Boden - Der
Alchemist versteckt im doppelten Boden eines Schmelztiegels Gold. In
den Schmelztiegel gibt er wertloses Metall, stellt alles auf das Feuer
und tut so, als ob er Gold machen würde. Wenn das Metall geschmolzen
ist, rührt er es um, durchstößt dabei den doppelten Boden und siehe da
- auf einmal ist Gold im Schmelztiegel!
Der Stabtrick - Der Alchemist
füllt wertloses Metall in einen Schmelztiegel und verkündet, dass er
jetzt Gold herstellen werde. Er nimmt ein Stöckchen aus Holz und rührt
damit das geschmolzene Metall um. Der Alchemist wartet nur auf den
Moment, in dem das Holz an der Spitze verbrennt, denn er hat den Stab
heimlich mit Gold gefüllt. Das flüssige Gold rinnt in den Tiegel und
alle staunen über seine Kunst!
Der Trick mit der Kiste - Bei
diesem Trick braucht der Goldmacher einen Gehilfen. Er gibt Blei in
einen Tiegel, streut seine geheimnisvolle Tinktur drauf und erklärt,
jetzt müsse der Tiegel über Nacht abkühlen, damit Gold daraus wird.
Zuvor hat er einen Knaben in einer Kiste versteckt, der nachts das Blei
gegen Gold austauscht.
Der Nageltrick - Der Alchemist
bestreicht einen Nagel, der zur Hälfte aus Gold besteht mit Eisenfarbe,
sodass er wie ein normaler Eisennagel aussieht. Den Nagel wirft er in
heißes Öl, worauf sich die Farbe löst. Alle bestaunen das Gold!
Was macht ein Alchemist?
Das Wort,Chemie" leitet sich von „Alchemie" ab. Die Alchemisten waren
die ersten Chemiker, aber einige von ihnen wollten unbedingt Gold
erzeugen. Dabei wurden manche zu Betrügern, indem sie vortäuschten,
tatsächlich Gold hergestellt zu haben. Die Alchemisten arbeiteten in
einem Labor, wo sie Experimente machten, sie nannten dies „probieren".
Sie haben Substanzen verdünnt, verflüssigt, voneinander getrennt,
gekocht und geschmolzen. Die Alchemisten waren davon überzeugt, dass
man aus wertlosem Metall etwas Wertvolles, z.B. Gold herstellen konnte.
Das ist ihnen natürlich nie gelungen, aber dennoch hat einer von ihnen
etwas sehr Kostbares entdeckt: Er hat das Porzellan erfunden.

RICHTER UND FREIMANN
Als häufigste Kriminaldelikte der Frühen Neuzeit sind wohl die
Unzuchtsfälle zu nennen, eines der am stärksten verfolgten und daher
auch gerichtsrelevantesten Kriminaldelikte. „Die stereotype
geschlechtsspezifische Selbstdarstellung vor Gericht sah gegenseitige
Schuldzuweisungen von ,Mensch' und, Kerl' vor. Mann/Frau versuchte sich
gerichtsstrategisch immer als Opfer fremder Verführung darzustellen.
Die dörfliche Jugendkultur, die sexuelle Kontakte zur Eheanbahnung
akzeptierte, stand im Gegensatz zu strikten kirchlichen und staatlichen
Sexual-Verboten. Sexualität war ausschließlich im Rahmen der Ehe
toleriert. Die Heiratserlaubnis, der sogenannte politische Ehekonsens,
wurde von den Gemeinden allerdings nur bei einer ausreichenden
finanziellen Unabhängigkeit erteilt, weil man keineswegs für die
Armenversorgung des frisch verheirateten Paares aufkommen wollte. Das
erklärt auch das spezifische alpine Heiratsmuster, wo erst mit dem
Erbfall eine Ehe eingegangen werden konnte."
Offenburg - Reifenstein verfügte lange Zeit über keinen Bannrichter und
über keinen Freimann. Richter und Freimann mussten zuerst aus Graz
geholt werden, dann von Leoben. Seit dem Jahre 1760 verfügte das
Landgericht Offenburg - Reifenstein über einen eigenen Kriminalrichter,
der jährlich an die
Kammeralkasse zu entrichtende Landgerichts - Beitrag belief sich auf
66 fl. 5 kr. Wiener Währung. Für den Scharfrichter waren im
Mittelalter, je nach Region, verschiedene Bezeichnungen üblich, u.a.:
Carnifex, Nachrichten Freimann, Henker, Angstmann, Züchtiger etc.
Der Freimann, Züchtiger, Nachrichter, Henker oder Scherge war für die
ordnungsgemäße Durchführung der Körperstrafen zuständig, diese reichten
vom „Ausstreichen“ mit Ruten über Verstümmelungen bis hin zu den
verschiedensten Arten der Todesstrafe. Die weit verbreitete Meinung,
der Freimann oder Scherge wäre als Angehöriger einer Randgruppe und
aufgrund seiner Betätigung in einem „unehrlichen Gewerbe“ von der
Gesellschaft ausgeschlossen gewesen, trifft auf das Pölstal und den
Raum Judenburg wohl nicht zu. Am Abend vor der Hinrichtung der
Verbrecher Peter am Painhausse und seines Knechtes Wolfgang im Jahre
1536 saßen der Ankläger, Stadtbote, Gerichtsdiener, Henker und die
beiden Hinzurichtenden im Haus des Steinmetzen Wall zusammen und
tranken dabei um 1 Pfund 1 Schilling 11 Pfennig ganze 23 Viertel guten
„Zwölferwein“, was einer Menge von 40 Litern entsprach, also 6,6 Liter
Wein pro Person. – Entbehrt dieses Szenarium schon an sich nicht einer
gewissen Kuriosität, so wird daraus ersichtlich, dass der
Gerichtsdiener und Freimann / Henker hierorts durchaus nicht als ein
von der Gesellschaft ausgestoßener Mensch galten. – Zehn Jahre später
entleibte sich in Basel sogar ein Handwerker nachdem er sich am
nächsten Tag zu erinnern begann, dass er in seiner Trunkenheit mit dem
Scharfrichter gezecht hatte! (Wird in der älteren Literatur meist von
einer totalen Ausgrenzung des Scharfrichters / Henkers /Freimanns
ausgegangen, so tendiert die neuere Forschung eher zu regionalen und
personenbedingten Unterschieden.)

UNZUCHT
„Am 4 Mai 1701 stand Margaretha Pörin im Bretstein, zur Herrschaft
Sauerbrunn Untertan, vor dem Landrichter. Sie hatte nun schon das
sechste Mal ein uneheliches Kind im Leib; ihr ganzer Dienstbotenlohn
war bereits gepfändet, so dass sie zu keiner Geldstrafe verurteilt
werden konnte; dafür wurde sie zu einer Strafe von drei Wochen Arrest
verurteilt; weil sie jedoch schwangeren Leibes war und zwei kleine
Kinder zu Hause auf sie warteten, sei von ihr nichts zu holen,
vermerkte der Landrichter im Protokoll und ließ sie laufen, musste
jedoch zwei Jahre das Gebiet des Landgerichts meiden. Sie nannte
folgende Burschen, mit denen sie sich ,fleischlich versündigt habeʻ und
die zu Geldstrafen verurteilt wurden: Matthias des Reicher in der Saag
Sohn, von dem sie nun schwanger war (Strafe 6 fl), Gori des Steiner
(Herrschaft Authal) in der Zeiring Knecht (1 fl 4 ß), Veit des Franz
Fromb in der Karleiten Knecht (Herrschaft Großlobming) 2 fl, Hiasl des
Mayr oder Grennerbauer in Bretstein Knecht (2 fl), Paul des Haingartner
im Zeiringgraben (untertan dem Kastenamt Judenburg) Knecht (3 fl),
Hiasl des Ebner in Bretstein Knecht (2 fl), Matthias des Benedikt
Müller, Bürger an der Zeiring, Sohn (5 fl). Insgesamt nahm der
Landrichter von den ,Liebhabern' der Margaretha 24 Gulden an
Strafgeldern ein.“
W. Brunner 2006, 72. (SAM, Bücherarchiv VI/7, ohne pagina, 4. Mai 1701)
ZAUBEREIPROZESSE
Von besonderem Interesse sind die zahlreichen „Zaubereiprozesse“, die
offensichtlich im Landgericht Reifenstein - Offenburg geführt wurden.
Wie wir aus der 1843 verfassten „Bezirksbeschreibung“ von Reifenstein
erfahren, müssen beim dortigen Landgericht im und vor dem Jahre 1660
Hinrichtungen wegen Zauberei stattgefunden haben: „In den alten
deponierten Kriminalakten erscheinen auch noch Hinrichtungsexekutionen
wegen Zauberey insbesondere die Letzte im Jahre 1660". „Das Jahr 1674
zeigt uns zunächst einen großen, zusammenhängenden Zaubereiprozeß in
den benachbarten steirischen und kärntnerischen Landgerichten
Admontbichl, Judenburg, Reifenstein und Wolfsberg. Er ist besonders
gekennzeichnet durch die unter Folterdruck entstandenen zahlreichen
Todesfälle im Kerker, ein Zeichen für die immer mehr auch in die Praxis
eindringende Vorstellung, daß die Widerspenstigkeit der zauberischen
Personen gegen die Geständnisforderung des Gerichts auf teuflischer
Besessenheit beruhe, die die Schmerzen der Tortur nicht empfinden
lasse; man kann, wenn man will, darin eine Entschuldigung für die
maßlose Tortur finden.
Die Verfolgungen beginnen mit der Prozessierung und Hinrichtung des
zwanzigjährigen Schafhalters Jakob in Admontbichel am 5. März 1674. Er
war nach seinem Geständnisse einmal zufällig in eine Hexengesellschaft
geraten, die am Sernikogel tagte, und von da an bei der Sache
geblieben. Von seinen Genossen und Genossinnen erzählte er, daß der
Kolman unlängst in Obdach im Gefängnis gestorben; die Pinggl Eva sei zu
Judenburg in der Haft verdorben; der Klaffensackschuster sei zu
Wolfsberg in Haft. Außerdem belastet er noch den reichen Bauern Ruepp
im Sattel des Reifensteiner Landgerichts und noch sechs andere, daß sie
am Sabbat am Größenberg teilgenommen und dort Schauer gesotten hätten.
Dieser Ruepp im Sattel, den man zuerst nach Judenburg einlieferte, dann
aber nach Reifenstein überstellte, ein siebzigjähriger Mann, konnte
sich einen juristischen Verteidiger leisten, der für ihn ein Gesuch an
den Kaiser um Zulassung zur Purgation mit der klassischen und höchst
bezeichnenden Begründung machte, sein Klient sei reich und könne
außerordentliche Gerichtskosten bezahlen. Man bewilligte ihm auch die
Zulassung zum Entlastungsbeweis, jedoch ohne Erfolg; denn am 25. August
1674 erwürgte sich der alte Mann nach schwerster Folter aus
Verzweiflung mit seiner Fußkette. Die Leiche wurde [höchst
wahrscheinlich beim Hochgericht Unterzeiring / Birkachwald] verbrannt.
* * *
Marktrichterstüberl

ZAUBEREIPROZESSE
Vier Jahre danach, 1678, erteilte die Regierung dem Landgericht
Offenburg - Reifenstein den Auftrag, einen Untertanen, der der Vater
zweier in Salzburg hingerichteter Zauberer sein solle, zu verhaften und
zu prozessieren. F. Byloff sieht darin die Auswirkung des berühmten
„Zauberjackelprozesses“, der auch die innerösterreichische Regierung
zur Weisung an alle Landgerichte in Obersteier veranlasste gegen die
„der Zauberei, Rauberei und anderer Untaten gravierten Personen" mit
aller Schärfe einzuschreiten. - Bereits 31 Jahre zuvor, 1647, war der
Besitzer und Spitalsherr des Schlosses Sauerbrunn, Christoph Alban Graf
Saurau, Urenkel des Franz von Teuffenbach, wegen angeblicher Zauberei
verhaftet und am 12. August 1647 in Graz zum Tod, dann zu lebenslanger
Haft verurteilt worden. Christoph Alban Graf Saurau hatte als Adeliger
seinen Gerichtsstand beim „Obersten Landgericht" in Graz, wo Adelige
über Adelige Recht sprachen. Das gemeine Volk des Pölstales hatte
seinen Gerichtsstand am Landgericht Offenburg - Reifenstein. „Raub und
Diebstahl, also Eigentumsvergehen – in der Forschung der siebziger
Jahre vorwiegend als „sozialrebellische" Taten abgestempelt -, waren
die neben Unzucht am häufigsten auftretende Deliktgruppe; sie wurden
deshalb als frühneuzeitliches Basisdelikt bezeichnet.“ Auch
Zusammenhänge zwischen Preisentwicklung und Diebstahl lassen sich gut
fassen.
Gleichzeitig mit ihm waren in Reifenstein noch mindestens drei Bauern
und die Maria Klaffensack in in Haft. Der eine von ihnen, Wolf Welßler,
an dem der sachverständige Freimann zwei Teufelszeichen gefunden hatte,
in die er ohne Blutung und Schmerzempfindung eine Nadel einen halben
Finger tief einstoßen konnte, machte alle Foltergrade - zum Schluß
sechsundzwanzig Stunden Stuhlfolter - ohne Geständnis durch. Darnach
war er allerdings in Todesgefahr und ,bis ins frische Fleisch'
aufgefressen. Da er überdies verlauten ließ, er werde bei weiterer
Folter etwas Unwahres sagen müssen, nur um von der Pein loszukommen, so
fragte der Bannrichter bei der innerösterreichischen Regierung an.
Diese erteilte jedoch die Weisung, den Armen noch einmal zu torquieren,
wenn er wieder etwas zu Kräften gekommen sei. Sein endliches Schicksal
kennen wir nicht; wahrscheinlich hat man den Unglücklichen, der in
starrem Bauerntrotz nicht nachgeben wollte, zu Tode gefoltert.
Der zweite namens Ambros Schäffer aus Admontbichel hat die Territion
ausstehen müssen; da aber an seinem Körper das Teufelszeichen nicht
gefunden werden konnte, wurde er entlassen. Dasselbe glückhafte
Schicksal widerfuhr der Klaffensackschusterin, die ganz unbelastet war
und nur wegen ihres in Wolfsberg verhafteten Mannes in den Kerker
wandern mußte.
Schließlich schreibt am 16. März 1674 Jakob Pfanzelter von Admontbichel
an den Judenburger Burggrafen Johann Hainricher von Hainrichsberg:
'Berichte e. gn. und herrn gehors. das der zu Admontpichl in verhaft
geweste Ambroß Rötscher wegen so schwerer vorkherter to[r]tur ganz
verschwollen und vor 2 tagen todtsfürworden ist...', ein Beleg für das
vierte (oder fünfte!) totgemarterte Opfer dieses Prozesses.
* * *
Forcherstüberl

HEXEREIPROZESSE
Akten aus Krumau (Tschechien) berichten: Zum Beispiel wurde eine Frau
aus dem Pölstal wegen Diebstahls, Unzucht und Zauberei am Landgericht
Reifenstein verhört. Der Sitz des Landgerichtes war das Schloss
Gusterheim. Schwerer Diebstahl wurde damals mit der Todesstrafe
geahndet. Da hatte also eine Frau aus dem Pölstale über 100 Gulden
gestohlen, dazu noch uneheliche Kinder geboren, und war außerdem noch
in den Verdacht der Hexerei geraten: Der Verhörakt aus dem Jahre 1737
ist vorhanden; diese Frau wurde bei der Richtstätte Unterzeiring mit
dem Schwert enthauptet.
* * *
Ritterstüberl

Seit April 2009 gibt es die neue Ausstellung „Grenzgänge – Eine Zeitreise mit Kreuzrittern und Alchemisten".
Nach einer Hangrutschung im Herbst 2011 wurden einige archäologische
Funde aus „Stubenbergs Küche“ gemacht. Dies ist auch die Bezeichnung
der Sonderausstellung 2012 in der Burg Oberkapfenberg mit Töpfen,
Knochenresten und Spielzeug der Kinder. Alljährlich findet im Juni das
Ritterfest statt, welches eine der größten Veranstaltungen dieser Art
in Österreich ist.



Der Stubenbergsaal ist der
größte Raum der Burg. Hier ist deutlich zu sehen, wie weit die
originalen Burgmauern noch erhalten sind und welche Teile der Ruine
wieder aufgebaut werden mussten. An der Nordseite befindet sich in
einer Nische ein ehemaliger Abtritterker - eine Toilette, die außen an
die Burgmauer angebaut und nach unten offen war. Die Portraits an der
Wand zeigen Mitglieder der Familie der Grafen von Stubenberg. Alle
gezeigten Persönlichkeiten waren eng mit der Burg Oberkapfenberg
verbunden.

Das Wappenbild der Grafen von Stubenberg
veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte: Das früheste bekannte Wappen
zeigt einen roten Wolf auf silbernem Grund. Ein späteres Wappen zeigt
eine Wolfsangel (wie über dem Burgtor), die auch als Wurfbarte
interpretiert werden kann. Eine Wurfbarte wurde im Kampf den Rittern
entgegengeschleudert. Verfing sie sich in der Rüstung eines Ritters, so
konnte dieser von seinem Pferd gezogen und besiegt werden. Später wurde
die Bedeutung der Wurfbarte vergessen und das Wappenbild wurde zu einem
Anker, dem christlichen Symbol der Hoffnung. Der Anker im Wappen der
Grafen von Stubenberg ist gestürzt. Das Seil ist in Form eines Zopfes
geflochten.



Das Turmstüberl ist mit einer
großen Tafel für die „Ritter der Tafelrunde" ausgestattet. Dieser Raum
kann samt Terrasse für private Feste angemietet werden. Im darüber
gelegenen Raum ist ein Zimmer-Armbrustschießstand eingerichtet, der
ebenfalls angemietet werden kann. Hier können, die Gäste unter
fachkundiger Betreuung ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Dies
ist eine beliebte Ergänzung für Feiern in der Burg.

Aussichtsterrasse & Burggeschichte
Die Stelle der heutigen „Loretto-Kapelle" aus dem 17. Jhdt. bildete den
höchsten Punkt der ersten Burg „Alt Kapfenberg", erbaut im Jahre 1173.
1264 wurde diese erste Burg an den Böhmenkönig Ottokar ausgeliefert,
welcher die Befestigungsanlagen und das Burgtor zerstören ließ. Bereits
im Jahre 1272 war die „Neue Burg zu Oberkapfenberg", die heutige Burg
Oberkapfenberg, fertig gestellt. Im 16. Jhdt. wurde sie zu einer
Renaissance-Festung ausgebaut. Die Burg war das Zentrum der Verwaltung
und der Gerichtsbarkeit für weite Teile des Mürztales. Im Jahr 1739
verließen die Grafen von Stubenberg die Burg und zogen in das neu
erbaute „Schloss Wieden" am Ufer der Mürz. Bis in die Mitte des 20.
Jhdt. war die Burg gänzlich zur Ruine verfallen. Vom 26. Grafen von
Stubenberg wieder aufgebaut, wurde sie von 1956 bis 1985 als Burghotel
betrieben. Im November 1992 erwarb die Stadtgemeinde Kapfenberg die
Burg. Nach einer tiefgreifenden Restaurierung wurde 1994 das
Burgrestaurant eröffnet. Seit 1999 befindet sich hier eine
Greifvogelstation mit täglichen Vorführungen von April bis Oktober. Im
Jahre 2003 wurde der Ausstellungstrakt eröffnet und die Betriebs GmbH
Burg Oberkapfenberg gegründet. Eine Dauerausstellung, Seminare,
Mittelalterprogramme, Kindergeburtstage und verschiedenste
Veranstaltungen finden seither in den Räumen der Burg statt.


Die Burgschenke befindet sich
in dem erhaltenen Torturm der Burg Oberkapfenberg. Die Räume der
heutigen Burgschenke nennen sich die „Kemenate der schönen Agnes", „zum
Mundschenk" und „Ritterstube". Die Malereien an den Wänden zeigen
Szenen aus der Sage vom „Zopf der Agnes".


Aus dem Leben der Stubenberger, 1629-1659
Georg von Stubenberg der Ältere hält in der Zeit der Gegenreformation
an seinem protestantischen Glauben fest. Im Jahr 1629 geht er mit
seiner Frau Amalie, die Letzte aus dem steirischen Haus derer von
Liechtenstein, nach Regensburg ins Exil, wo er ein Jahr darauf stirbt.
Zuvor übergab er per Urkunde vom 27. Juni 1629 seinen steirischen
Besitz an seine Großneffen Georg dem Jüngeren und Wolfgang von
Stubenberg. 1639 stirbt Georg der Jüngere und Wolfgang ist nun der
alleinige Herr auf der Burg. In all den Jahren werden seine Tätigkeiten
sehr geschätzt und die Burg erstrahlt ebenfalls in neuem Glanz.
„Pflegsrechnungen" belegen, dass sowohl Kachelöfen, Mauerwerk, das Dach
und auch die Küche renoviert und ausgebessert wurden. Spannend liest
sich auch das Kuchlregister aus dem Stubenbergarchiv. Der Pfleger auf
der Burg vermerkte in seinen Aufzeichnungen den Kauf von roten
Erdbeeren, Erbsen, Artischocken, Zitronen, Krebsen, Honig, Eiern und
sogar Farbe, um Ostereier zu färben.
Wir schreiben das Jahr 1659 und Wolfgang feiert die Geburt seines
Enkelsohnes Rudolf. Neben dem stolzen Vater, ebenfalls ein Wolfgang,
nehmen noch seine Brüder Otto und Georg mitsamt ihren Gemahlinnen am
Fest teil. Georg sollte später einmal Landeshauptmann der Steiermark
werden. Sein Bruder Franz, noch zu jung für eine Gemahlin, langweilt
sich eher bei Tisch und lässt den Trinkspruch des Paters über sich
ergehen. Die beiden Buben am Boden vor dem Festtagstisch, der eine mit
Murmeln spielend, der andere musizierend, können leider nicht mehr
genau der Stubenberg'schen Ahnentafel zugeordnet werden. Den Namen der
Dienstmagd wollen wir aus Pietätsgründen verschweigen, ebenso jenen des
jungen Burschen, der beim Schwarzfischen vom Aufseher ertappt wurde.

In der Folgezeit aber blieben die Stubenberger ihrem Landesherrn treue
Gefolgsleute und die Burg Kapfenberg wurde zum zentralen
Verwaltungspunkt für den großen Einflußbereich dieses Geschlechtes.
Ende des 13. Jahrhunderts war ihnen mit dem Landgericht die hohe
Gerichtsbarkeit für das gesamte Mürztal übertragen worden, was
bedeutete, daß alle Blutverbrechen in diesem Gebiet von einem
stubenbergischen Richter abgeurteilt werden mußten.



Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Burg Oberkapfenberg in Kapfenberg: