web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Museum Niederösterreich
im Kulturbezirk St. Pölten, Jänner 2023
Museum & Zoo! Im Haus für Natur gibt es die
Lebensräume Niederösterreichs mit 40 lebenden Tierarten zu sehen. Das
Haus der Geschichte lädt zu einer Zeitreise durch 10.000 Jahre. Die
Ausstellungen „Wildnis Stadt“ und „Niederösterreich & Wien - Szenen
einer Ehe“ runden das spannende Angebot ab.
Das Museum Niederösterreich (bis 2015 Landesmuseum Niederösterreich)
ist ein Museum des Bundeslandes Niederösterreich in St. Pölten. Bevor
es im Jahr 2002 nach St. Pölten übersiedelte, hatte das Museum, das im
Jahr 1902 vom Verein für Landeskunde gegründet wurde, einige Standorte
in Wien. Aus dem Landesmuseum Niederösterreich mit den Bereichen
Geschichte, Kunst, Natur wurde das Museum Niederösterreich. Seit 2016
vereint es das Haus der Geschichte und das Haus für Natur in einem
Haus. Das von dem Architekten Hans Hollein (2002) und der
Architektengruppe RATA PLAN (2009) adaptierte Hause vereint Geschichte,
Kunst und Natur des Landes Niederösterreich.

NIEDERÖSTERREICH & WIEN - SZENEN EINER EHE
Vor 100 Jahren, 1922, trennt sich Niederösterreich von Wien. Oder Wien
von Niederösterreich? Das ist eine komplexe Frage, immerhin ist die
Geschichte der beiden Bundesländer eng verwoben und bleibt dies auch
nach der Trennung. Unser Rundgang durch die Dauerausstellung erforscht
anhand von 22 Exponaten mit Hörstationen die Szenen einer Ehe vor und
nach der Scheidung. Dabei werden beide Perspektiven, die Wiener und die
niederösterreichische, gleichermaßen berücksichtigt.
DIE TRENNUNG NIEDERÖSTERREICHS VOM „WASSERKOPF WIEN"
Ab 1986 ist Wien nicht länger die Hauptstadt zweier Bundesländer:
Niederösterreich bekommt mit St. Pölten endlich eine eigene Hauptstadt
auf eigenem Territorium. Doch erst 1997 wird der Sitz des
Niederösterreichischen Landtags von der Wiener Herrengasse nach St.
Pölten verlegt. Damit wird die im Jahr 1921 beschlossene und am 1.
Jänner 1922 in Kraft getretene Trennung der beiden Bundesländer
vollzogen. Endgültig. Scheidungsanläufe gibt es bereits in der
Monarchie. Doch erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kommt
Bewegung in die Sache. Hitzige Diskussionen der „Ehepartner" um die
gemeinsamen Besitztümer beschäftigen die beiden Bundesländer lange. Den
Durchbruch erzielen die Verhandler, so wird erzählt, im Dezember 1921
bei Brot und Wein.
* * *
Wachturm „Eisernen Vorhang“
Als dieser tschechoslowakische Wachturm 1983 gefertigt wurde, gingen
die Menschen in Europa auf die Straße. In unzähligen
Friedensdemonstrationen erhoben sie ihre Stimme gegen das Wettrüsten
zwischen der UdSSR und den USA. Der „Eiserne Vorhang“ trennte dabei Ost
und West politisch, militärisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.
Für jene, die in den West wollten war der 453 Kilometer lange
„Eisernere Vorhang“ zwischen der Tschechoslowakei und Österreich eine
unüberwindbare Barriere. Das Jahr 1989 brachte dann große
Veränderungen: Der Ostblock begann zu zerfallen, in der
Tschechoslowakei war die „Samtene Revolution“ erfolgreich und der
„Eiserne Vorhang“ wurde abgebaut. Dabei kam es im Juni 1989 auch zu
einem symbolträchtigen Treffen an der Grenze Klingenbach/Sopron. Alois
Mock und Gyula Horn, die damaligen Außenminister Österreichs und
Ungarns, durchtrennten zum Zeichen der Grenzöffnung den "Eisernen
Vorhangs", der jahrzehntelang die Trennlinie zwischen West- und
Osteuropas bildete.
Dieser 11 Meter hohe, vollständige aus Stahl bestehen Wachturm wurde
serienmäßig für den Einsatz am „Eisernen Vorhang“ gefertigt. Schon kurz
nach dem Fall verfolgten die Landessammlungen Niederösterreich das
Ziel, einen Abschnitt der Grenzschutzeinrichtungen der ČSSR museal zu
sichern, um so diese historische Epoche zu dokumentieren. Fündig wurde
man in der Gegen um Halamky, eine Ortschaft nahe der Grenze bei
Schrems. Der Wachturm wurde bei der Niederösterreichischen
Landesausstellung 2009 in Rabbs erstmals aufgestellt, seinen fixen
Standort hat er im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in
St. Pölten gefunden.

Burg Ottenstein entspricht dem Typus einer Höhenburg. Das Modell zeigt
den Bauzustand in romanischer Zeit. Die Burg besteht zu dieser Zeit nur
aus einem Bergfried, dem Pallas und Wirtschaftsgebäuden. Die Kapelle
ist von außen zugänglich, wodurch auch die bäuerliche Bevölkerung
Zutritt hat.
Wehrkirche St. Peter in der Au: Anders als Stadtbürger haben
Dorfbewohner kein Recht auf eine Befestigung. Das massivste Bauwerk ist
stets die Kirche. In gefährdeten Gegenden wie etwa der Buckligen Welt,
der Wachau oder dem Mostviertel werden Kirchen mit Mauern umgeben und
so zu Wehrkirchen verstärkt. Der einzige Zugang führt durch einen
Torturm.

Rudolf I. von Habsburg, um 1910 - Hans Müller (1873-1937)
Rudolf ist der erste Habsburger auf dem Thron des Heiligen Römischen
Reiches. Um seinen Landbesitz zu vergrößern und seiner Herrschaft
Autorität zu verschaffen, ist er ständig unterwegs. Nicht alle Teile
des Reiches sind aber gleich gut zu erfassen. Man spricht von
„königsfernen" und von „königsnahen" Gebieten - darunter auch
Österreich.

INFLATIONÄRE NEUSTÄDTE
Im Jahr 2007 stößt ein Wiener Neustädter in seinem Garten auf
„schlammverkrustetes Zeug", das er vorerst in seinem Keller lagert.
Erst einige Jahre später, beim Verkauf seines Hauses, entpuppt sich der
Fund als wertvoller mittelalterlicher Schatz. Die kostbaren Schmuck-
und Gebrauchsgegenstände werden 600 Jahre früher, um 1400, außerhalb
der Stadtmauer von Wiener Neustadt vergraben, das zu dieser Zeit noch
„niuwe stat" heißt, also „Neustadt", und gerade einmal 200 Jahre alt
ist. Bei seiner Erbauung durch den Babenbergerherzog Leopold V. spielte
Lösegeld eine bedeutende Rolle. Warum aber trägt die als Bollwerk gegen
die Ungarn errichtete Neustadt heute Wien in ihrem Namen?
Wiener Neustädter Schatzfund, 13./14. Jh.
Der 2010 entdeckte Schatzfund umfasst etwa 150 Objekte oder
Objektteile, die allesamt aus Silber bestehen und zumeist auch
vergoldet sind. Dabei handelt es sich um Kleidungszubehör, Schmuck und
Tafelgeschirr, die ursprünglich im Besitz von Angehörigen der
Oberschichten standen. Viele Objekte sind typisch für Mittelosteuropa,
andere zeigen Einflüsse aus West- und Nordeuropa oder aus dem
Mittelmeerraum. Man vermutet, dass ein Goldschmied oder
Edelmetallhändler um 1400 die damals schon altmodischen, wegen des
Gold- und Silbergehaltes jedoch wertvollen Stücke gesammelt hat, um sie
später einzuschmelzen und neu zu verarbeiten. Wohl um sich die Tormaut
von Wiener Neustadt zu ersparen, vergräbt er die Stücke provisorisch in
der Nähe der Stadtmauer.

Entfernen: Entfernung aus der
Gesellschaft, dem Land, dem Leben: Damit sind in Mittelalter und Früher
Neuzeit Juden mehrfach konfrontiert. In Niederösterreich kommt es 1305
in Korneuburg, 1338 in Pulkau und andernorts zur Ermordung zahlreicher
Juden. Man beschuldigt sie, Hostien geschändet zu haben. 1420/21 werden
rund 800 arme Juden vertrieben und 200 vermögende in Wien verbrannt.
1496/97 folgt schließlich die Vertreibung „für ewige Zeiten" aus dem
Herzogtum Steiermark, doch schon um 1500 kommen wieder Juden nach Wien.
Ab 1511 müssen sie einen „gelben Fleck" zur Kennzeichnung tragen eine
Maßnahme, die bis 1624 gilt, als im heutigen 2. Wiener Bezirk das erste
Ghetto in Österreichs Geschichte eingerichtet wird. Bis zur neuerlichen
Vertreibung 1671 leben in Niederösterreich an mehr als 70 Orten Juden.
Ihre „Entfernung" aus dem Gedächtnis hält bis heute an.
* * *
Uniform der Österreichischen Zollwache, 1978-1986
Die Zollwache wird bereits 1830 - also noch vor Gendarmerie und Polizei
- gegründet. Sie hat nicht nur die Ein-und Ausfuhr von Waren zu
kontrollieren, sondern auch illegale Grenzübertritte zu verhindern. Mit
der EU-Osterweiterung 2004 wird die Zollwache aufgelöst, ihre Aufgaben
werden der Zollaufsicht übertragen.
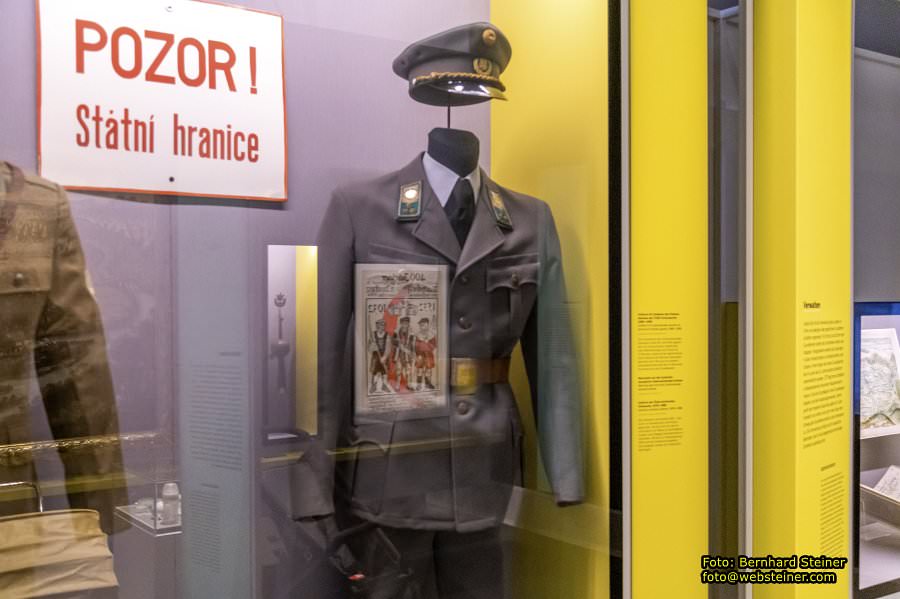
Salamihändler, um 1750, Porzellanmanufaktor Augarten
Als Kaufrufer werden Wanderhändler bezeichnet, die ihre Waren mit einem
charakteristischen Ruf lautstark anbieten. Im 18. Jahrhundert kommen
sie als Porzellanfiguren in Mode. Damals wird es auch in Kunstsparten
wie Theater und Oper populär, das „einfache" Volk auftreten zu lassen.
Die Realität ist weniger pittoresk: 1771 wird das Hausieren wieder
einmal verboten.

Gnadenstuhl aus Stift Säusenstein, Fels am Wagram, nach 1511
In der Zeit der Reformation kommt die europäische Kunst zur Blüte. Als
Vorlage für diesen Gnadenstuhl dient ein Holzschnitt Albrecht Dürers.
Dargestellt ist die Dreifaltigkeit: Gottvater - mit einer Mitrakrone,
die jener Kaiser Maximilians I. (1459-1519) ähnelt -, Christus und der
Heilige Geist.

Glaubenskrisen: Die Krise des
Glaubens beginnt bereits im späten Mittelalter. Der Engländer John
Wyclif und der Tscheche Jan Hus stellen um 1400 ähnliche Forderungen
auf wie Martin Luther 100 Jahre später: etwa, die Bibel in
Volkssprachen zu übersetzen und sie als einzig relevante Glaubensquelle
zu betrachten. Hus wird 1415 als Ketzer öffentlich verbrannt, seine
Anhänger lösen die Hussitenkriege aus. In dieser Zeit großer religiöser
und sozialer Umbrüche entwickeln sich auch irrationale Ängste. Am
deutlichsten finden sie in den Hexenverfolgungen Ausdruck, die sich vor
allem gegen Frauen richten. Sie reichen ins Mittelalter zurück, erleben
ihren Höhepunkt aber erst im Zeitalter des Humanismus im 15. und 16.
Jahrhundert: Nun meint man, die Schuld der Hexen unter Einsatz der
Folter rechtlich korrekt und „wissenschaftlich" prüfen zu können.
Der böhmische Reformator Jan Hus (1372-1415) fordert die Abkehr der
Kirche von weltlichem Besitz und Macht. Zudem hinterfragt er die
Autorität des Papstes. 1411 wird Jan Hus exkommuniziert. Da man ihm
freies Geleit zusichert, besucht Hus 1414 das Konzil von Konstanz. Dort
wird er von der Vollversammlung als Ketzer zum Tod durch Verbrennen
verurteilt.
Reformation: Mit dem Anschlag
der 95 Thesen durch Martin Luther 1517 nimmt die Spaltung der
lateinischen Christenheit ihren Anfang. Der Theologe kritisiert die
Zustände in der Kirche - insbesondere die Käuflichkeit kirchlicher
Ämter und den Ablasshandel - und fordert eine religiöse Neubesinnung.
Die Reformideen breiten sich dank des Buchdrucks rasch aus, sowohl bei
den unterdrückten Bauern als auch beim Adel: Bereitwillig nimmt dieser
den neuen evangelischen Glauben an, um sich gegen die Landesherren zu
stellen. Die politische Spaltung im Heiligen Römischen Reich - Kaiser
und katholische Landesherren gegen protestantische Landesherren und
Stände - endet vorläufig im Augsburger Religionsfrieden 1555. Nach dem
Prinzip „cuius regio, eius religio" („wessen Gebiet, dessen Religion")
bestimmt die Konfession des Landesherrn jene der Untertanen.
NIEDERÖSTERREICH – -PROTESTANTISCHE HOCHBURG
Als 1517 Martin Luther in Wittenberg in 95 Thesen den Ablasshandel und
andere Verfehlungen der katholischen Kirche anprangert, nimmt die
Reformation ihren Anfang. Luthers Bibelübersetzung schafft die
Voraussetzung, dass sich die neue Glaubensauslegung im
deutschsprachigen Raum rasant verbreitet. Auch in Wien und
Niederösterreich bekennen sich im Lauf des 16. Jahrhunderts weite Teile
der Bevölkerung zum evangelischen Glauben. Wien ist damals Zentrum des
protestantisch dominierten niederösterreichischen Adels, zugleich aber
Sitz katholischer Kaiser und Landesherren. Die Protestanten nutzen
zahlreiche rechtliche Schlupflöcher, um ihren Glauben praktizieren zu
können. Umso rücksichtsloser greift am Ende des 16. Jahrhunderts die
Gegenreformation durch - und ist letztlich siegreich.
Heiliger Nepomuk, 18. Jh.
Der Legende nach wird der Prager Domherr Johannes Nepomuk 1393 von
König Wenzel in die Moldau gestürzt, weil er als Beichtvater der
Königin das Beichtgeheimnis nicht brechen will. Tatsächlich steht die
Tat im Kontext der Kirchenspaltung. Nepomuk wird zum Märtyrer erklärt
und gilt als Brückenheiliger. Die Habsburger fördern seine Verehrung in
Böhmen, um jene von Jan Hus zu bannen.
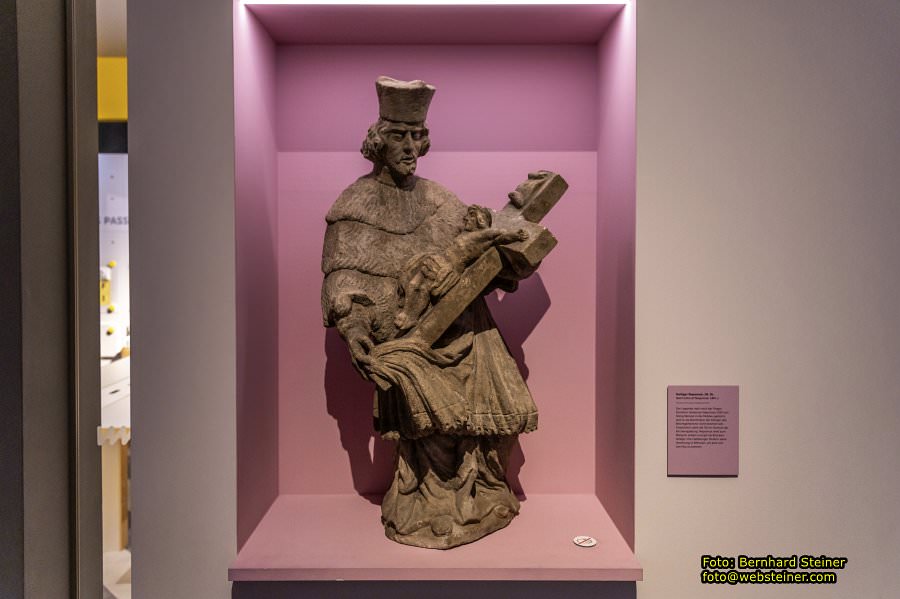
Schulbesuch als Privileg
Höhere Bildung lässt sich im Mittelalter im Wesentlichen nur in
Klöstern erwerben. Mit der Reformation des 16. Jahrhunderts, die auch
die Pädagogik einschließt, wird humanistische Bildung für einen
größeren Kreis zugänglich. In den protestantischen „Hohen Schulen" sind
stets auch Plätze für mittellose Schüler reserviert. Neue katholische
Orden wie Jesuiten und Piaristen greifen diese Bildungsoffensive auf.
Das Gymnasium entsteht. Bildung für alle: Das ist eines der erklärten
Ziele der Aufklärung, auch gegen Widerstände - etwa vonseiten der
Bauern und später Arbeiter, die Bildung für nicht zwingend erachten.
Doch die Obrigkeit forciert den Schulbesuch. So führt etwa Maria
Theresia 1774 die allgemeine Schulpflicht ein. Der Staat übernimmt nun
die Verantwortung für die Ausbildung seiner Bürgerinnen und Bürger.
Bänke aus einer Mödlinger Volksschule, 1892
1892 wird in der Schöffel-Vorstadt von Mödling, in der
Maria-Theresien-Gasse, eine Volksschule errichtet. 1938 kommt in dem
Gebäude auch eine Handelsschule unter. 50 Jahre später geht das Haus in
den Besitz der Wiener Kaufmannschaft über. Im Zuge seiner Räumung stößt
man auf diese Schulbänke aus dem Gründungsjahr der Volksschule.

Schützenscheibe, 1782
Die Schützenscheibe zeigt Joseph II. an eine Kugel gelehnt, in der
rechten Hand eine Kerze als Symbol der Aufklärung. Die Aufschrift der
Scheibe zeugt jedoch von vorsichtiger Kritik am Reformeifer des
Kaisers: „Ich trage mit Gedult, was ich selbst nicht verstehe, mein
Weiser hat die Schuld, wann ich nicht richtig gehe."

Kaiser Joseph II., um 1770, Pompeo Girolamo Batoni zugeschrieben (1708-1787)
Joseph II. ist der erste Habsburger Herrscher, der sich auch am Hof
fast nur in militärischer Uniform zeigt. Er bezieht damit Position
gegen den höfischen Prunk seiner Vorgänger. Bereits 1766 schafft der
Herrscher das spanische Mantelkleid ab, ein Sinnbild zeremonieller
Tradition.
Nachbildung eines josephinischen „Sparsargs"
Hier wird zu praktisch gedacht: Die Verstorbenen sollen, in einen Sack
gehüllt, durch die Klappe an der Unterseite ins Grab fallen, der Sarg
lässt sich weiterverwenden. Die von Joseph II. 1785 eingeführte
Sparmaßnahme muss bald wegen heftiger Proteste der Bevölkerung
zurückgenommen werden.

Kaiser Franz I., Pompeo Marchesi (1789-1858)
1804 krönt sich Napoleon zum Kaiser von Frankreich. Aus Furcht, er
würde auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden, nimmt Franz
II. den Titel Kaiser von Österreich an. 1806 legt er, nun Franz I., die
Krone des Heiligen Römischen Reiches zurück und löst es auf. 1816
erwerben die niederösterreichischen Stände diese Büste, die ihn als
Imperator darstellt.

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, um 1789, Jean-Jacques-François Le Barbier (1738-1826)
Im Zuge der Französischen Revolution schreibt die Nationalversammlung
das Recht auf persönliche Freiheit, Schutz des Eigentums und Gleichheit
vor dem Gesetz nieder. Das Volk habe die Gewalt, dem Staat eine
Verfassung zu geben. Alarmiert verfolgen die absolutistischen Monarchen
Europas die Vorgänge.
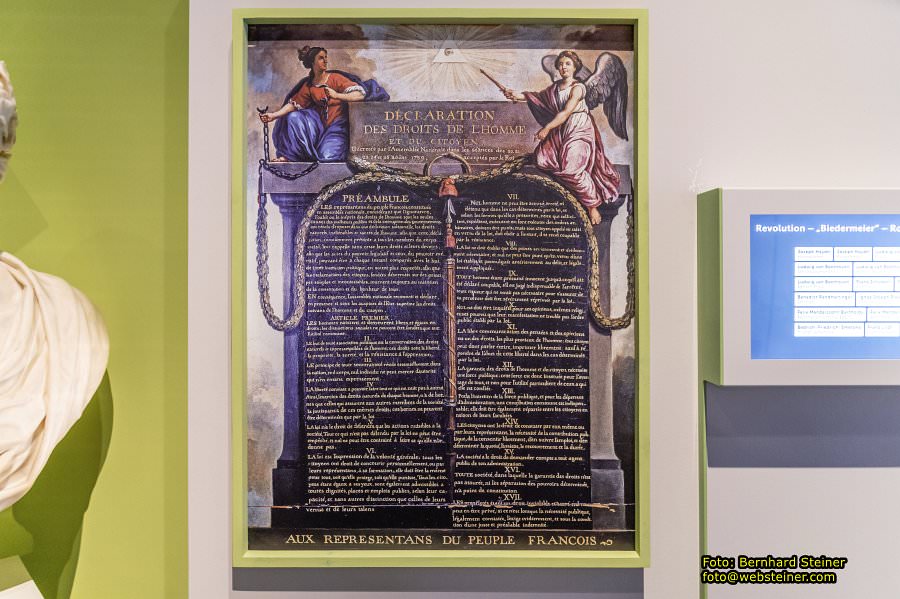
Die sinkende Macht des Kaisers
1848 besteigt der 18-jährige Franz Joseph in Olmütz/Olomouc den Thron.
Umgeben von konservativen Beratern, versucht er bald nach
Niederschlagung der Revolution seinen absolutistischen
Regierungsanspruch durchzusetzen. Erst militärische Niederlagen in
Oberitalien 1859 und bei Königgrätz/Hradec Králové 1866 bringen ihn
finanziell und damit auch politisch unter Zugzwang. Der Kaiser muss den
Bürgern nun mehr Mitsprache einräumen und einen Ausgleich mit Ungarn
suchen. 1867 erhält Österreich-Ungarn eine liberale Verfassung und wird
zur konstitutionellen Monarchie. Die politischen Forderungen von
Tschechen und Südslawen verhallen indes ungehört. Auch auf den
gesellschaftlichen Wandel reagiert der traditionsbewusste Kaiser nicht.
Das Zeremoniell seines Hofes wirkt wie aus der Zeit gefallen und lässt
auch nichts vom teilweisen Machtverlust erkennen.
„DIE SUCHT, IM NAMEN DER GEMEINDE DAS GROSSE WORT ZU FÜHREN"
Am 6. April 1861 tritt der erste gewählte Landtag von Niederösterreich
zusammen. Ort des Geschehens ist das Landhaus in der Wiener
Herrengasse, wo man bis zur Umsiedlung nach St. Pölten im Jahr 1997
tagt. Einer der umstrittensten Abgeordneten des Niederösterreichischen
Landtages ist Karl Lueger, der demselben ab 1890 angehört. Lueger ist
Galionsfigur und lautes Aushängeschild der 1893 gegründeten
Christlichsozialen Partei, die 1902 die absolute Mehrheit im
Niederösterreichischen Landtag erringt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt
Lueger bereits als Wiener Bürgermeister fest im Sattel. Sein
mächtigster Gegner ist der liberale Statthalter von Niederösterreich,
Erich Graf von Kielmansegg. Er hält mit seiner Meinung nicht hinter dem
Berg.
Kaiser Franz Joseph I. im Ornat des Ordens vom Goldenen Vlies, um 1900, V. Kretschmer
Nach Aussterben der Herzöge von Burgund 1477 übernehmen die Habsburger
den Orden vom Goldenen Vlies. Sie verleihen die Auszeichnung an
verdienstvolle Adelige und sichern sich so deren Loyalität. Großmeister
ist bis heute das Oberhaupt des Hauses Habsburg.

Kleider machen Völker
Die Alltags- und Festkleidung der ländlichen Bevölkerung wird im 19.
Jahrhundert vom Bürgertum als Element einer heilen Welt auf dem Lande
verklärt. Zur gleichen Zeit beginnt sich die Volkskunde
wissenschaftlich mit Trachten zu befassen, sie zu sammeln und zu
dokumentieren. So entstehen Aufzeichnungen bekannter Trachten aus allen
Regionen der Donaumonarchie. Die regionale und nationale Abgrenzung
fördert die spätere Ideologisierung der Tracht - bis hin zur
„völkischen" Trachtenpflege, besonders im Nationalsozialismus. Auch
nach 1945 spielt die Tracht noch eine wesentliche Rolle bei der
Identitätssuche Österreichs und einiger Nachbarregionen jenseits des
„Eisernen Vorhangs". In den vergangenen Jahrzehnten bildet sich mit dem
Landhausstil und erneuerten Trachtenmodellen eine ideologisch weniger
belastete Form der Tracht aus.
Trachtenpuppen, 1990er-Jahre
Die frühe Volkskunde widmet sich mit Begeisterung den verschiedenen Erscheinungsformen der Tracht.
Trachtenausstellungen anhand bekleideter Puppen sind Anfang des 20.
Jahrhunderts sehr beliebt. Diese Gruppe wird nach Aufzeichnungen aus
dem späten 19. Jahrhundert erstellt. Sie gibt regionale Trachten aus
dem Gebiet der Donaumonarchie wieder.

„NIEDERDONAU" – -GAUHAUPTSTADT KREMS
Knapp zwei Monate nach dem vielerorts bejubelten „Anschluss"
Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938
geben die NS-Behörden den Umfang des nunmehrigen Gaues „Niederdonau"
bekannt: Zum Gebiet des bisherigen Bundeslandes Niederösterreich kommen
Teile des Burgenlandes. 97 niederösterreichische Gemeinden werden
hingegen „Groß-Wien" zugesprochen, das sich im Süden nun ungefähr bis
Baden, im Westen bis nach Pressbaum-Alland, im Norden bis knapp vor
Korneuburg und im Osten bis Fischamend erstreckt. Der zum Gauleiter
ernannte St. Pöltner Arzt Hugo Jury will „Niederdonau" zu einem
„Mustergau des Dritten Reiches" machen. Gauhauptstadt wird jedoch nicht
das von ihm favorisierte St. Pölten, sondern Krems.
Politische Deutungen einer Landschaft
An alte Kulturlandschaften knüpfen sich zahllose Geschichten,
kollektive Erinnerungen, Sagen und Mythen. Sie lassen sich immer wieder
neu deuten und politisch aufladen. So wird die Wachau im vergangenen
Jahrhundert vielfach vereinnahmt: Die einen sehen in ihr eine ideale
katholische Landschaft von Stiften, Klöstern und Heiligen. Für andere
ist sie typisch altdeutsch - mit ihren Burgen, Rittern und dem
Nibelungenlied, das die Wachau mit dem Rhein verbindet. Als Krems 1938
zur Gauhauptstadt von Niederdonau ernannt wird, verschafft das der
Vorstellung einer „deutschen Wachau" besonderen Auftrieb. Nach 1945 ist
man bemüht, die Wachau politisch zu neutralisieren, und betont nun vor
allem ihr reiches kulturelles Erbe. Die ersten niederösterreichischen
Landesausstellungen der späten 1950er-Jahre geben Ausdruck vom Bemühen
um ein neues Österreichbild.
„Blick gegen Melk mit dem großen Emmersdorfer Viadukt", 1906, Anton Hlavacek (1842-1926)
Das Monumentalgemälde wird für die Internationale Verkehrsausstellung
1906 in Mailand geschaffen. Österreich präsentiert dort seine neuesten
Eisenbahnprojekte, so die Mariazellerbahn und die - damals noch in Bau
befindliche - Wachauer Bahn, zu der das Viadukt im Vordergrund des
Bildes gehört. Bei der Trassenführung werden Wünsche von Denkmal- und
Landschaftsschützern berücksichtigt.
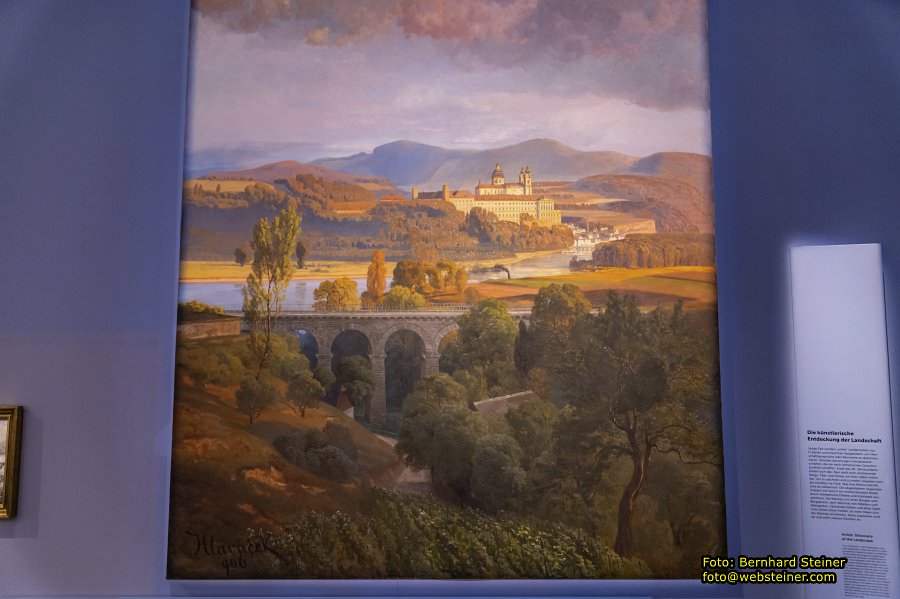
Begegnungsort Küche
Essen stiftet Identität: In der Ernährung werden kulturelle
Unterschiede offenkundig, sie bringt Menschen aber auch zusammen. Immer
ist die Küche ein Ort, an dem Ideen, Rohstoffe und Zubereitungsarten im
wahrsten Sinn des Wortes in einem Topf landen können. Mit dem Essen
lässt sich eine kulinarische „Heimat" schaffen, aber ebenso die Ferne
schmecken. Seit dem 19. Jahrhundert tauschen sich Esskulturen verstärkt
miteinander aus was nicht zuletzt eine Folge der zahlreichen
Migrationsströme ist. Ein gutes Beispiel: die österreichische Küche.
Sie vereint italienische, slowenische, böhmische und ungarische
Einflüsse.
„Sevilla Serie Nr. 17", 1991, Daniel Spoerri (geb. 1930)
Daniel Spoerri schafft um 1960 seine ersten „Fallenbilder". Dazu
fixiert er Gegenstände alltäglicher Handlungen, wie etwa das benutzte
Geschirr einer Mahlzeit, auf ihrer Unterlage und befestigt diese an der
Wand. Den Betrachtenden wird solcherart eine „Falle" gestellt:
Schließlich könne, so die Annahme, ein Tisch mit Resten einer Mahlzeit
nicht hängen.

Modell der Stadt Retz um 1740, Oskar Chmelik
Die Siedlung Retz wird ab 1280 auf Initiative Graf Bertholds von
Rabenswalde um die planmäßig angelegte „Neustadt" erweitert. Diese ist
in einem rechteckigen Grundriss angelegt und von einer Mauer umgeben.
Den Hauptplatz mit dem Rathaus säumen mehrgeschossige Bürgerhäuser.
Dahinter liegen Gassen mit den Häusern der Handwerker.

Der Landesherr: Der Sieg
Rudolfs von Habsburg über Ottokar II. von Böhmen 1276 und dessen Tod in
der Schlacht auf dem Marchfeld 1278 markieren eine Zäsur: Damit beginnt
die 640 Jahre währende Herrschaft der Habsburger in den Herzogtümern
Österreich und Steiermark. Lange Zeit müssen sich die Habsburger als
Landesherren die politische Macht mit Landständen und Städten teilen.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind sie auf Steuerleistungen und
militärische Hilfe der Stände angewiesen. Diese Abhängigkeit nützen die
Stände nicht selten offen aus. Erst mit der Niederlage der Stände in
der Schlacht am Weißen Berg bei Prag 1620 vermag der habsburgische
Landesherr das Ringen um die Macht endgültig für sich zu entscheiden.
Der absolute Monarch hält die politische Macht von nun an in seinen
Händen. In der Verwaltung des Landes ist er freilich weiterhin auf die
Stände angewiesen.
Kaiser Friedrich III.:
Friedrich wird 1452 vom Papst in Rom zum römisch-deutschen Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Die Verschränkung der Kaiserwürde
mit dem Hause Habsburg währt mit wenigen Ausnahmen von 1439 bis zum
Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806. Der hier im hohen Alter
dargestellte Kaiser Friedrich III. leitet 53 Jahre lang dessen
Geschicke.

Die Hauptausstellung ist das Kernstück des Hauses der Geschichte. Sie
präsentiert Geschichte spannend, zeitgemäß und stellt Bezug zu
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen her. Laufend fließen neue
Forschungsergebnisse in die Präsentation ein.Die Ausstellung ist nicht
nach Epochen gegliedert, sondern nach Themen und Fragen. Wie wurden
Territorien besiedelt und verwaltet? Sind Ein- und Auswanderung nur
Phänomene der Gegenwart? Wie gewinnen Personen und Gruppen Macht über
andere? Wie entsteht das Zusammengehörigkeitsgefühl von Gruppen,
Regionen und Nationen? Welche technischen Erfindungen haben in den
letzten Jahrhunderten Gesellschaft und Umwelt verändert?
Im letzten Drittel des Rundgangs werden politische Konflikte und
Exzesse totalitärer Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
thematisiert. Aber auch die bedeutenden technischen, sozialen und
politischen Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit einem
Blick auf die nähere Zukunft des gemeinsamen europäischen Raumes und
die Rolle Niederösterreichs und Österreichs endet der Rundgang.

DIE WIENER KOMMEN! Der Stadt in den Sommermonaten entfliehen - das gilt
schon im 19. Jahrhundert als en vogue. Damals wie heute sind die
Sommerfrische und der Zweitwohnsitz am Land mehrheitlich privilegierten
Bevölkerungsgruppen vorbehalten. Im 19. Jahrhundert ist es das
wohlhabende Bürgertum, das der großstädtischen Hitze den Rücken
zukehrt. Mit dem Ausbau der Eisenbahn etabliert sich der Wienerwald als
Region für Ausflüge und Zweitwohnsitze und bleibt es: Eichgraben zählt
aktuell 31 Prozent Nebenwohnsitze. Längst aber werden diese nicht mehr
nur genutzt, um im Sommer der Großstadt zu entkommen. Ausgelöst durch
die Coronakrise, haben die Wienerinnen und Wiener heute vermehrt ihr
Büro im Gepäck und schlagen ihr Home-Office im niederösterreichischen
Grün auf. Manche kommen auch, um zu bleiben.
Modell der Dampflokomotive „Vindobona", 1843
Als erste Dampfeisenbahn Österreichs nimmt die
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn 1838 ihren fahrplanmäßigen Betrieb auf. Die
„Vindobona" ist die erste Personenzuglokomotive der Bahnstrecke. 1837
in der Lokomotivfabrik George Stephenson & Co hergestellt, zeichnet
sie sich durch eine dritte Achse hinter der Antriebsachse aus. 1865
wird die Lokomotive ausgemustert.

Umbau der Landschaft: Gewässer sind von alters her wichtige
Transportwege und Energielieferanten, aber auch eine latente
Gefahrenquelle. Daher werden sie bereits vom Mittelalter an durch den
Bau von Kanälen und Regulierungen befahrbar gemacht. Ab Mitte des 19.
Jahrhunderts lassen sich dank dampfbetriebener Bagger- und Güterschiffe
auch große Flussläufe regulieren so wie die Donau ab 1870. Später nutzt
man die Wasserkraft zur Gewinnung von Elektrizität im großen Stil.
Erste Kraftwerke entstehen noch vor dem Ersten Weltkrieg. Nationale
Prestigeprojekte sind nach 1945 die großen Kraftwerksprojekte an Donau,
Drau, Save und Inn. Sie schaffen Arbeitsplätze und decken den
steigenden Energiebedarf, lassen aber auch ganze Landstriche in
Stauseen versinken. Nur selten können Bürgerinitiativen Naturparadiese
wie jenes in den Donauauen bei Hainburg retten.
Modell des Dampfschiffes „Maria Anna"
Am 17. September 1837 um acht Uhr in der Früh legt das Dampfschiff
„Maria Anna" an der Linzer Donaulände an - als erstes Passagierschiff,
das auf dieser Strecke fährt. Von Wien nach Linz hat es „nur" 55
Stunden und 22 Minuten gebraucht. Ein Schiffszug benötigt zu dieser
Zeit 14 Tage.

Baugrube in Persenbeug, 1956/57, Karl Schiestl (1899-1966)
Erste Planungen für ein Donaukraftwerk bei Ybbs werden bereits in den
1920er-Jahren angestellt. Obwohl 1936 eine wasserrechtliche Bewilligung
für den Bau erfolgt, wird das Kraftwerk erst 20 Jahre später eröffnet.
Es gilt als Prestigeprojekt der Wiederaufbauzeit und wird als solches
von einem namhaften Künstler festgehalten.

Steyr 80a, 1955
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg
kommt es zur Motorisierung der Landwirtschaft: Erstmals können auch
kleinere Betriebe von tierischer Zugkraft auf Traktoren umsteigen. 1949
kommt der 15 PS starke „15er Steyr" auf den Markt. Das Modell 80a wird
wegen seiner Bodenfreiheit auch „Hackfruchter" genannt.
Modell einer Dampfdreschmaschine
Dampfdreschmaschinen stehen ab 1850 in Großbetrieben in Verwendung.
Durch die Bildung von Dreschgenossenschaften und den Lohndrusch können
ab 1900 auch kleinere Betriebe die teuren Maschinen nützen. Besonders
vorteilhaft sind Modelle, die ausdreschen, ausputzen und sortieren,
also nahezu marktfähige Körner liefern.
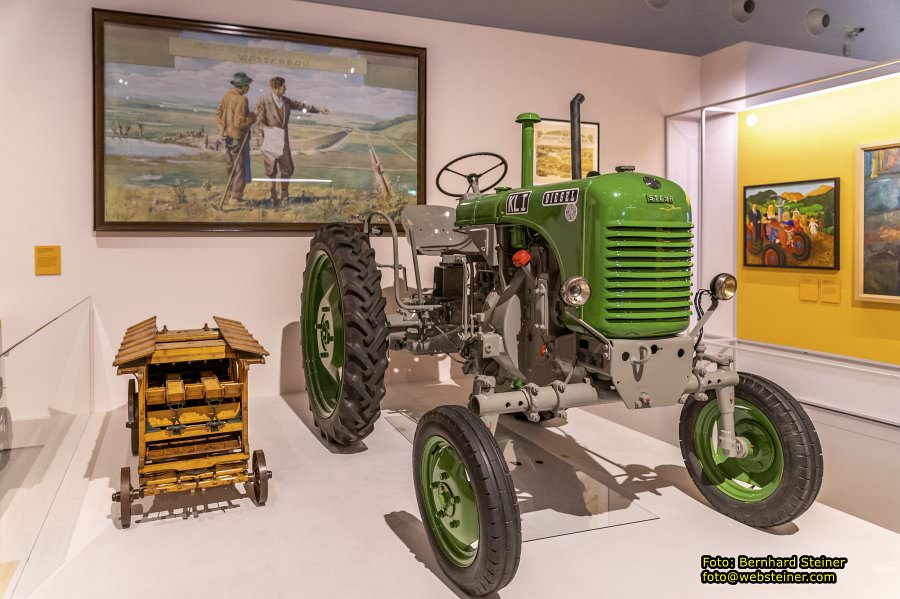
Fossile Energie
Kohle ist der erste wichtige fossile Energieträger. Im 20. Jahrhundert
laufen ihr Erdöl und Erdgas den Rang ab. Zu den frühesten bekannten
Lagerstätten der Habsburgermonarchie gehören die Ölfelder in Galizien.
In Österreich stößt man in den 1930er-Jahren im Raum Zistersdorf
erstmals auf wirtschaftlich bedeutende Erdöllagerstätten. In der
NS-Zeit werden die niederösterreichischen Ölfelder für die deutsche
Rüstung, in den Jahren der sowjetischen Besatzung für die Wirtschaft
der UdSSR ausgebeutet. Aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung (SMV)
wird mit dem Staatsvertrag 1955 die Österreichische Mineralölverwaltung
(heute OMV). Sie kann den Erdölbedarf des Landes zunächst noch selbst
decken. Heute macht Erdöl aus dem Weinviertel nur mehr zehn bis 15
Prozent der in Österreich benötigten fossilen Energie aus.
„Ölfeld bei Mühlberg", 1956/57, Karl Schiestl (1899-1966)
Schnittmodelle zur Erdölförderung im Weinviertel, um 1990
Nach erfolgreicher Voruntersuchung wird eine Bohrung vorgenommen, die
im Weinviertel in eine Tiefe von bis zu 8,5 Kilometern reichen kann.
Sind die Förderrohre fertig, wird statt des Bohrturms eine sogenannte
Sonde errichtet. Diese pumpt das Rohöl beziehungsweise ein
Öl-Wasser-Gemisch, das nur zu einem Zehntel aus reinem Öl besteht, aus
der Erde.

Gesticktes Spruchtuch: Gestickte Sinnsprüche schmücken ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts bürgerliche und später auch bäuerliche
Haushalte. Ihre Verbreitung steht auch mit der Aufwertung des Wohnraums
in Zusammenhang - schließlich schützen solche Tücher Wände und Möbel.
Sie sind mit Haussegen, moralischen Anweisungen oder Appellen versehen,
sein Schicksal zu ertragen.
Freude an der Häuslichkeit hat noch keine Frau gereut

Stechuhr, um 1911
Stech- und Stempeluhren kommen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts auf, sie werden zum Symbol für die Durchsetzung penibler
Pünktlichkeit in der Arbeitswelt. Mit der exakten Erfassung der
Arbeitszeit wird Akkordarbeit möglich. Sie erleichtert die Planung der
Produktion, diszipliniert nicht zuletzt aber auch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Zimmerplan des Hotel Panhans am Semmering, um 1930
Das Hotel Panhans wird 1888 von Vinzenz Panhans gegründet, der zuvor
als Küchenchef im nahen Südbahnhotel tätig ist. Bis zum Ersten
Weltkrieg wächst das „Panhans" auf 400 Zimmer an und zählt damit zu den
größten Hotels Europas. Den heute noch bestehenden Erweiterungsbau
planen die Theaterarchitekten Hermann Helmer und Ferdinand Fellner.
Teller aus dem Südbahnhotel, um 1882, Désirée Vasko-Juhász
Die Idee zur Errichtung des Südbahnhotels geht auf den Generaldirektor
der Südbahn-Gesellschaft, Friedrich Schüler, zurück. Es soll für
zusätzliche Einnahmen und eine Erhöhung der Fahrgastfrequenz sorgen.
1882 ist das Hotel fertig, es folgen Zubauten und Erweiterungen. In
seiner Blütezeit zählt das Haus mehr als 350 Zimmer und beherbergt über
1.000 Gäste.

Modell des Austro-Daimler Benzin-Triebwagens BBÖ VT 63, 1933/34, Fritz Sedlacek
Als Anfang der 1930er-Jahre der Automobilmarkt durch die
Wirtschaftskrise zusammenbricht, entwickelt Austro-Daimler mehrere
Schnelltriebwagen für die Bahn. Der VT63 wird für den Fernverkehr auf
der Südbahn gebaut. Die wirtschaftlichen Probleme des Unternehmens
lassen sich dadurch aber auch nicht lösen. Als Austro-Daimler 1934 mit
der Steyr AG fusioniert, wird der Bau von Pkw gänzlich eingestellt.

GETEILTES LAND
Österreich ist ab dem Kriegsende 1945 von den Streitkräften der
Alliierten besetzt. Die Besatzungsmächte teilen Österreich in vier
Zonen auf, deren Grenzen quer durch das Land verlaufen.
Niederösterreich, Burgenland und das oberösterreichische Mühlviertel
werden von den Sowjets besetzt. Das in der sowjetischen Besatzungszone
liegende Wien gliedern die Alliierten in fünf Sektoren: Wenn man so
will, erhält jede Besatzungsmacht ein Stück vom Kuchen, also einen
Sektor der Hauptstadt. Das Wiener Stadtzentrum als fünften,
internationalen Sektor kontrollieren die Alliierten gemeinsam. Die
Bewegungsfreiheit der Menschen im geteilten Land ist stark
eingeschränkt. Für die niederösterreichische Bevölkerung liegt Wien,
trotz der geringen geografischen Distanz, in weiter Ferne.

Fahndungsfoto Margarethe Ottillingers, aufgenommen in Baden bei Wien, November 1948
Am 5. November 1948 wird die aus Steinbach stammende Margarethe
Ottillinger - damals eine der höchsten Beamtinnen der Republik - am
amerikanisch-sowjetischen Zonenübergang auf der Ennsbrücke nahe St.
Valentin verhaftet. Der ebenfalls im Auto sitzende Minister Peter
Krauland greift nicht ein. Sie wird der Spionage und Fluchthilfe für
einen sowjetischen Ingenieur bezichtigt - und zur Lagerhaft im GULAG
verurteilt.
Nach ihrer Verhaftung wird Ottillinger die Uhr abgenommen und vor ihren
Augen zerlegt. Die Botschaft dieser „Durchsuchung" ist ihr in diesem
Moment völlig klar, wie sie später festhält: Von nun an, in
sowjetischer Haft, spielt Zeit für sie keine Rolle mehr. Sie überlebt
sieben Jahre im sowjetischen GULAG, kehrt 1955 zurück und wird
Vorstandsmitglied der OMV.
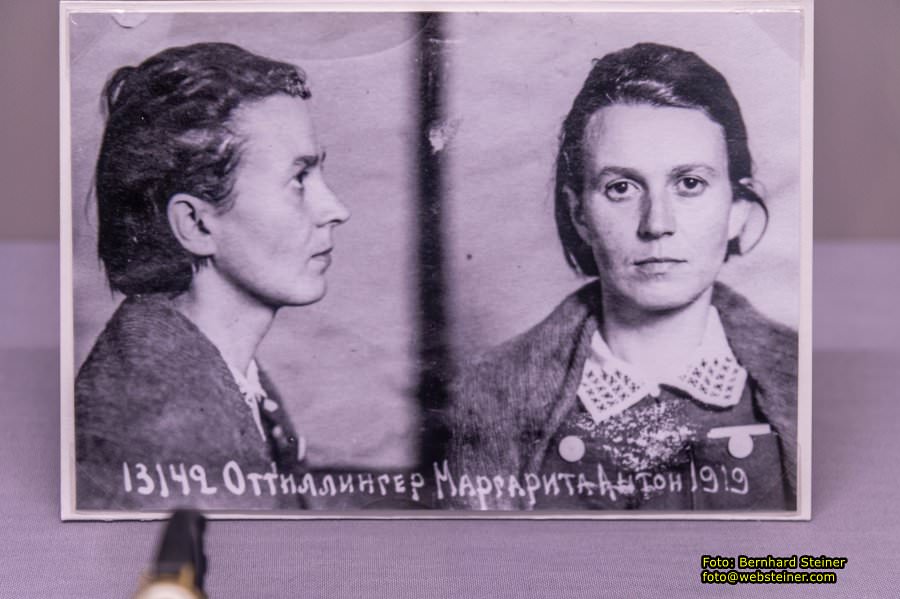
NIEDERÖSTERREICH IM WANDEL
Zehn Jahre nach Wiedererrichtung der Republik und nach langem Ringen
der Regierungen Leopold Figl und Julius Raab wird 1955 der
Staatsvertrag unterzeichnet: „Österreich ist frei". Der Wiederaufbau
erfolgt großteils mit US-amerikanischer Hilfe. Wirtschaft, Gesellschaft
und Kultur können sich frei entwickeln. Industrialisierung,
Massenkonsum, Umweltbewegung, Emanzipation der Frau, neue
Kommunikationsmittel: Der gesellschaftliche Wandel schreitet
beschleunigt voran. Die Globalisierung lässt die Welt enger
zusammenrücken, gleichzeitig bekommen regionale Besonderheiten einen
höheren Stellenwert. Zunächst noch benachteiligt durch die Folgen der
sowjetischen Besatzung und seine Lage am „Eisernen Vorhang", entwickelt
sich Niederösterreich vom industrialisierten Agrarland zum agrarischen
Industrieland ... und schließlich zu einer Modellregion im Herzen
Europas, die mit kultur- und forschungspolitischen Initiativen von
überregionaler Bedeutung hervortritt.

Niederösterreich: Wiege der Republik
Am 1. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, nimmt Karl Renner von
Gloggnitz aus Kontakt mit sowjetischen Truppen auf - zur gleichen Zeit,
als ihn bereits Offiziere im Auftrag Stalins suchen. In Hochwolkersdorf
und Köttlach verhandelt man in der Folge über eine Staatsregierung. Am
27. April 1945 wird die Republik für wiedererrichtet und unabhängig
erklärt. Renner beruft sich dabei auf die Moskauer Deklaration von
1943. Ende September erkennen die Bundesländer die Regierung aus
Vertretern von Volkspartei (ÖVP), Sozialisten (SPÖ) und Kommunisten
(KPÖ) an. Sie wird nun auch von den Westalliierten bestätigt. Nach
zwölf Jahren gelten wieder demokratische Grundsätze. Bei der
Nationalratswahl am 25. November gewinnt die ÖVP überraschend die
absolute Mehrheit und stellt mit Leopold Figl den Bundeskanzler einer
Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPӦ.
Leopold Figl, Franz Anton Coufal (1927-1999)
Der Agraringenieur Leopold Figl (1902-1965) wird 1934 zum Direktor des
Niederösterreichischen Bauernbundes. Nach dem „Anschluss" verhaften die
Nationalsozialisten Figl als Funktionär des „Ständestaates" umgehend
und transportieren ihn ins KZ Dachau. Nach seiner Entlassung 1943
schließt er sich dem Widerstand an. Im April 1945 begründet Figl die
Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit; bis 1951 steht er ihr als erster
Obmann vor. In den ersten Monaten der Zweiten Republik ist Figl
Vizekanzler in der Regierung Renner, Ende 1945 wird er
zum Bundeskanzler gewählt. Seine achtjährige Kanzlerschaft und seine
anschließende Tätigkeit als Außenminister sind von Bemühungen um die
Konsolidierung der jungen Republik und ihre internationale Anerkennung
geprägt. Unter Figls Beteiligung kommt 1955 der Österreichische
Staatsvertrag zustande. 1962 wird er zum Landeshauptmann von
Niederösterreich bestellt.
Julius Raab, 1957, Gustinus Ambrosi (1893-1975)
Der in St. Pölten geborene Julius Raab (1891-1964) beginnt seine
politische Karriere 1927 als christlichsozialer Abgeordneter im
Nationalrat. Zeitgleich führt er die niederösterreichische Heimwehr an.
Vor dem „Anschluss" 1938 ist Raab kurzzeitig Handels- und
Verkehrsminister. Als Mitbegründer der Österreichischen Volkspartei und
des Österreichischen Wirtschaftsbundes 1945 ist er auch in der Zweiten
Republik als Nationalrat tätig. Von 1953 bis 1961 leitet er deren
Geschicke als Bundeskanzler. In seine Amtszeit fallen der von ihm durch
den „Raab-Kamitz-Kurs" mitverantwortete wirtschaftliche Aufstieg
Österreichs und der Abschluss der Verhandlungen zum Staatsvertrag. Er
bleibt deshalb als „Staatsvertragskanzler" in Erinnerung.

Österreichischer Staatsvertrag
Da Österreich in der Moskauer Deklaration von 1943 als erstes Opfer der
NS-Angriffspolitik bezeichnet wird, braucht es keinen Friedensvertrag.
1947 beginnen in London die Verhandlungen mit den Siegermächten über
den Staatsvertrag. Ziel ist die Wiederherstellung Österreichs. Der
Kalte Krieg und sowjetische Ablöseforderungen verzögern die
Verhandlungen. Erst nach dem Tod Stalins kommt es zur Einigung mit der
Sowjetunion im Moskauer Memorandum. Es gilt als Geburtsstunde der
österreichischen Neutralität und macht den Weg zum Staatsvertrag frei.
Dieser schreibt etwa das Anschlussverbot an Deutschland,
Minderheitenrechte sowie das Verbot der NS-Wiederbetätigung fest -
nicht aber die Mitverantwortung Österreichs am Zweiten Weltkrieg,
obgleich diese in der Moskauer Deklaration festgehalten ist. Am 15. Mai
1955 wird der Staatsvertrag im Schloss Belvedere unterzeichnet.
Delegation für die Staatsvertragsverhandlungen in Moskau, 6. April 1955
Das Bild zeigt die österreichische Delegation für die
Staatsvertragsverhandlungen einige Tage vor dem Abflug nach Moskau:
Staatssekretär Bruno Kreisky, Außenminister Leopold Figl, Vizekanzler
Adolf Schärf und Bundeskanzler Julius Raab (v. l. n. r.).
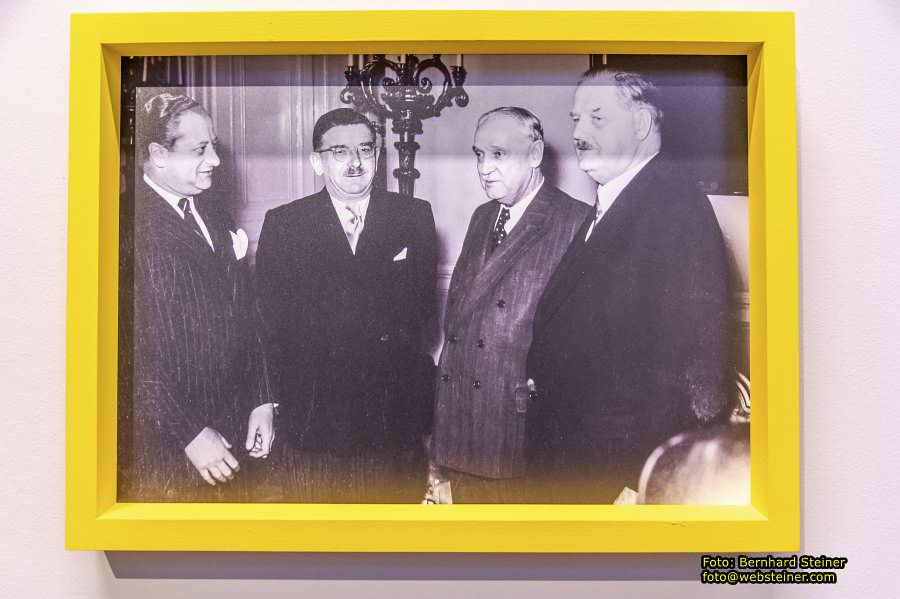
„Unterzeichnung des Staatsvertrages im Belvedere", 1956, Sergius Pauser (1896-1970)
Ein offizielles Ölgemälde soll den Moment der Unterzeichnung des
Staatsvertrages festhalten. Im Auftrag der Regierung fertigt der
Künstler Sergius Pauser vor Ort Skizzen an. Das daraus entstandene
Ölgemälde lehnt Bundeskanzler Julius Raab jedoch ab, da die Gesichter
der einzelnen Teilnehmer kaum erkennbar sind. Er beauftragt den Maler
Robert Fuchs mit einem neuen Gemälde. Das Land Niederösterreich erwirbt
später eine Fassung des Ölgemäldes von Pauser.

Replikat des Staatsvertrags
Am 15. Mai 1955 wurde der Österreichische Staatsvertrag im Schloss
Belvedere von neun Personen unterzeichnet. Sie vertraten die alliierten
Mächte USA, Frankreich und die Sowjetunion sowie die österreichische
Bundesregierung. Der Staatsvertrag, der die vollumfängliche
Wiederherstellung der Souveränität Österreichs festlegte, ist ein
elementarer Baustein der österreichischen Erinnerungskultur. Er wurde
zum Sinnbild der Befreiung und des Neuanfangs. Zahlreiche Legenden
bildeten sich mit der Zeit, so etwa die Erzählung von der
Trinkfestigkeit Leoplod Figls, die sich in der Verhandlung mit dem
sowjetischen Außenminister Molotov positiv ausgewirkt hätte, und
selbstverständlich die berühmten Worte „Österreich ist frei!“, die in
der kollektiven Erinnerung von Leopold Figl auf dem Balkon des
Belvederes ausgerufen wurden – tatsächlich wurden sie das aber nur in
einem Zusammenschnitt für das Fernsehen, denn der berühmte Satz war
schon davor im Marmorsaal ausgesprochen worden. Für die Eröffnung des
Hauses der Geschichte in St. Pölten wurde 2017 vom russischen
Außenministerium ein Replikat des im Staatsarchiv Moskau befindlichen
Staatsvertrags übergeben, das nun dauerhaft im Museum Niederösterreich
ausgestellt ist.
Vollständiges Faksimile des Österreichischen Staatsvertrags, 1955
Im April 1955 nehmen Bundeskanzler Raab, Vizekanzler Schärf,
Außenminister Figl und Staatssekretär Kreisky in Moskau an
entscheidenden Verhandlungen teil. Im „Moskauer Memorandum"
verständigen sie sich mit den sowjetischen Verhandlern auf die
„immerwährende Neutralität" Österreichs. Der Weg für den Staatsvertrag
ist frei.
Füllfeder von Außenminister Leopold Figl
Am 15. Mai 1955 unterzeichnen die Außenminister der UdSSR, der USA,
Großbritanniens und Frankreichs den Staatsvertrag in einer feierlichen
Zeremonie im Wiener Schloss Belvedere. Leopold Figl setzt als
österreichischer Außenminister seine Unterschrift mit dieser Füllfeder
und in grüner Tinte unter den Vertrag.
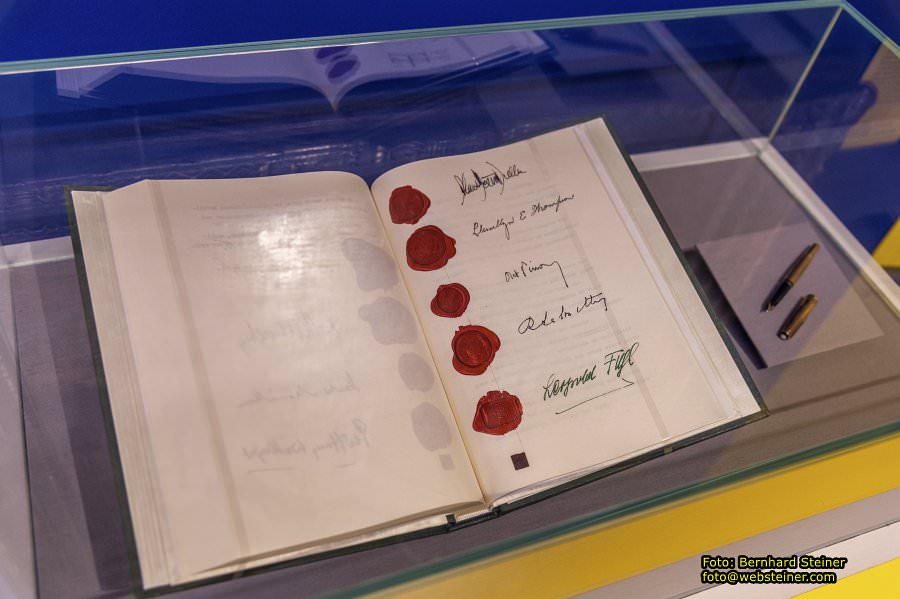
„Stanglpuch" MS 50 und Puch S 125, 1954
Die Massenmotorisierung nach 1945 wird zunächst von Zweirädern
vorangetrieben. Günstig und bei (männlichen) Jugendlichen beliebt ist
etwa die Puch MS 50, da sie ab 16 Jahren und ohne Führerschein gefahren
werden kann. Die stärkere Puch S 125 wird dafür oft mit einem Beiwagen
kombiniert und stellt fast schon ein Familienfahrzeug dar.

VOM ZIEGELTEICH ZUR GOLDGRUBE
Die österreichische Erfolgsmarke Eumig kennt heute fast niemand mehr -
dabei ist das Unternehmen bei Filmkameras und -projektoren für den
Heimgebrauch einst Weltmarktführer. Ein weithin sichtbares Vermächtnis
hat Eumig aber doch hinterlassen: seine 1974 eröffnete Firmenzentrale,
ein zehnstöckiges Hochhaus in Wiener Neudorf, nahe der Shopping City
Süd. Seinen heutigen Namen verdankt das Gebäude jedoch einem späteren
Nutzer, dem Unterwäscheriesen Palmers. Monolithisch und
wohlproportioniert ist das grünlich schillernde Hochhaus ein Blickfang
für jene, die auf der A2 vorbeirasen. Kühn und zukunftsweisend ist
nicht nur die Architektur, sondern auch die kaufmännische Entscheidung
des Wiener Unternehmens Eumig, seine Produktion vor die Tore der Stadt
zu verlegen - dorthin, wo einst Ziegelteiche waren.
Eumig-Schmalfilmkamera C3, um 1950
Die 1919 in Wien gegründete Firma Eumig übersiedelt 1956 nach Wiener
Neudorf. Bereits 1934 beginnt man mit der Erzeugung von Filmkameras.
Vom Modell C3 werden bis 1959 300.000 Stück hergestellt. Damit ist es
auch einem breiteren Publikum möglich, Erinnerungen im „Laufbild"
festzuhalten.

TV-, Radio- und Plattenspielerkombination Minerva Belvedere 589A, 1957/58
1955 beginnt in Österreich das TV-Zeitalter. Ähnlich wie das Radio 30
Jahre zuvor erobert das Fernsehen die Wohnzimmer und verändert den
Medienkonsum nachhaltig. Zwar sind die ersten Geräte noch
unerschwinglich - dieses Modell hat etwa den Preis eines Kleinwagens -,
doch rasch wird ihr Besitz zum Statussymbol.

Schneidetisch von Franz Antel, Nostalgiewelt Eggenburg
Filmregisseur Franz Antel (1913-2007) gilt als einer der
meistbeschäftigten Vertreter des österreichischen Kinos der
Nachkriegszeit. In den 1950er-Jahren feiert er mit Heimatfilmen wie
„Kaisermanöver" oder „Vier Mädels aus der Wachau" große Erfolge beim
Kinopublikum. Erst sein Spätwerk - die filmische Auseinandersetzung mit
der NS-Zeit in „Der Bockerer" - bringt ihm 1981 auch die Anerkennung
der Kritik ein.

Mit „Erinnern für die Zukunft“ kann man auf eine Zeitreise gehen.
Besuchen wir die Jahre 1945, 1955, 1995 und 2005. Jahre, die für
Niederösterreich und die hier lebenden Menschen eine große Bedeutung
hatten und haben. Blicken wir in die Vergangenheit, um die Zukunft
gestalten zu können.

Modell von Regierungsviertel und Kulturbezirk St. Pöltens
Aus einem internationalen Wettbewerb zur Gestaltung des
Regierungsviertels geht 1990 der Entwurf des österreichischen
Architekten Ernst Hoffmann als Siegerprojekt hervor. Zwei Jahre wird
geplant, fünf Jahre gebaut. 1997 übersiedelt die Landesverwaltung von
der Wiener Innenstadt in das neue Regierungsviertel. Das
Landtagsgebäude liegt direkt an der Traisen, daneben befindet sich der
Sitz der Landesregierung. Hinter dem rund 80 Meter hohen Klangturm
erstreckt sich der Kulturbezirk mit dem Festspielhaus (Architekt Klaus
Kada), dem Museum Niederösterreich (Architekt Hans Hollein), der
Landesbibliothek (Architekten Paul Katzberger und Karin Bily) und dem
Landesarchiv (Architekten Paul Katzberger und Michael Loudon). Das
Areal wird nach 1997 noch erweitert: 1998 geht etwa das
ORF-Landesstudio in Betrieb.

Hauptausstellung im Haus für Natur
Rund 40 lebende, einheimische Tierarten leben in Aquarien, Terrarien
und in Formicarien. Im 125.000 Liter fassenden großen Donaubecken
glauben manche Besucherinnen und Besucher einen Hai zu sehen, einen
Fisch mit asymmetrischer Schwanzflosse. Doch bei genauem Hinsehen ist
der „Hai“ ein Waxdick, ein Vertreter der Störe. Er ist eine von rund 40
Tierarten, die im Museum Niederösterreich gepflegt werden. Darunter
befinden sich viele gefährdete Arten. Seit 2002 besitzt das Museum die
Betriebsbewilligung als Zoo. Strenge Auflagen sind damit verbunden,
unter anderem die Anstellung ausgebildeter Tierpflegerinnen:innen
regelmäßige Tierarzt-Visiten und die Führung von Zuchtbüchern. Der
Nahrungsbedarf der gehaltenen Tiere ist übrigens beträchtlich. Jährlich
werden 150 kg Futterfische, 30.000 Heuschrecken und 50 kg Mehlwürmer
verfüttert.

SCHNEEHASE (Lepus timidus)
Die Verbreitung des Schneehasen in Österreich beschränkt sich auf die
Alpen. Hier hält er sich bevorzugt im Bereich zwischen der
geschlossenen Waldgrenze bis zur Baumgrenze auf. In der offenen
Landschaft über der Baumgrenze sind Zwergstrauchbestände, die
ausreichend Deckung bieten, wichtiger Bestandteil seines Lebensraumes.
Der Wechsel vom weißen Winterfell zum braungrauen Sommerfell erfolgt
über ein geschecktes Übergangsfell. Das sehr dichte Winterfell ist bis
auf die Ohrspitzen vollständig weiß.

ALPENMURMELTIER (Marmota marmota)
Das Alpenmurmeltier ist das zweitgrößte heimische Nagetier und in den
Alpen weit verbreitet, der heutige Bestand in den Ostalpen
Niederösterreichs geht jedoch auf die Wiederansiedelung in der Mitte
des 19. Jahrhunderts sowie die Jahre zwischen 1950 und 1980 zurück,
während die Ursprungsbestände durch Überjagung ausgelöscht wurden. Der
typische Lebensraum der Alpenmurmeltiere sind die alpinen Rasenflächen
jenseits der Baumgrenze, wo sie geeignete Futterpflanzen finden.
SOZIALVERHALTEN
Murmeltiere sind äußerst gesellig und leben in größeren
Familienverbänden, wobei meist die Nachkommen verschiedener Jahre mit
dem dominanten Paar zusammenleben. Innerhalb der Gruppe herrscht eine
strenge Rangordnung. Ein Revier ist rund 2,5 ha groß. Die Reviergrenze
wird von den dominanten Tieren, auf ihren Patrouillengängen, mit einem
Sekret aus den Wangendrüsen markiert.
WARNRUF
Nach dem Prinzip „mehr Augen sehen mehr" bietet das Zusammenleben in
der Gruppe entscheidende Vorteile. Ist eine Gefahr erst einmal
entdeckt, wird der Rest der Gruppe alarmiert, mit einem einzelnen
schrillen „Pfiff" oder einer Serie von kurzen aufeinanderfolgenden
Warnrufen. Ein einzelner Pfiff deutet auf eine unmittelbare Gefahr
(angreifender Adler) hin und löst eine sofortige Fluchtreaktion aus,
während eine Serie von Pfiffen auf eine potenzielle Bedrohung
aufmerksam macht (Wanderer, Füchse).

WIENS „HERRLICHER HINTERGRUND“
Lange Zeit haben Rehe, Hirsche, Wildschweine, Luchse und Bären den
Wienerwald für sich, wenn nicht gerade herrschaftliche Jäger ihnen das
Leben schwermachen. Als Jagdgebiet der Landesfürsten ist der Wald für
die Bevölkerung nicht zugänglich. Auch gerodet wird er nicht. Als die
Truppen des Osmanischen Reichs 1529 durch Niederösterreich ziehen und
Wien belagern, kommt es zu ersten umfangreichen Schlägerungen. Das Holz
wird als Baumaterial für Befestigungsanlagen und für den Wiederaufbau
der Stadt benötigt. Mit dem Wachstum der Stadt steigt auch der Bedarf
an Brenn- und Bauholz. Unter Kaiser Franz Joseph I. werden große Teile
des Waldes beinahe zur Abholzung freigegeben. Ein entschlossener
Mödlinger weiß das zu verhindern und rettet Wiens herrliche Umgebung.
Verunglimpfung des Wienerwald-Retters Josef Schöffel, 1873
Titelblatt der Zeitschrift Die Bombe mit Karikatur Carl von Angerers und Carl von Sturs
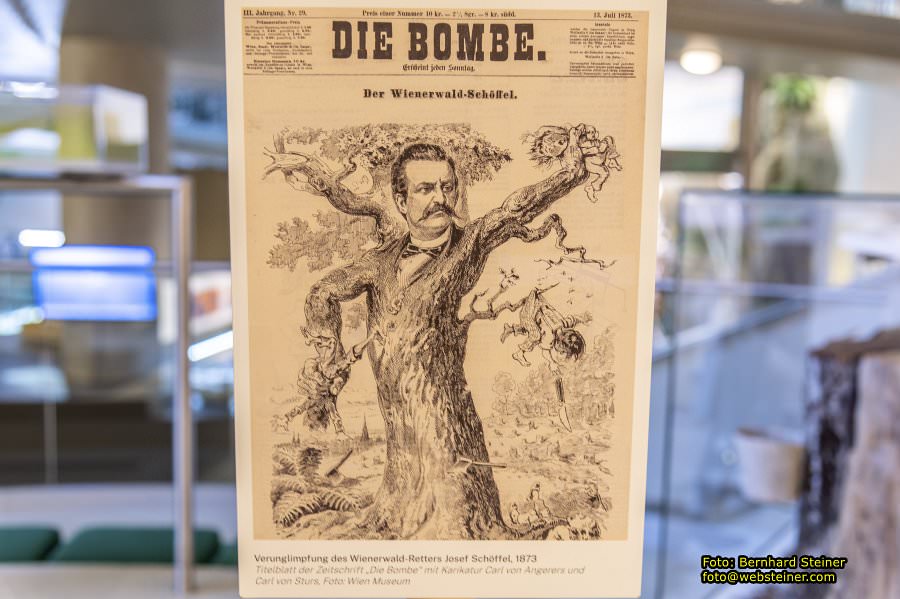
Das Haus für Natur im Museum Niederösterreich versteht sich nicht nur
als gelungene Mischung aus interaktivem Museum und lebendigem Zoo,
sondern auch als Kompetenzzentrum für Forschung und Vermittlung. Im
Zuge dieser Mission wurde das Veranstaltungsformat „Erlebte Natur“
entwickelt, das spannende Dialoge zu gesellschaftsrelevanten Themen
präsentiert. Die Versachlichung oft emotional geführter Debatten und
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse stehen dabei im Fokus.

BRAUNBÄR (Ursus arctos)
Braunbären sind sehr anpassungsfähige Säugetiere. Sie haben sich
verschiedenste Lebensräume und Kontinente auf der nördlichen
Erdhalbkugel erschlossen. Weltweit gibt es rund 20 Unterarten, die sich
in Körpergröße und Fellfarbe, vor allem aber durch ihr
Verbreitungsgebiet unterscheiden.
BÄRENSCHLAF
Während der Wintermonate finden Braunbären nicht genügend Nahrung.
Daher verbringen sie die kalte Jahreszeit in mit weichen Materialien
ausgebetteten Fels- oder Erdhöhlen. Bei dieser Winterruhe sinkt - im
Unterschied zu echten Winterschläfern - die Körpertemperatur nur
unwesentlich (um ~1°C). Sauerstoffbedarf und Atemfrequenz werden
reduziert, die Herzschlagrate fällt auf ein Viertel bis auf die Hälfte
des normalen Wertes (rund 40 Schläge pro Minute). Dieser Zustand lässt
sich mit einem tiefen Schlaf vergleichen. Wird ein Bär aber gestört,
ist er in kurzer Zeit wach.
JÄGER, SAMMLER - ALLESFRESSER
Das natürliche Nahrungsangebot im Lauf der Jahreszeiten ist sehr
unterschiedlich, doch daran haben sich die Braunbären perfekt
angepasst. Wenn sie aus ihrer Winterruhe erwachen, ist die Speisekarte
sehr karg. Um den sprichwörtlichen „Bärenhunger" zu stillen, ist
„Fallwild" neben Würmern, Insekten, kleinen und größeren Wildtieren
eine wichtige Nahrungsquelle. Im Sommer werden die Bären zu
Vegetariern, neben Gräsern und Kräutern stehen jetzt auch junge Triebe,
Wurzeln und Knollen, auf dem Speisezettel. Bis zum Spätherbst fressen
sich die Bären mit Eicheln, Nüssen, Bucheckern und verschiedensten
Früchte eine dicke Speckschicht an, von der sie während ihrer
Winterruhe zehren.
DER ÖTSCHERBÄR - EINE TRAGISCHE ERFOLGSGESCHICHTE
Im Jahr 1972 wanderte ein slowenischer männlicher Braunbär in die
nördlichen Kalkalpen ein und siedelte sich in der
steirisch-niederösterreichischen Grenzregion zwischen Ötscher und
Hochschwab an. Nach langer Zeit lebte wieder ein Bär in
Niederösterreich und wurde als „Ötscherbär" zum Hoffnungsträger. Auf
Initiative des WWF startete ein Wiederansiedelungsprojekt, zwischen
1989 und 1993 wurden drei aus Slowenien stammende Bärenweibchen
ausgewildert, bald darauf gab es den erhofften Nachwuchs. Insgesamt 31
Jungbären wurden geboren und eine kleine Population von bis zu 12
Tieren lebte dauerhaft in den nördlichen Kalkalpen. In den Folgejahren
verschwanden rund 20 Bären, einige wurden illegal abgeschossen. Im Jahr
2009 war der Bestand bis auf die zwei alten Bärenmännchen „Max" und
„Djurno" zusammengeschmolzen. 40 Jahre, nachdem der erste Braunbär
zurückgekehrt war, ist er in den nördlichen Kalkalpen erneut
ausgestorben: 2012 konnte kein einziger Bär nachgewiesen werden.

Wildschwein

Fuchs

Waschbär

Fische

Ringelnatter (Natrix natrix)
Häufigste heimische Schlangenart, die ein weites Spektrum
unterschiedlichster Lebensräume in der Nähe von Gewässern sowie die
Gewässer selbst besiedelt. Sie fehlt lediglich in ausgesprochen
trockenen Gebieten und im Hochgebirge. Das typische Erkennungsmerkmal
sind ihre beiden Halbmondflecke im Nackenbereich. Das robust gebaute
Weibchen ist markant größer als das zierlich wirkende Männchen. Bei
Bedrohung beißt die Ringelnatter nicht, sondern versucht, ihren Gegner
durch eine stark stinkende, gelbe Flüssigkeit abzuschrecken.
Hauptnahrung sind Amphibien.

Erdkröte (Bufo bufo)
Kröten sind an Land lebende Tiere, die zur Paarungszeit im März/April
für wenige Tage ihre Laichgewässer aufsuchen. Dort hängen die einzelnen
Weibchen 3.000 bis 8.000 Eier in meterlangen Schnüren an
Wasserpflanzen. Die Larven leben 2 bis 3 Monate im Wasser, bevor die
Umwandlung zur Kröte abgeschlossen ist. Im Gegensatz zu anderen
Kaulquappen werden die der Erdkröte von Fischen meist verschmäht.

SUMPFSCHILDKRÖTE (Emys orbicularis) Jungtiere Nachzucht des MUSEUM NIEDERÖSTERREICH
Die Europäische Sumpfschildkröte steht in Österreich auf der Roten
Liste gefährdeter Tiere und ist massiv vom Aussterben bedroht. Die
eigene Nachzucht des MUSEUM NIEDERÖSTERREICH stellt daher einen
wertvollen Beitrag zur Arterhaltung dar. Die Eltern dieser Jungtiere
leben im Außenbiotop des Museums.
