web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Naturhistorisches Museum Wien - NHM
Hofärar des Kaiserforums, Jänner 2023
Das Naturhistorische Museum Wien (kurz NHM) ist ein Naturmuseum am Maria-Theresien-Platz in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien. Gegründet als k. k. Naturhistorisches Museum, zählt es zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Der Neorenaissancebau wurde 1871 bis 1889 durch Franz Joseph I. von Gottfried Semper und Karl von Hasenauer als Teil des Kaiserforums errichtet.

Etwa um das Jahr 1750 kaufte Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen,
der in den habsburgischen Erblanden mitregierende Ehemann der
österreichischen Monarchin Maria Theresia, vom Florentiner Johann
Ritter von Baillou (1679–1758) die zu dieser Zeit größte Sammlung an
Naturalien. Das Herz der Sammlung bildeten 30.000 Objekte, darunter
seltene Schnecken, Korallen, Muscheln sowie kostbare Edelsteine und
seltene Mineralien. Schon damals wurde die Sammlung nach
wissenschaftlichen Kriterien geordnet.

Im Laufe der Zeit wurden die Sammlungen so umfangreich, dass die
Räumlichkeiten der Hofburg nicht mehr genug Platz boten. Im Zuge der
von Franz Joseph I. zu Weihnachten 1857 in Auftrag gegebenen Schleifung
der nicht mehr zeitgemäßen Wiener Stadtmauer und des Baues der
Ringstraße sah der mit der Verwertung der Grundstücke beauftragte
Stadterweiterungsfonds auch Platz für Neubauten für zwei Hofmuseen vor,
das naturhistorische und das kunsthistorische.

Das als k. k. Naturhistorisches Museum gegründete Haus, das die großen
kaiserlichen Sammlungen der k.k. Hof-Naturalienkabinette aufnahm, wurde
am 10. August 1889 eröffnet. Das Hofärar wurde am 12. November 1918 vom
Staat Deutschösterreich, 1919 Republik Österreich, übernommen. Das
Naturhistorische Museum, seit 1920 ein Bundesmuseum unter der Aufsicht
des Unterrichtsministeriums, nahm in den folgenden Jahrzehnten eine
unauffällige Entwicklung. Das klein gewordene republikanische
Österreich brachte nicht die Mittel auf, die Einrichtung neueren
museologischen Erkenntnissen entsprechend zu gestalten oder die
Sammlungen durch aufsehenerregende Zukäufe zu erweitern.

Der Architekt wurde von 1867 an in einem Wettbewerb ermittelt, an dem
Karl Hasenauer teilnahm; der Kaiser ließ Hasenauers Pläne von Gottfried
Semper begutachten, und Hasenauer gewann ihn zur Mitarbeit. Daraus
ergab sich eine nicht immer harmonische Gemeinschaftsarbeit der beiden
Architekten an beiden Museen. Der Bau beider Hofmuseen begann 1871,
sechs Jahre nach der feierlichen Eröffnung der Ringstraße; das
Kunsthistorische Museum wurde 1891, zwei Jahre später als das NHM,
eröffnet.

Die beiden Museumsbauten waren von ihrer Anordnung quer zur Ringstraße
darauf ausgerichtet, mit zwei an der anderen Seite der Straße
anzuschließenden neuen Trakten der Hofburg und der historischen Front
der Hofburg ein monumentales Kaiserforum einzurahmen (siehe auch
Heldenplatz), das auf Grund des Endes der Monarchie 1918 Torso blieb.
Semper und Hasenauer bauten aber von 1881 an einen der beiden geplanten
neuen Trakte der Hofburg, die sogenannte Neue Burg, zwischen
Kunsthistorischem Museum und Hofburg. Und sie bauten an einem anderen
Teil der Ringstraße 1874–1888 das neue k.k. Hof-Burgtheater.

Keine bizarren Kunstwerke ...
... sondern Bohrköpfe, mit denen viele Kilometer tief in die Erdkruste gebohrt wird
Geschenk der OMV

Die Erde - Ein dynamischer Planet - Der neue Geologiesaal
In Saal 6 - dem ehemaligen Kaisersaal - thematisiert die vom
Architekturbüro Schuberth und Schuberth designte Ausstellung den Aufbau
der Erde ebenso wie den Beginn des Anthropozäns und zeigt, dass alles
auch ganz anders hätte kommen können! Wer mit Geologie nur langweilige
Steine verbindet, wird in der neuen, mit vielen Hands-on-Objekten
ausgestatteten Ausstellung am NHM Wien überrascht sein, wie umfassend
die Erdwissenschaften heute versuchen, die Prozesse unseres Planeten zu
entschlüsseln. Längst sind die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen
Disziplinen verwischt und von den Gesteinen führt der Weg rasch in
Atmosphäre und Hydrosphäre oder in die Welt der Mikroben.
Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Bezüge zwischen der
Lithosphäre und der Biosphäre. Der Bogen spannt sich dabei vom Aufbau
der Erde bis zum Anthropozän - dem Zeitalter, in dem der Mensch begann,
als geologische Kraft aufzutreten. Während man spielerisch an einer
interaktiven Station Gebirge entstehen lässt, erfährt man, dass erst
die Plattentektonik durch ihre Jahrmillionen dauernden Kreisläufe bis
heute Leben ermöglicht. Überraschend ist, dass auch die großen
Revolutionen des Lebens - wie die Erfindung der Fotosynthese und die
Besiedlung des Festlandes durch Pflanzen einen unmittelbaren Einfluss
auf die Gesteine hatten und das Antlitz der Erde für immer veränderten.
Das Leben färbte den Planeten bunt!

Die vermeintlich größte Spinne der Welt ist ein Seeskorpion
Mit einer Gesamtgröße von ca. 50 cm galt Megarachne servinei als die
größte bekannte Spinne. Neue Funde und Untersuchungen haben allerdings
ergeben, dass Megarachne zu den heute ausgestorbenen See- oder
Riesenskorpionen zählt. Gelebt hat das schreckenerregende Tier im
Karbon, vor 320 Millionen Jahren. Die tropischen Sumpfwälder im
heutigen Argentinien waren sein Lebensraum. Die meisten Insekten und
Spinnentiere besitzen keine Lungen, sondern nehmen Sauerstoff direkt
über ein kompliziertes Röhrensystem (Tracheen) auf. Dadurch hängt ihre
Größe vom Sauerstoffgehalt der Luft ab. Im Karbon lag der
Luftsauerstoffgehalt deutlich über dem heutigen Wert und ermöglichte
den Riesenwuchs. Derartige Größen wurden später nie wieder erreicht.
Megarachne servinei, Modell in Lebensgröße

Steinbruch von St. Margarethen in Ungarn, Leithakalk (Anton Hlawacek):
Der Steinbruch in St. Margarethen (zwischen Eisenstadt und
Neusiedlersee) ist der bekannteste Steinbruch des Burgenlandes, das bis
zum Ende des 1. Weltkrieges zu Ungarn gehörte. In diesem ausgedehnten
Steinbruch haben schon die Römer in großem Ausmaß abgebaut. Der St.
Margarethener Kalksandstein wird heute hauptsächlich für
Restaurierungen (z. B. der Stephanskirche), als Dekorstein für
vorgehängte Fassaden und als Formstein von der Steinmetzbranche
verwendet.
Steinbruch... St. Margarethen. Ungarn.
Leithakalk. Ant. Hlaváček.

Faszination Natur
Das Naturhistorische Museum Wien zählt zu den größten naturkundlichen
Museen der Welt. 37 Schausäle auf zwei Etagen vermitteln einen
unvergesslichen Eindruck von der Geschichte der Erde und der Vielfalt
des Lebens: Das Hochparterre präsentiert kostbare Edelsteine und
Mineralien, seltene Fossilien und riesige Dinosaurier, die größte und
älteste Meteoritenschausammlung der Welt, aber auch einzigartige
urgeschichtliche Funde wie die weltberühmte „Venus von Willendorf". Der
erste Stock zeigt den überwältigenden Artenreichtum der Tierwelt von
einfachen Meerestieren bis zu hoch entwickelten Säugern.
Die Sammlung hinter den Kulissen bildet mit ca. 30 Millionen Objekten
die Basis für die Forschungsarbeit von über 60 Wissenschaftlerinnen,
die derzeit im Museum tätig sind. Der neue Aktionsraum „Deck 50" ist
mit einem Forschungslabor und einer 11 m langen LED-Wand ausgestattet
und bietet Shows und Workshops. Erleben Sie Wissenschaft in einem
modernen Ambiente, unterhaltsam und interaktiv!

Im Sauriersaal befinden sich drei Skelettrekonstruktionen großer
Dinosaurier: Allosaurus, Diplodocus und Iguanodon. Nebst diesen sind
noch weitere, kleinere Objekte, wie die Knochen- und
Lebendrekonstruktion eines Tyrannosaurus-Schädels zu besichtigen. Zudem
sind ein Lebendmodell eines Deinonychus in Originalgröße, mehrere
Skelette kleinerer Dinosaurier wie Psittacosaurus oder Protoceratops
sowie Skelettteile (beispielsweise ein Triceratops-Schädel und ein
Ultrasaurus-Bein) ausgestellt. Am 5. Oktober 2011 wurde der neu
gestaltete Sauriersaal eröffnet. Die Ausstellung wurde dabei um weitere
Skelette, lebensgroße Modelle und Computeranimationen ergänzt, z. B.
veranschaulicht das animierte Modell eines Allosaurus dessen
Bewegungsabläufe, die lebensecht rekonstruiert wurden. An der Decke
schwebt ein originalgroßes Pteranodon-Modell. Videoanimationen und
interaktive Stationen vermitteln das Leben der Dinosaurier, es wird
aber auch jener Asteroideneinschlag visualisiert, der letztlich zum
abrupten Ende der Dinosaurier führte.



PRUNKWAGEN Rekonstruktion, Býči Skála, Tschechien; Ältere Eisenzeit, 5. Jh. v. Chr.
In der Kulthöhle von Býči Skála bei Brünn wurden die Reste von
mindestens 3 Wagen entdeckt. Die Wagenkästen und die Radspeichen waren
mit verzierten Bronzeblechen beschlagen; eiserne Reifen umspannten die
Holzräder; ab 15 km/h entsteht der Eindruck von laufenden Spiralen an
den Speiche. Manche Wagenteile wurden in Stoff gehüllt niedergelegt.
Die Textilien auf dem Wagenkasten wurden nach Vorbildern aus dem
Fürstengrabes von Hochdorf (Deutschland) gewebt.
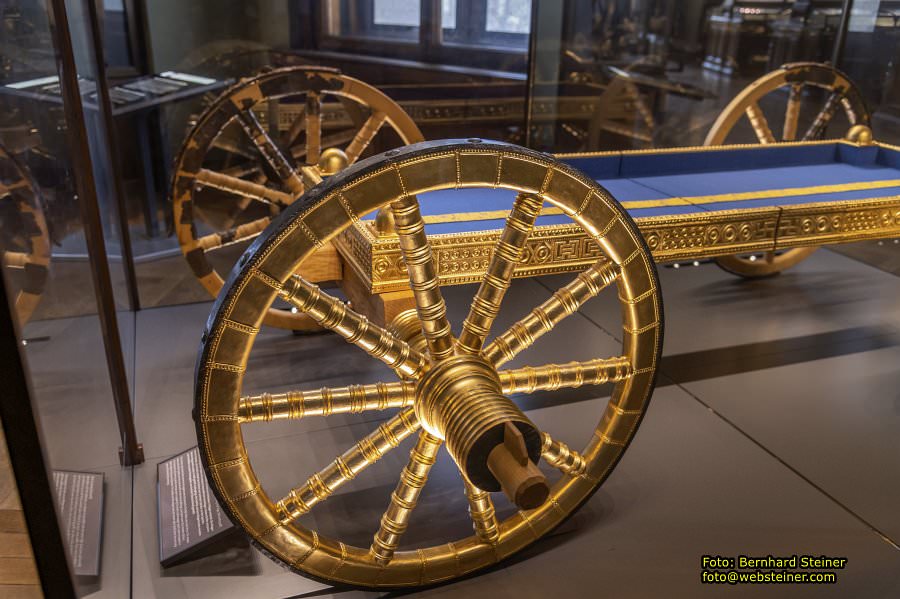
Die Anthropologie-Dauerausstellung wurde nach der Schließung des
früheren „Rassensaales“ 1996 von Grund auf neu konzipiert und im Jänner
2013 eröffnet. Sie widmet sich der Evolution der Hominiden und dem
Entstehungsprozess des Menschen. In den Sälen 14 und 15 stehen dabei
zwei Themenbereiche im Zentrum: der aufrechte Gang und die
Gehirnevolution. Ausgehend von den nächsten lebenden Verwandten, den
Menschenaffen, wird mit mehreren paläoanthropologische Themenblöcken
die Entwicklung des modernen, an unterschiedliche Naturräume
adaptierten Menschen Homo sapiens bis zur Jungsteinzeit dargestellt.
Dabei wird die Entwicklung nicht nur als (prä-)historischer und
biologischer Prozess aufgezeigt, sondern auch die kulturelle
Entwicklung als wesentliche Komponente der Menschwerdung hervorgehoben.

Karyatidenschmuck
Die Ecksäle des Hochparterres (IV, VI, XIV und XVI) und der Mittelsaal
(X) sind zusätzlich mit Karyatiden geschmückt. Die architektonische
Gliederung der Frieszone mit Skulpturen wurde offenbar durch Hasenauer
festgelegt. Dies belegt ein von Hasenauer signierter Plan des Saals X
aus der Burghauptmannschaft. Leider ist die Datierung aufgrund des
schlechten Erhaltungszustandes des Planes nicht mehr lesbar. In diesem
Plan sind die Karyatiden und auch das reiche Stuckdekor der Frieszone
bereits mit großer Detailgenauigkeit eingezeichnet.
Cliffhaus Ruine, Nordamerika (Ludwig Hans Fischer):
Das Bild zeigt Reste von Terrassensiedlungen, den sogenannten Cliff
Dwellings (Felsenhäuser), der Pueblo-Indianer in Arizona und New
Mexico. Die aus luftgetrockneten Ziegeln unter überhängenden Felsen
eingebauten Häuser und Kivas (Kulträume) waren aus Sicherheitsgründen
oft nur durch das Dach zu betreten. Das Bild war 1886 noch nicht fertig.

Statue aus Stein, Osterinsel, Südsee (Ludwig Hans Fischer):
Die vulkanische Osterinsel liegt ungefähr dreieinhalbtausend Kilometer
westlich von der südamerikanischen Küste und wurde erst 1722 von dem
niederländischen Kapitän Jakob Roggeveen entdeckt. Auf ihr stehen über
1.000, drei bis zwölf Meter hohe, aus dem Vulkangestein des Kraters
Rano Raraku gehauene Figuren, so genannte Moai, die wahrscheinlich
Ahnen darstellen sollten. Die meisten wurden etwa zwischen 1000 bis
1600 nach Chr. errichtet. Im Vordergrund des Bildes steht ein
Osterinsulaner als Maßstab für die Größenverhältnisse. Dieses Gemälde
war 1886 noch nicht fertig gestellt.
Karyatide von Viktor Tilgner und Gemälde von Ludwig Hans Fischer: Statue aus Stein, Osterinsel, Südsee, Saal XIV

Righistan-Moschee zu Samarkand, Turkestan (Alois Schönn):
Die Righistan-Moschee wurde wahrscheinlich um das Jahr 1618 von Galang
Tasch Bahadur, einem Vesir des Imam Kuli Chan, erbaut. Die Fassade des
prachtvollen Gebäudes ist mit kostbaren Mosaiken verziert. Unter dem
hohen Gewölbe befindet sich das persische Wappen, Löwe und Sonne, nach
dem die Moschee auch „Schirdar", „die Löwen tragende", benannt ist. Im
Jahr 1886 war dieses Bild noch nicht fertig gestellt.



Der Goldschmuck mit einem Gesamtgewicht von mehr als einem halben
Kilogramm (506 g) wurde im Mai 2005 auf dem Arikogel, einem kleinen
Hügel am Hallstätter See (OÖ), entdeckt. Der Fundort liegt an einer
alten Wegtrasse, die entlang der Traun zum Salzbergwerk nach Hallstatt
führte. Die Goldringe aus Perldraht sind die ältesten in Mitteleuropa,
die in dieser aufwendigen Technik gefertigt wurden. Erste
Metallanalysen zeigen, dass das Gold aus Osteuropa, wahrscheinlich aus
Siebenbürgen (Rumänien), kommt.
Arikogel Oberösterreich Späte Bronzezeit, 1200-1000 v. Chr.


„DER KREISLAUF DES LEBENS" DECKENGEMÄLDE VON HANS CANON
Das Werden und Vergehen der menschlicher Existenz wird in einer
kreisförmigen Komposition dargestellt. Auf der rechten Seite streben
kraftvolle Gestalten aufwärts: Sie jagen nach Liebe, Reichtum, Ruhm und
Macht. Links unterliegen die Menschen dem Schicksal und stürzen unter
zuckenden Blitzen in den Abgrund. Der Kampf ums Dasein beherrschte im
19. Jahrhundert das wissenschaftliche Denken. Am Beginn des Kreislaufs
macht sich der Mensch die Erde untertan. Am Ende gewinnt jedoch die
Natur wieder die Oberhand: ein Aasgeier wartet auf seine Beute. Im
Zentrum des Geschehens ruht ein Philosoph mit Stundenglas. Hinter ihm
bewacht eine Sphinx ein versiegeltes Buch als Symbol für das ewige
Rätsel des Lebens.

HANS CANON 1829-1885, Wien
Hans Canon studierte ab 1845 an der Wiener Akademie der Bildenden
Künste und war Schüler von Ferdinand Georg Waldmüller und Carl Heinrich
Rahl. Wegen seiner Karikaturen in der Zeitschrift „Kikeriki" bekam er
Probleme mit der Zensur und ging nach Deutschland. Um 1850 übersiedelte
Canon wieder nach Wien. Das Deckengemälde der „Kreislauf des Lebens"
gilt als sein Hauptwerk. Es wurde zusammen mit den Lünettenbildern
zwischen 1883 und 1885 auf Leinwand gemalt. Die Themen der Lünetten
waren vorgegeben, das Thema des Deckengemäldes konnte Canon selbst
wählen. Nach dem Tod Hans Makarts arbeitete Hans Canon außerdem am
großen Deckengemälde „Sieg des Lichts über die Finsternis" für das
Kunsthistorische Museum weiter. Auch er konnte dieses Bild jedoch nicht
mehr vollenden und hinterließ nur Skizzen und Entwürfe. Canon starb
kurz nach der Vollendung von „Der Kreislauf des Lebens" 1885. Er
erlebte nicht mehr mit, wie es im Stiegenhaus angebracht wurde.


Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen kaufte 1748 die damals größte
Naturaliensammlung der Welt von Johann Ritter von Baillou. Sie umfasste
etwa 30.000 Objekte. Im Gegensatz zu vielen anderen
Naturaliensammlungen diente sie nicht nur der Schaulust, sondern war
nach dem damaligen Kenntnisstand wissenschaftlich geordnet. Der Kaiser
brachte die Sammlung aus Florenz nach Wien und ließ sie im
Augustinertrakt der Hofburg aufstellen. 1848 wurde dieser Trakt durch
einen Brand schwer beschädigt. Seit 1889 sind die Sammlungen des
Kaisers hier im Naturhistorischen Museum zu besichtigen. Das Kaiserbild
wurde im Auftrag Maria Theresias, der Gemahlin Franz Stephans vom
Porträtmaler Franz Messmer und von Jakob Kohl angefertigt. Obwohl es
erst 1773, acht Jahre nach Franz Stephans Tod entstand, gilt es als
seine beste Darstellung.
KAISER FRANZ I STEPHAN VON LOTHRINGEN in seiner Sammlung, umgeben von seinen Sammlungsdirektoren
JOHANN RITTER VON BAILLOU in blauer Artillerie-Stabsuniform Erster Direktor der Naturaliensammlung
VALENTIN DUVAL, Direktor des kaiserlichen Münzkabinetts
ABBÉ JOHANN MARCY im geistlichen Gewand Direktor des Physikalisch-Mathematischen Kabinetts
GERARD VAN SWIETEN, Präfekt der Hofbibliothek und Leibarzt Maria Theresias



Japanische Riesenkrabbe, Macrocheira kaempferi (Temminck, 1836) auch Rieserseespinne
SO-Japan und Taiwan, leben auf sandig-schlammigen Meeresböden in 50 bis
600 m Tiefe. Mit einer Spannweite bis 4 Meter, einer Beinlänge über 1,5
Meter und einem Gewicht bis 20 Kilogramm sind die japanischen
Riesenkrabben die größten Krebstiere der Welt. Die Tiere sind
Allesfresser; sie ernähren sich von Meerestieren, Algen, Tangen und
Aas. Der Intendant des Hofmuseums, Franz Steindachner erwarb 1882 diese
außergewöhnlich großen Exemplare, die aus der Bucht von Tokio stammen.


Schwarzgelber Blauzungenskink (Tiliqua nigrolutea), Australien

Komodo-Waran (Varanus komodoensis)
Mit einem Körpergewicht bis zu 70 kg und einer Körperlänge von bis zu 3
m ist der Komodo-Waran die größte lebende Echsenart. Sein
Verbreitungsgebiet ist auf wenige kleine Sundainseln vor Indonesien
beschränkt. Die Jungtiere leben auf Bäumen und fressen Insekten und
kleinen Echsen. Erwachsene Komodo-Warane erbeuten Nagetiere, Vögel und
sogar Mähnenhirsche oder Wasserbüffel, die viel größer sind als sie
selbst. Die Beutetiere werden durch einen Giftbiss getötet. In
Abwesenheit von Männchen (z. B. in Zoos) können sich Weibchen durch
Jungfernzeugung fortpflanzen, d. h. ohne befruchtet zu werden.

RIESENSEEADLER (Haliaeetus pelagicus), Küsten Nordostasiens

ARARAUNA (Ara ararauna), Südamerika

INKAKAKADU (Cacatua leadbeateri), Australien


EURASISCHER BIBER (Castor fiber)
Ursprünglich waren Biber in der Waldzone Europas und Asiens mit
Ausnahme Japans weit verbreitet. Biber wurden als Fleisch- und
Pelzlieferanten, am meisten jedoch wegen des „Bibergeils" verfolgt.
Dieses Drüsensekret wird in den Aftersäcken gebildet und dient den
Tieren zur Fellpflege. Schon die Römer verwendeten es als
Wunderheilmittel und Aphrodisiakum. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab
es nur mehr 8 kleine Restvorkommen des Eurasischen Bibers mit insgesamt
etwa 1200 Individuen. Wiedereinbürgerungen führten zu einem glanzvollen
Comeback. Die Population stieg auf mehr als eine halbe Million Tiere
an, große Teile des ehemaligen Verbreitungsgebietes sind heute wieder
besiedelt. Biber sind monogam. Sie leben in kleinen Familiengruppen in
Flussauen, an Seen und Teichen. Sie paaren sich im Winter, die 2-3
Jungen kommen im späten Frühling zur Welt. Biber halten keinen
Winterschlaf. In strengen Wintern fressen sie unter der Eisdecke die im
Sommer gesammelten Nahrungsvorräte. Biber können gut schwimmen und
tauchen. Ihre gedrungene Gestalt, das überaus dichte Fell, der flache,
beschuppte Schwanz und die durch Schwimmhäute verbundenen Zehen sind
Anpassungen an das Leben im Wasser. Mit 80 cm Körperlänge, 40 cm
Schwanzlänge und einem Gewicht von bis zu 35 kg ist der Biber das
größte Nagetier Europas.
Biber sind Vegetarier. Im Frühling und Sommer bevorzugen Biber weiche
Pflanzenteile, im Herbst und Winter fressen sie Rinde, Zweige und
Wurzeln von Laubbäumen. Da Biber nicht klettern können, fällen sie
Bäume, um an die Zweige zu kommen. Dazu benutzen sie ihre riesigen,
ständig nachwachsenden Nagezähne als Werkzeug. Mit Hilfe der
meißelförmigen Schneide benagen Biber die Stämme sanduhrförmig und
fällen so selbst Bäume von mehr als einem Meter Durchmesser. Ein
einzelner Biber kann eine 25 cm starke Weide in weniger als einer
halben Stunde zu Fall bringen. Die Nahrung wird entweder an Ort und
Stelle verzehrt oder als Wintervorrat in den Gewässerboden gesteckt.
Biber bauen Kanäle, Dämme und Burgen. Mit ihren Vorderpfoten graben
Biber Rinnen in den Gewässerboden. Die so entstandenen Kanäle benutzen
sie bei Niederwasser. Flüsse werden mit Dämmen abgesperrt. Als
Baumaterial verwenden Biber gefällte Bäume, die sie in Stücke zerteilt
zuerst ins Wasser schleppen und dann weiter zur Baustelle
transportieren. Der Sockel der überaus stabilen Dämme besteht aus
Schlamm und Steinen, auf die Äste und Zweige gehäuft werden. Schlamm
und weiches Pflanzenmaterial dichten den Damm ab. Hinter einem Damm
entstehen manchmal große Seen, in denen Biber vor Feinden sicher sind
und wo sie Holz leichter transportieren können als an Land. Die
Stauseen dienen auch als Kühlschrank, in dem sich der Nahrungsvorrat
für den Winter lange frisch hält. Biberburgen sind von Wasser und Land
zugänglich und enthalten zumindest eine, oberhalb des Wassers gelegene,
Wohnkammer.







LÖWE (Panthera leo)
Die Merkmale des in Freiheit um 1920 ausgerotteten Berberlöwen,
namentlich die mächtig entwickelte Mähne, die bis zum Bauch hinab
reicht, überdauerten im Erbgut von Zoo- und Menagerielöwen bis heute.

SCHNEELEOPARD (Panthera uncia), Zentralasien


STATUETTE VON STRATZING
Die Figur aus Schiefer ist das älteste Kunstobjekt Österreichs. Sie ist
36000 Jahre alt und damit auch weltweit eine der ältesten
Menschen-Skulpturen. Entdeckt wurde die Statuette 1988 in
Niederösterreich auf einem Lösshang nahe der Donau bei Krems, im Rahmen
von Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes. Einen Arm emporgestreckt, den
Oberkörper leicht gedreht, scheint die Figur wie in einer Pirouette
erstarrt. Das Grabungsteam hat sie deshalb nach der berühmten
österreichischen Tänzerin Fanny Elßler „Fanny" genannt.

VENUS VON WILLENDORF, Gravettien, 29.500 Jahre
Die Figur aus Kalkstein ist 29500 Jahre alt und ein vollendetes
Meisterwerk altsteinzeitlicher Plastik. Sie wurde am 7. August 1908 bei
Ausgrabungen des Naturhistorischen Hofmuseums in Willendorf in der
Welterbe-Region Wachau (Niederösterreich) entdeckt und zählt zu den
berühmtesten archäologischen Funden der Welt. Die halbsitzende Haltung,
die verkürzten Arme und Beine sowie der Kopf ohne Gesicht sind Teil
einer Botschaft, die wir heute nicht mehr rekonstruieren können.
Statuetten vom Typ der Venus von Willendorf waren von Frankreich bis
Russland verbreitet. Die russischen Funde sind der Venus von Willendorf
am ähnlichsten; sie stellen ebenfalls reife Frauen mit großem Bauch und
großen Brüsten dar. Die halbsitzende Haltung der Venus von Willendorf
findet sich wieder bei den Figuren von Gagarino, einer russischen
Fundstelle am Don. Ihr Armschmuck entspricht dem der Figuren aus
Kostenki. Die Haltung ihrer Arme ist dieselbe wie bei der Venus von
Lespugue (Frankreich). Ähnliche Frauen mit stark übertriebenen
Proportionen sind als regionale Besonderheiten auch aus Italien und
Südfrankreich bekannt. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie keine
Gesichtszüge aufweisen. Es ist daher anzunehmen, dass die
Gesichtslosigkeit mit einer ganz bestimmten Aussage verknüpft war, die
zu dieser Zeit überregional verstanden wurde. Aus der Zeit der Venus
sind aber sehr wohl auch Frauendarstellungen mit Gesichtern bekannt:
Köpfe aus Frankreich, Italien und Tschechien sowie bekleidete Figuren
mit Gesichtern aus Sibirien.


Das Museumsgebäude erstreckt sich zwischen Zweierlinie bzw.
Museumsplatz und Burgring; die Rückseite grenzt an die Bellariastraße.
Die Vorderseite im Südosten wendet sich dem symmetrischen Park und dem
gegengleichen Kunsthistorischen Museum zu. Das Gebäude ist 170 m lang
und im Mittelteil 70 m breit und umschließt zwei rechteckige Höfe von
etwa 50 m Länge und 25 m Breite und bedeckt eine Fläche von etwa 8720
m². Es ist in vier Geschoße, Tief-, Hochparterre, I. und II. Stock
unterteilt.

Die Attika des vorspringenden Mittelrisalit ist 32 m hoch und wird von
einer 33 m hohen achteckigen Kuppel überragt, auf deren Laterne eine
über 5 m hohe bronzene Statue des griechischen Sonnengottes Helios
steht, Symbol des allbelebenden Elementes in der Natur. Diese Figur,
wie auch die gegenüberliegende Pallas Athene auf der Kuppel des
Kunsthistorischen Museums, wurde von Johannes Benk geschaffen.

Maria-Theresien-Denkmal (zwischen Kunsthistorischem und
Naturhistorischem Museum), das imposanteste Werk der neueren
plastischen Kunst in Wien. Caspar von Zumbusch arbeitete 13 Jahre an
diesem Werk (Modell 1874, Vollendung 1887, enthüllt am 13. Mai 1888,
dem Geburtstag der Herrscherin); verbaute Fläche 632 m², Höhe 19,4
Meter. Die Architektur stammt von Carl von Hasenauer; alles Figurale
ist aus Bronze. Auf einem Plateau (von Pfeilern mit Ketten umrahmt)
befindet sich ein dreistufiges Podest, auf diesem ein vierseitiger
Kolossalsockel. Der weitausgreifende Unterbau trägt einen hohen
prismatischen Aufbau mit gekoppelten Säulen an den Kanten, darüber die
Sitzfigur Maria Theresias (auf Thronsessel). Das Programm entwarf der
damalige Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Alfred von Arneth;
Zumbusch verzichtete weitgehend auf die Allegorisierung zugunsten eines
historischen Realismus (weshalb sein Projekt den Konkurrenzentwürfen
von Johannes Benk und Carl Kundmann vorgezogen wurde).
Maria Theresia thront hoch über den Stützen ihres Reichs; ihre Linke
mit dem Zepter ruht auf der Pragmatischen Sanktion, die Rechte ist zum
Gruß an ihr Volk erhoben, auf dem Haupt trägt sie statt einer der
denkbaren Kronen ein großes Diadem. Auf dem Kranzgesims vier
allegorische Figuren (die Kardinaltugenden Kraft, Weisheit,
Gerechtigkeit, Milde), auf den Flügeln des Unterbaus vier
Reiterstandbilder ihrer Feldherren (von rechts vorne im Uhrzeigersinn
Gideon Ernst Freiherr von Loudon [1716-1790], Leopold Graf Daun
[1705-1766], Ludwig Andreas Graf Khevenhüller [1683-1744] und Otto
Ferdinand Graf Abensberg-Traun [1677-1748]), vor dem mittleren Aufbau
frei stehende Figuren ihrer Berater (Wenzel Anton Dominik Graf Kaunitz
[1711-1794], Staatskanzler; Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz
[1702-1765], Schöpfer der Verwaltungsreform; Joseph Wenzel Fürst
Liechtenstein [1696-1772], Reorganisator des Geschützwesens; Leibarzt
Gerard van Swieten [1700-1772], Reformator der Universität). In den
Bogenfeldern 16 Hochreliefs verdienter Persönlichkeiten: Bartenstein,
Starhemberg, Marcy, Lacy, Hadik, Nádasdy, Eckhel, Prayberg, Christoph
Willibald Gluck, Haydn, Mozart, Grassalkovics, Brückenthal, Rieppen,
Martini und Sonnenfels.
Maria-Theresien-Denkmal am Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
