web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Orth
museumORTH an der Donau, Mai 2023
Vom Leben an der Donau und der Geschichte von Schloss
Orth erzählen historische Fotografien, Exponate und Installationen auf
einer Fläche von 700 m2 in der ehemaligen Wasserburg. Vorgestellt
werden auch die Alltagskultur der Vergangenheit und Orther
Persönlichkeiten wie der Komponist Karl Schiske.
Im Herzen des Nationalpark Donau-Auen liegt Schloss Orth an der Donau.
Im 2. Stock des Schlosses, wo vor 50 Jahren noch Getreide gelagert
wurde, befindet sich seit 2007 das museumORTH. Auf einer Fläche von 700
m² stellt es die Geschichte von Orth an der Donau und seiner Umgebung
auf eindrucksvolle Weise dar: mit künstlerischen Mitteln werden die
regionalen Wurzeln und kulturellen Relikte neu definiert.

Schloss Orth an der Donau - Baujuwel der Renaissance
Das 16. Jahrhundert war zweifellos die bedeutendste Epoche in der
Geschichte des Schlosses. Das Bundesdenkmalamt reiht es unter die
wichtigsten Baudenkmäler der Renaissance in Österreich ein.
Die Ursprünge der Burg Orth an der Donau bleiben trotz intensiver
Untersuchungen weiterhin ungeklärt. Beim heutigen Kenntnisstand lässt
sich lediglich festhalten, dass ein ‚locus orta‘, also ein Ort namens
Orth, im frühen 11. Jahrhundert laut Schenkungsurkunde von Heinrich II.
bereits 1021 bestanden haben muss. Sehr wahrscheinlich war Orth im
Hochmittelalter ab ca. 1050 im Besitz des Bistums Regensburg, welches
die Grafen von Schaunberg mit der Herrschaft belehnte. Sie ließen wohl
im späten 13. Jahrhundert den Nordostturm und den östlichen Teil des
Nordtrakts errichten. Bis Mitte des 14. Jahrhunderts entstand der
Nordwestturm mit drei Obergeschoßen. 1377 musste Heinrich von
Schaunberg Burg und Markt Orth an den Habsburger Herzog Leopold III.
abtreten.
1520 übergaben die Habsburger dem Feldherrn Niklas I. Graf Salm die
Herrschaft als Lehen. Die Grafen Salm, die zu den mächtigsten
Gefolgsleuten des Kaisers zählten, setzten umfangreiche Maßnahmen:
Neuerrichtung des Westtrakts, Wendeltreppenturm in der Nordwestecke,
Aufstockung des Nordtrakts. Dabei kamen neue, für Österreich geradezu
revolutionäre Architekturformen, wie etwa die rundbogigen
Biforienfenster an der Ostfassade des Westtrakts zum Einsatz, ein um
1525 hierzulande noch eher unbekanntes Stilelement. Während sich Niklas
I. Graf Salm 1529 in der Ersten Türkenbelagerung Wiens verdient machte,
brannten die Osmanen Schloss Orth nieder. Sein Sohn Niklas II. Graf
Salm sanierte es – mit baulichen Innovationen, wie einem liegenden
Sparrendach, Gewölbekonsolen und Biforienfenstern aus Terrakotta. Die
Verwendung des Akanthusblatt-Motivs weist die Adeligen als Parteigänger
Kaiser Ferdinand I. aus. Niklas II. Graf Salm verlieh dem Schloss um
1534 die charakteristische Form eines geschlossenen viertürmigen
Kastells, nach dem Vorbild der Wiener Hofburg. Wie in dieser
konstruierte der mährische Architekt Johann Tscherte eine
zukunftsweisende Hohlspindeltreppe. (20 Jahre vor Andrea Palladio in
Italien). Als das evangelische Geschlecht der Zinzendorf das Schloss
1568 kaufte, ließ es die Schlosskapelle adaptieren. Sie erhielt ein
Holzportal, das heute ein Highlight des Museums darstellt: aus der Zeit
um 1580 stammend, wird das Portal dem Hoftischler Georg Haas
zugeschrieben. Er schuf ein ähnliches Stück für die evangelische
Kapelle im niederösterreichischen Landhaus, das die selbe Inschrift
aufweist: Friede dem Freund, der diese unsere Schwelle erklimmet …
Im 17. Jahrhundert setzte der Niedergang ein: im Jahr 1686 musste
Kaiser Leopold I. die Herrschaft an Graf Theodor Heinrich von
Strattmann verkaufen, unter dessen Nachkommen, der Familie
Confalonieri-Strattmann, die Herrschaft Orth in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geriet. Während man andere Burgen zu barocken
Schlössern mit repräsentativen Gärten umgestaltete, versank Orth zum
Wirtschaftsgebäude. Im 18. Jahrhundert wurden die Fenster verkleinert,
die Wehrmauer abgerissen und das Schloss zum Getreidespeicher umgebaut.
Nach mehrfachem Besitzerwechsel, u. a. der Bankier Moritz Graf Fries
und Caroline Murat, die jüngste Schwester von Napoleon Bonaparte,
kaufte es Kaiser Franz I. 1824 und verleibte es dem k .k. Familienfonds
ein – Teile dienten als Kanzleien und Gefängnis.
Seit dem Ende der Habsburgermonarchie befindet sich das Schloss im
Besitz der Republik Österreich. Diese ermöglichte 1981 sowie 2004/2005
und 2021/2022 die Revitalisierung. Schloss Orth an der Donau beherbergt
seit 2005 das schlossORTH Nationalpark-Zentrum, das
Veranstaltungszentrum der Marktgemeinde und seit 2007 das museumORTH.
Die Impulse für die Restaurierung des 1957 bis 2002 als Museumsstandort
genutzten Schlosses, kamen von einem wissenschaftlichen Projekt aus
Archäologie, Bauforschung, Geschichte und Kunstgeschichte, das 17 Jahre
in Anspruch nahm.

Der Hausen (Huso huso) ist der mächtigste Vertreter der Donaustöre er kann bis zu neun Meter lang werden.
Einst zog er vom Schwarzen Meer zum Laichen weit stromaufwärts bis in
unsere Breiten, heute verhindern die Staustufen an der Donau seine
Wanderung. Initiativen wie das Netzwerk der Donauschutzgebiete
DANUBEPARKS bemühen sich, dem urtümlichen Riesen das Überleben zu
sichern. Dieses Monument wurde in Rumänien gefertigt, ein weiteres
Exemplar befindet sich in Tulcea, dem Tor zum Donau-Delta.

Renaissance-Wendeltreppe
Die Restaurierung der Prunktreppe, der Empore mit zwei Steinportalen
und dem anschließenden Turmzimmer im nordwestlichen Teil des Orther
Schlosses macht diese für Besucher*innen zugänglich und bedeutet die
Wiederentdeckung des Stellenwertes von Schloss Orth. Es wurde laut
Bauforschung während der Zeit der Familie von Niklas Graf Salm
(Besitzer ab 1520) als "Zwilling" der Hofburg in Wien konzipiert. Auch
Handwerker und Architekten waren parallel beschäftigt: Die
Hohlspindeltreppe samt Stiegenhaus über drei Geschoße wurde um 1550 vom
Hofarchitekten Johann Tscherte in Anlehnung an den 1542 in der Wiener
Hofburg errichteten Prototypen gebaut. Sie ist eine der aus vier
baugleichen Treppen bestehenden Gruppe. Die Tatsache, dass das Wiener
Pendant im 18. Jahrhundert abgetragen wurde und daher nicht mehr
existiert, die tschechische Treppe halb eingestürzt ist, und die Treppe
in Venedig nach der Zerstörung 1630 (durch einen Brand) im 19.
Jahrhundert wieder aufgebaut wurde, beweist umso mehr die Bedeutung der
„Schwester" auf Schloss Orth.

Mittelalterliche Blocktreppe aus 1334
Die Treppe besteht aus Eichenhölzern, die spätestens im Jahr 1334
gefällt wurden und bis zu 151 Jahresringe aufweisen. Ein Trägerpfosten
konnte auf das Fälljahr 1258 datiert werden und zeigt 119 Jahresringe.
Die handgebeilte Treppe hat 11 Blockstufen, die auf 2 Trägerpfosten
aufliegen. Sie ist 1,90 m breit, 3,90 m lang und wiegt knapp 1,5 t. Die
Blockstufen sind vorne gerundet und wurden über den schräg verlaufenden
Trägerpfosten mit der Axt schräg ausgenommen, um satt aufzuliegen.
Fixiert wurden sie mit Eichenholzdübel. Die Orther Blocktreppe ist
knapp 700 Jahre alt und stammt aus der Zeit des Grafen Konrad von
Schaunberg.
Die Schaunberger (Lehensträger des Bistums Regensburg) treten ab 1272
in den Schriftquellen zu Orth auf. Als östlicher Außenposten der
Schaunberger Besitztümer, war die Burg von entsprechender Bedeutung, da
Konrad von Schaunberg hier mehrfach Urkunden ausstellen ließ. In den
Jahren 1319 und 1352 setzte er zu Orth sein Testament auf und starb am
26. Mai 1353. In die Zeit des Konrad von Schaunberg fällt die zweite
große Ausbauphase der Burg Orth. Den nach einem Brand zerstörten
Südostturm ließ er im späten 13. Jahrhundert wiederaufbauen und den
Nordostturm sowie den östlichen Teil des Nordtrakts errichten. Um 1334
wurde der Nordwestturm mit drei Obergeschoßen zunächst freistehend
erbaut und der Nordostturm aufgestockt. Der Nordtrakt war zwischen den
beiden Türmen noch nicht vollständig vorhanden. Der ursprüngliche
Standort der Blocktreppe ist ungewiss - der Gewölberaum des jetzigen
„Schützenkellers" im westlichen Teil des Nordtrakts war zu seiner
Bauzeit im 15. Jahrhundert noch kein Kellerraum - erst in der nächsten
Bauphase erhöhte man das Bodenniveau um 1,50 m. Die Treppe wurde
vermutlich erst im 17. Jahrhundert in den Kellerraum verlegt. Sie käme
als Verbindung im bauzeitlich passenden Nordwestturm in Frage, oder sie
stammte von einem abgekommenen Gebäude.

Nationalpark Donau-Auen und das südliche Marchfeld
Der Nationalpark Donau-Auen erstreckt sich von der Wiener Lobau bis zur
österreichisch-slowakischen Grenze. Er liegt in einer historisch
bedeutsamen Kulturlandschaft und ist Teil der March-Donau-Region. Auf
seiner Fläche von rd. 9.600 ha findet sich ein Mosaik an besonderen
Lebensräumen, welche die frei fließende Donau geschaffen hat. Darauf
basiert die hohe Vielfalt an Arten. Im Jahr 1996 wurde der Nationalpark
gegründet. Vieles wurde seither erreicht und umgesetzt.
Revitalisierungsprojekte haben Seitengewässer wieder an die Donau
angebunden und natürliche Ufer entstehen lassen. Die Auwälder wurden
außer Nutzung gestellt und entwickeln sich zur artenreichen
Waldwildnis. Gemäß dem Motto „Freier Fluss. Wilder Wald" kommt der
ursprüngliche Naturcharakter in diese Aulandschaft zurück.
Die Donau-Auen grenzen im Norden an das Marchfeld: Als „Kornkammer",
„Gemüsegarten" und „Energielandschaft" bezeichnet, haben der
gesellschaftlichen Wandel und die Bedürfnisse der Menschen dazu
geführt, dass sich das Bild des ehemaligen Schwemmlandes der Donau
verändert hat. Gleich dem Fluss, an dem es liegt, ist die Entwicklung
des ländlichen Naturraumes vom Verständnis und dem Kreislaufdenken
seiner Bewohnerinnen und Bewohner abhängig.

Von der Aubesetzung zum Nationalpark Donau-Auen
1984 drohte mit dem geplanten Bau des Kraftwerkes Hainburg die
Zerstörung dieses Donauabschnitts mit seiner Aulandschaft. Aufrufe
aller Natur- und Umweltschutzvereinigungen bewirkten landesweite
Proteste. Als die Betreiber des Kraftwerksprojektes den Bau beginnen
wollten, kam es zu einer gewaltlosen Besetzung der Auwälder bei
Stopfenreuth durch tausende Menschen aller Alters- und Berufsgruppen
(„Hainburger Aubesetzung"). Nach mehreren erfolglosen Räumversuchen
wurde im Dezember 1984 von der Bundesregierung eine Nachdenkpause
verordnet.
Umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen wurden angestellt und
führten dazu, dass die Donau-Auen in und östlich von Wien als
nationalparkwürdig anerkannt wurden. Ein Kraftwerk wäre mit einem
Nationalpark nicht vereinbar. 1989/90 erfolgte die Sicherung der
Regelsbrunner Au durch die WWF-Aktion „Natur freikaufen". 1991 bis 1995
lief die Nationalparkplanung durch die Betriebsgesellschaft
Marchfeldkanal. Am 27. Oktober 1996 wurde zwischen der Republik
Österreich und den Bundesländern Wien und Niederösterreich ein
Staatsvertrag zur Errichtung und Erhaltung des Nationalpark Donau-Auen
von Umweltminister Martin Bartenstein, Bürgermeister Michael Häupl und
Landeshauptmann Erwin Pröll unterzeichnet. Der Nationalpark Donau-Auen
war damit offiziell gegründet.

Intensive Landnutzung und Naturschutz
Die Devise nach dem 2. Weltkrieg und anschließender Besatzung lautete
Wiederaufbau. Dadurch wurden für die damalige Zeit innovative
Infrastrukturprojekte geschaffen: Wasserkraftwerke, Wasserbau,
Flurbereinigungen, intensivierte Landwirtschaft - sie alle hatten
maßgeblichen Einfluss auf die Naturlandschaft. Durch „Verbesserung und
Intensivierung der Bodenbewirtschaftung", „Gebrauch von Handelsdünger",
„Aufklärende Tätigkeit durch landwirtschaftliche Schulen" und Betrieb
von „Lagerhäusern" wurden die Erträge gesteigert. Doch die Tier- und
Pflanzenarten schwanden.
In den 1960er Jahren war die künstliche Bewässerung mit Hilfe von
Feldbrunnen und Traktoren, die Pumpen betrieben, eine Besonderheit!
Verbunden mit Landflucht und veränderten Betriebsverhältnissen ging die
Mechanisierung einher. Eine Veränderung der Landschaft wurde
wahrgenommen. Aufgrund von Lebensraumzerstörung brachen z.B. die
Bestände von Greifvögeln Mitte der 1970er Jahre zusammen. Durch die
Nutzungsintensivierung entstanden neue Probleme, wie z.B. Nitrat im
Brunnen, Artensterben und Überproduktion an Lebensmitteln. Der Schutz
der Umwelt wurde in den 1980er Jahren zum Thema. Im Agrarbereich
stellten „Ökowertflächen" eine „Erste Hilfe" für die überstrapazierte
Kulturlandschaft dar. Maßnahmen gegen Bejagung und Fallenfang sowie für
den Erhalt von Lebensräumen wurden ergriffen, die bis heute andauern.

Kronprinz Rudolf und Schloss Orth
Kronprinz Rudolf, Sissis einziger Sohn, war ein begeisterter
Tierbeobachter. Ab 1870 verfasste Rudolf seitenweise ornithologische
Abhandlungen, beispielsweise über Mäusebussard und Dorfschwalbe. Seine
erhaltenen Tierzeichnungen sind bemerkenswert. Mit knapp 20 Jahren
publizierte er in „Brehm's Thierleben". Der Hang zur Wissenschaft
gipfelte in der Gründung des „Comitè für Ornithologische
Beobachtungsstationen in Österreich-Ungarn" und der Herausgabe des
„Kronprinzenwerkes", einem ethnographischen Werk über die
Donaumonarchie.
Die Donau-Auen lagen ihm am Herzen! In seinem Testament aus dem Jahr
1887 schrieb er seine Jagd- und Luxushunde sowie Geldbeträge dem
hiesigen Jagdpersonal zu. Schloss Orth war nicht nur Jagdausgangspunkt,
sondern auch Rückzugsort. Hier verweilte er einige Male mit Verwandten
und Freunden zur Unterhaltung. Die Förderung der damals populären
musikalischen Ensembles, wie etwa der „Schrammeln", und Rudolfs
Freundschaft zu dem „Entertainer" und Fiaker Josef Bratfisch vermitteln
uns heute das Bild eines intellektuellen und unkonventionellen Geistes,
gebunden in festen Strukturen. Von großer Bedeutung sind seine
Beobachtungen bis heute, bilden sie doch die Grundlage für
wissenschaftliche Vergleiche und Forschung. Natur und Kultur sind noch
immer zentrale Elemente in Schloss Orth an der Donau.

Ein Portal aus der Renaissance-Zeit steht mitten im Raum. Vor über 450
Jahren wurde es gebaut. Es hat Brände und Kriege überdauert. Es ist in
einem Österreich weit einmaligen Originalzustand erhalten. Restauriert
und neu aufgestellt – als ein Tor in die Vergangenheit.
Historische Fotos stehen im Mittelpunkt – denn – „ein Bild sagt mehr
als tausend Worte“. In überdimensionalen „Fotoalben“ werden Themen wie
die Schloss- und Siedlungsgeschichte, das Leben mit dem Fluss, die
Fischerei, die Nutzung der Au-Gebiete und der landwirtschaftliche
Alltag anschaulich gezeigt. Berühmten Orther Persönlichkeiten wie dem
Komponisten Karl Schiske oder der Schauspielerin Annie Rosar kann man
nachspüren. Ebenso werden Einblicke in die Bienenzucht der
Vergangenheit gegeben.

Im Herzen des Nationalpark Donau-Auen liegt Schloss Orth an der Donau.
Das Besucherzentrum des Nationalparks Donau-Auen hat seit Juni 2005
seinen Sitz im revitalisierten Schloss Orth. Im zweiten Stock des
Schlosses, wo vor rund 50 Jahren noch Getreide gelagert wurde, ist
heute auf einer Fläche von 700 m2 die Geschichte von Orth an der Donau
und seiner Umgebung auf eindrucksvolle Weise im museumORTH dargestellt.
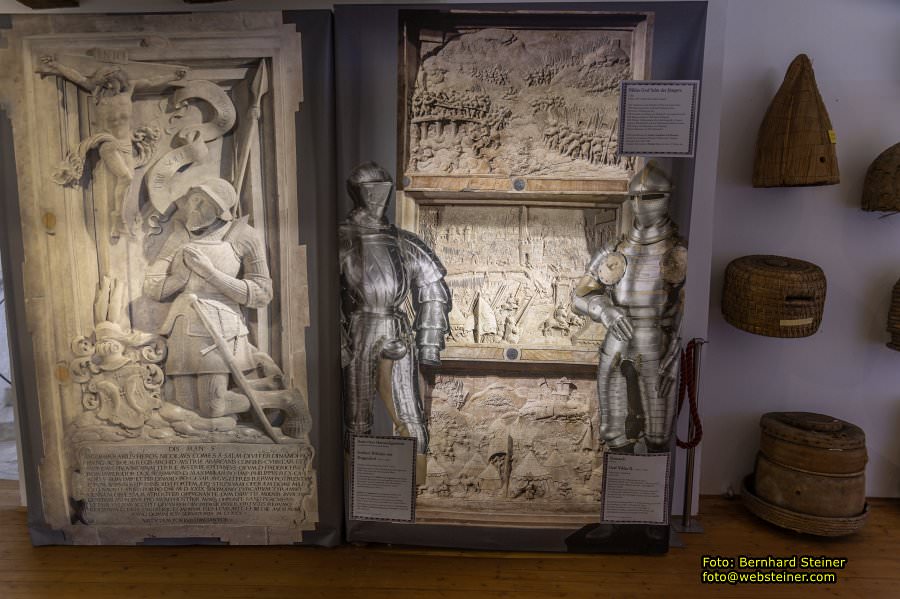
Schloss Orth an der Donau geht auf eine mittelalterliche Wasserburg
zurück und war im 16. Jahrhundert glanzvoller Sitz der Familie von Graf
Niklas zu Salm, siegreicher Verteidiger von Wien bei der ersten
Türkenbelagerung im Jahr 1529. Sensationelle Funde aus 2004 - Überreste
der renaissance-zeitlichen Bauausstattung aus Stein und Terrakotta -
bilden die Basis einer spannenden Entdeckungsreise in die fast
vergessene Blütezeit des Schlosses und können erstmals vor Ort
besichtigt werden. Die Ausstellung stellt die Ergebnisse der
archäologischen Untersuchungen des Bundesdenkmalamtes vor und
vermittelt einen Eindruck vom komplexen Ablauf der wissenschaftlichen
Aufarbeitung.


Karl Schiske (*12. Februar 1916 – †16. Juni 1969) war ein Wegbereiter
der Neuen Musik in Österreich. Geboren in Raab/Ungarn (heute Györ),
verbrachte er einen Großteil seines Lebens in Orth an der Donau, wo der
Großvater Carl Schiske Oberförster war. Er beschäftigte sich neben der
Zwölftonmusik der Wiener Schule u.a. auch mit der Vokalmusik des
Mittelalters und der Renaissance. Zum Komponieren, begab sich Karl
Schiske regelmäßig in die Berge und in die Orther Donauauen. Er ist
Teil der österreichischen Musikgeschichte nach 1945 und erhielt 1967
den Großen Österreichischen Staatspreis. Ab 1952 war er einer der
prägendsten Lehrer an der Wiener Musikakademie – die “Schiske-Klasse”
(u.a. Ivan Eröd, Gösta Neuwirth, Kurt Schwertsik, Erich Urbanner und
Otto M. Zykan) ist legendär. Am 12. Februar 2016 wäre Karl Schiske 100
Jahre alt geworden.

KARL SCHISKE (1916-1969) zählt zu den Schlüsselfiguren der
österreichischen Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sein insgesamt
51 Werke umfassendes kompositorisches Schaffen kann in mehrfacher
Hinsicht als repräsentativ angesehen werden. Nicht nur umfasst es ein
breites Spektrum an Gattungen - vom Lied über die Klavier- und
Kammermusik in diversen Besetzungen bis hin zum Oratorium und zur
Sinfonie. Vielmehr spiegelt es in seltener Breite die kompositorischen
Tendenzen des Jahrhunderts wieder. Schiske, der über seinen Lehrer
Ernst Kanitz noch der Wiener Schreker-Schule angehört, schließt in
seinen bis in die 1940er Jahre entstandenen Werken zunächst an die (im
weitesten Sinn) neoklassizistische Orientierung dieser Zeit an. Seine
eigentliche Bedeutung beruht freilich darauf, dass er nach 1945 wie
kein anderer österreichischer Komponist seiner Generation die
internationale Produktion verfolgt und geradezu systematisch die
Entwicklungsschritte der zeitgenössischen Musik in seinem Schaffen
verarbeitet hat: Dodekaphonie und Wiener Schule (z. B. in der 3. und 4.
Sinfonie), die Frage der Rhythmusorganisation bzw. den Serialismus
(zuletzt im Divertimento op. 49), Aleatorik und offene Form (Synthese
op. 47), schließlich sogar noch die mikropolyphone Klangflächentechnik
(in der 5. Sinfonie). Dabei hat Schiske aber stets eine eigene
Physiognomie gewahrt, die sich u.a. in einem - niemals
„konservatorischen", sondern auf Erneuerung zielenden -Traditionsbezug
und in einem musikalischen Denken manifestiert, das auf Verbindung und
Integration gerichtet ist (und von ihm selbst auf den schillernden
Begriff „Synthese" gebracht wurde).
Die Vermittlung der aktuellen Tendenzen des zeitgenössischen
Komponierens und die Diskusion, die Raum für individuelle Entfaltung
bot, prägte auch die Lehrtätigkeit Schiskes. 1952 an die Wiener
Musikakademie berufen, und dort ein Vertreter des Fortschritts, hat
Schiske eine bedeutende Schule begründet. So waren alle wichtigeren
österreichischen Komponisten der Folgegeneration entweder Angehörige
seiner Klasse oder standen mit ihm zumindest in Verbindung. Hinzu kamen
„institutionelle" Initiativen, am bekanntesten wohl Schiskes
unermüdlicher Einsatz, um österreichischen Interessenten die Teilnahme
an der Darmstädter Ferienkursen zu ermöglichen, aber auch seine
Bemühungen, die zur Gründung eines Studios für elektronische Musik an
der Wiener Musikakademie führten. Zwar ist Schiskes Musik heute nur
mehr verhältnismäßig selten zu hören (eine der wenigen Ausnahmen war
der ihm gewidmete Schwerpunkt beim Festival „wien modern" 1994), doch
hat Schiske prägenden Einfluss auf die jüngere österreichische
Kompositionsgeschichte ausgeübt.
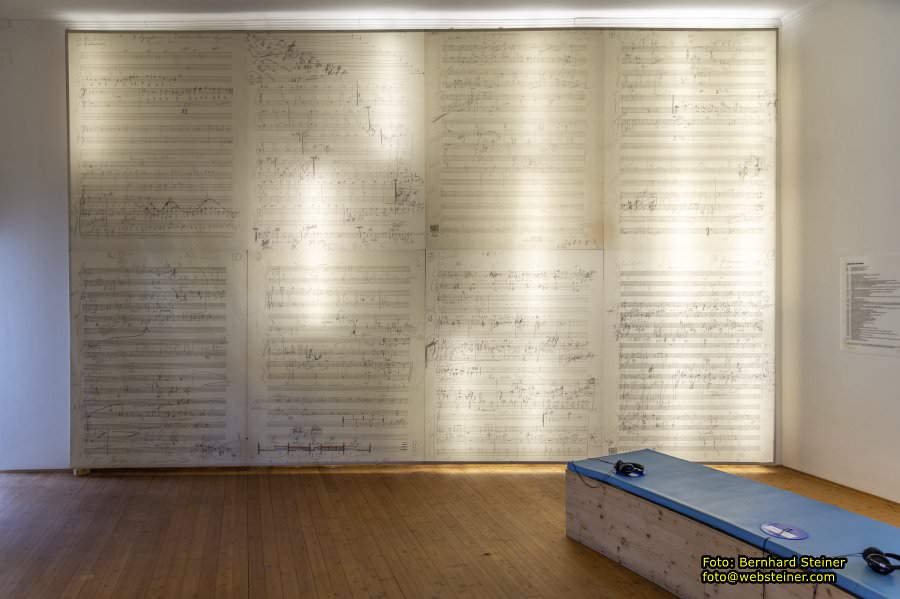
Der Nationalpark Donau-Auen - Das grüne Band zwischen Wien und Bratislava
Mitten in einer dynamischen Zentralregion gelegen, verbindet der
Nationalpark Donau-Auen zwei europäische Hauptstädte. Er umfasst auf
einer Fläche von 9.300 Hektar die Donau mit ihren Inseln, begleitenden
Wäldern, Wiesen und Au-Gewässern. Im Staatsvertrag zur Gründung des
Nationalparks im Jahr 1996 ist eine Erweiterung auf die gesamten
Au-Gebiete zwischen Wien und Bratislava vorgesehen.
Ein Mosaik vielfältiger Möglichkeiten
Im Schutz des Nationalparks kann sich die größte zusammenhängende,
naturnahe Au-Landschaft in Mitteleuropa dauerhaft erhalten und
weiterentwickeln. Hier trifft der dynamische Gebirgsfluss Donau, mit
maximalen Wasserstandsschwankungen von sieben Metern, auf das flache
Land der pannonischen Tiefebene. Der abwechslungsreiche Lebensraum
bringt eine ganz besondere Artenvielfalt hervor: mehr als 800 Arten
höherer Pflanzen; mehr als 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten, rund
60 Fischarten; tausende Insekten- und Pilzarten, Mikroorganismen und
Algen.


schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Der Nationalpark Donau-Auen in Österreich bewahrt Fläche die letzte
große Flussauenlandschaft Mitteleuropas. Neue Sichtweisen und
umfassende Information zu diesem Naturjuwel bietet das schlossORTH
Nationalpark-Zentrum als erste Anlaufstelle für Nationalparkgäste. Als
„Tor zur Au“ öffnet es uns die Welt des Nationalparks. Der Besuch
beinhaltet die Besichtigung der Nationalparklounge, des Turnierhofs und
Aussichtsturms mit wechselnden Sonderausstellungen. Erkunden Sie
weiters unser Auerlebnisgelände Schlossinsel, wo Europäische
Sumpfschildkröten, Schlangen, Ziesel und Fische aus nächster Nähe
beobachtet werden können. Ohne Führung.

Einst waren Ziesel (Spermophilus citellus) in großer Zahl im
Nationalpark-Umland vertreten. Sie sind typische Steppen- und
Weidenbewohner. Heute gibt es aufgrund der langen Verfolgung als
vermeintliche Saatschädlinge sowie durch den großflächigen
Lebensraumverlust nur mehr vereinzelte Kolonien, die vom Aussterben
bedroht sind. Ziesel wohnen in Erdbauten, sie ernähren sich von Samen,
Wurzeln und Früchten. Die kleinen Nagetiere halten Winterschlaf.
Typisch ist das „Männchen machen” zum Sichern, sowie das schrille
Pfeifen bei Gefahr. Im Gehege lebt eine kleine Ziesel-Kolonie, wir
hoffen ab Frühsommer auf zahlreiche Jungtiere! Diese sind beim Spielen
vor ihren Bauten gut zu beobachten. Die Zwergschafe dienen als
Rasenpfleger, damit die Ziesel sich wohl fühlen.

Im schlossORTH Nationalpark-Zentrum besteht mit dem Au-Erlebnisgelände
Schlossinsel ein gestalteter Freibereich, der Lebensräume, Tiere und
Pflanzen der Aulandschaft auf einem Rundgang vorstellt. Eine begehbare
Unterwasserstation bietet als Highlight Einblicke in ein von
zahlreichen Lebewesen bevölkertes Gewässer.


EUROPÄISCHE SUMPFSCHILDKRÖTE - EINZIGE HEIMISCHE SCHILDKRÖTENART
Die gelb gepunktete Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis ist
die einzige einheimische Schildkrötenart Österreichs. Einst war sie in
Bächen, Flüssen und Feuchtgebieten Mitteleuropas weit verbreitet, heute
ist sie selten geworden. Im Nationalpark Donau-Auen wird sie durch ein
Artenschutzprogramm gefördert.
Die Europäische Sumpfschildkröte ist am dunklen Panzer und gelben
Punkten zu erkennen. Zwischen den Zehen befinden sich Schwimmhäute als
Anpassung an das Leben im Wasser. Männchen zeigen bis zu 15 Zentimeter
Panzerlänge und eine orangerote Iris, Weibchen 18 Zentimeter und gelbe
Augen. Die Lebenserwartung liegt bei 60 Jahren. Als Nahrung dienen
Würmer, Wasserschnecken und -insekten, Amphibien, Fische und Laich.
LEBENSWEISE
Die wechselwarmen Reptilien halten ihren Stoffwechsel durch Wärme von
außen aufrecht. Daher sieht man sie beim Sonnenbad auf Baumstämmen oder
Böschungen. Die kalte Zeit überdauern sie in Winterstarre am Grund
tieferer Gewässer. Zur Eiablage wandern die Weibchen im Frühjahr zu
besonnten, sandigen Flächen mit spärlichem Bewuchs. In eine 10
Zentimeter tiefe Grube vergraben sie maximal 15 zirka 2,5 Zentimeter
große Eier. Im Spätsommer schlüpfen die Jungen, so groß wie eine
Zweieuromünze.
SCHUTZMASSNAHMEN
Umfassende Lebensraumzerstörung und Freisetzung exotischer Schildkröten
aus Heimhaltung gefährden heutzutage die Vorkommen der Europäischen
Sumpfschildkröte. In den Donau-Auen östlich von Wien lebt die letzte
intakte Population Österreichs. Doch auch hier sind gute Eiablageplätze
rar. Deshalb betreibt der Nationalpark Donau-Auen mit dem Tiergarten
Schönbrunn ein Artenschutzprogramm. Dabei ist die Sicherung der Nester
gegen Plünderung durch Fressfeinde wie Marder und Füchse von Bedeutung.

Es lohnt sich auch, den Nationalpark eigenständig zu erkunden. Ein
Wegenetz durchzieht das Gelände – es besteht Großteils aus
Rundwanderrouten, verknüpft durch den Weitwanderweg 07. Einige Wege
sind auch für RadfahrerInnen vorgesehen. Mehrere Gewässer sind zum
Baden bzw. zum Befahren mit nicht motorisierten Booten freigegeben. Die
Ufer der Donau sind in Zonen unterteilt welche regeln, wo mit Booten
angelegt werden darf.

Orth wurde 1021 erstmals erwähnt. Die ehemalige Wasserburg wurde in der
Babenbergerzeit errichtet. 1529 wurde Schloss Orth im Zuge der Ersten
Türkenbelagerung zerstört und von Niklas Graf Salm II. im
Renaissance-Stil wieder aufgebaut. Im 17. Jh. wurde es für Hofjagden
genutzt. 1824 kauften die Habsburger das Schloss vom Grafen Moritz von
Fries und leibten es dem Privat- und Familienfonds ein. Kronprinz
Rudolf benutzte es ab 1873 als Jagdschloss. 1918 kam es in den Besitz
der Republik Österreich. Schloss Orth weist bauliche Ähnlichkeiten mit
dem ältesten Teil der Wiener Hofburg, dem Schweizertrakt, auf. Es wurde
2005 renoviert und beherbergt das Nationalpark-Zentrum des
Nationalparks Donau-Auen und das museumORTH sowie das
Veranstaltungszentrum, beide von der Marktgemeinde Orth betrieben.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: