web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
5-Elemente-Museum
im Schloss Rothschild in Waidhofen/Ybbs, Mai 2023
Hier erwartet Sie Stadtgeschichte, auf die etwas
andere Art aufbereitet. Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall sind die
Themenbereiche, die Sie durch das Museum begleiten. Ältere Semester
bekommen eine Verjüngungskur, indem sie ihre Erinnerungen an die
Kindheit in der Mostviertler Spielzeugwelt auffrischen.
Das Schloss Rothschild oder Schloss Waidhofen liegt in der Stadt Waidhofen an der Ybbs im südwestlichen Niederösterreich.
Bergfried mit Glaskubus - Erbaut Ende des 14. Jahrhunderts, Erweiterung mit Glaskubus 2006.

Die 5 Elemente der Eisenwurzen
Es gehört zum menschlichen Denken, die Welt aus ihren
Grundbestandteilen heraus zu erklären. Diese antiken Lehren haben sich
sowohl im Abendland als auch im Orient und in Asien entwickelt. Sie
ordnen alle Erscheinungsformen des Lebens den fünf Elementen zu: Erde,
Feuer, Holz, Metall und Wasser. Das Zusammenspiel dieser 5 Elemente
prägt seit Jahrhunderten das Leben der Menschen im westlichen
Niederösterreich und dem Wirtschaftsraum der Eisenwurzen. Das Eisen des
Erzberges wurde in den Schmelzöfen und Schmiedewerkstätten des
Voralpenlandes verarbeitet, wobei das Wasser die Hämmer antrieb. Aus
den Wäldern kam die Holzkohle für die Schmiedefeuer. Die fruchtbare
Erde des Voralpenlandes lieferte Proviant für die Bergleute und der
rege Handel mit diesen Gütern machte Waidhofen an der Ybbs zur
wohlhabenden Stadt. Eine Industrielandschaft wurde geschaffen, die der
Region eine Fülle an Schätzen hinterlassen hat.

Erde ist das Element, das die
Grundlage einer Stadt bildet. Erde liefert Baustoffe, lässt den Wald
wachsen und bietet Nahrung. Waidhofen war das Zentrum des
Provianthandels und sicherte sich in seinem Drei-Meilen-Bezirk die
Herrschaft und den Zugriff auf die Produkte des Umlands. Die Stadt war
wohlhabend durch den Handel. Mit gehobener Lebenskultur und der
prächtigen Architektur ihrer Häuser demonstrierten die Bewohner ihr
Selbstbewusstsein. Auch nach dem Ende des Provianthandels sind die
bäuerlichen Betriebe und der Wochenmarkt eine wichtige Basis des
städtischen Lebens.
Modell der historischen Stadt
Das vom ehemaligen Stadtarchivar Friedrich Richter und seinen Schülern
gebaute Modell der Stadt Waidhofen zeigt die mittelalterliche Stadt um
1500. Einhundert Jahre früher wurde sie von ihrem Grundherrn, dem
Freisinger Bischof Berthold von Wehingen mit starken Mauern und
Wehrtürmen befestigt. Besonders die sensible Schwarzbachfront im Süden
wurde mit einer Doppelmauer geschützt. Die Dreiecksform der Innenstadt
mit ihren abgewinkelten Stadtausfahrten prägt noch heute das Bau- und
Verkehrsgeschehen Waidhofens. Von den Türmen sind nur noch einige
Wenige vorhanden, da sie im 19. Jahrhundert der Modernisierung der
Stadt weichen mussten.

Die Waidhofner
Die Lage der Stadt Waidhofen an der Ybbs und die Eisenverarbeitung in
ihren Gewerbebetrieben ermöglichten es den Bewohnern schon früh zu
Wohlstand zu gelangen. Zum Stand der Bürger gehörten auch die
Gebildeten, Ärzte, Advokaten und Amtsträger. In diesen Gruppen
entwickelte sich eine eigene „bürgerliche" Kultur. Fleiß und
Sparsamkeit statt Verschwendung und die langfristige Planung des
wirtschaftlichen Handelns ermöglichten jenen Wohlstand, den man dann
auch gerne zeigte. Die prächtigen Trachten und die Goldhauben der
Frauen sind ein Inbegriff dieses Bürgerstolzes. Wie man heute noch am
Stadtbild erkennen kann, waren die Bürger auch offen für neue Einflüsse
in der Architektur, oder gegenüber neuen religiösen und geistigen
Ideen. Die unteren Schichten, die sich aus Handwerksgesellen, Knechten,
Armen oder sogar Kriminellen zusammensetzten, werden, wie in vielen
anderen Städten kaum dokumentiert. Dennoch zeigt die Existenz eines
Bürgerspitals und eines Siechenhauses, dass es bedürftige Einwohner in
großer Anzahl gab. Heute ist Waidhofen eine Stadt der vielen
Möglichkeiten. Menschen, die durch eigene Entscheidung oder Vertreibung
und Flucht in unsere Stadt kommen, erweitern diese Möglichkeiten, indem
sie ihre Geschichte und Kultur mitbringen und mit uns teilen. Die
Bürger in der Stadt sowie die Bewohner der Dörfer auf den Anhöhen leben
diese Identität aus städtischer Weltoffenheit und bodenständiger Kultur
und genießen die hohe Lebensqualität Waidhofens.
Die so genannte Linzer Goldhaube
ist ein prunkvolles Accessoire der weiblichen Festtagstracht im Süden
Deutschlands und im nördlichen Österreich. Der Ursprung liegt im Krems-
und Steyrtal. Ab dem 18. Jahrhundert trugen sowohl die Ehefrauen der
Sensengewerken als auch reiche Städterinnen sie als Statussymbol, das
in der Familie vererbt wurde. Im Rahmen der wieder belebten
Trachtenkultur wird heute das Herstellen einer Goldhaube wieder in
Kursen gelehrt. Etwa 500 Arbeitsstunden muss man für die filigrane
Handarbeit rechnen, ist dann aber Besitzerin einer besonderen
Kostbarkeit. Die Frauen des Goldhaubenverein Waidhofen tragen ihre
Goldhauben bei kirchlichen Festtagen.

Eisen ist das Namen gebende Produkt der Eisenwurzen. Über Jahrhunderte
war die Eisenwurzen Europas wichtigste Eisen produzierende und
verarbeitende Region und Waidhofen einer der Hauptorte. Messer, Sensen
und Kleineisenwaren wurden hier gefertigt und vertrieben. Auch im
Zinngießerhandwerk war Waidhofen weit im Umkreis berühmt. Metall
ist auch das Symbol der Herrschaft. Die Rechtsprechung mit Eisen und
Schwert, der Schwertarm als Marktzeichen und die metallenen Waffen
waren die Symbole der Stadt, ihrer Wehrhaftigkeit und ihrer
Selbstverwaltung.

Die Zunftzeichen befanden sich
ursprünglich in den Gasthäusern der Stadt und markierten die
Räumlichkeiten, in denen die Versammlungen der verschiedensten
Handwerkszünfte stattfanden. Ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens
der Handwerkszünfte spielte sich in diesen Gasthäusern ab, und der Wirt
als Herbergsvater hatte auch eine bedeutende soziale Funktion. So
fanden zum Beispiel die Feierlichkeiten des Aufdingens [Aufnahme eines
Lehrjungen in das Handwerk], des Freisprechens, sowie die Ernennung zum
Meister im Rahmen der jeweiligen Handwerksversammlungen in den
Gasthäusern statt.

Schlosserzunft
Das Schlosserhandwerk ist einer der vielfältigsten metallverarbeitenden
Berufe. Früher waren die Schlosser für alle Arten von Beschlägen und
Türschlössern, aber auch Gittern zuständig. Dabei verband sich die
wichtige Funktion eines Schlosses zunehmend mit dem Wunsch nach
künstlerischer Ausgestaltung. Auch die Büchsenmacher gehörten zur
Schlosserzunft, wobei mehrere Schlosserzünfte verschiedener Gemeinden
nur einen Büchsenmacher finanzierten. Die Feuerwaffen dieser
Büchsenmacher waren zu aufwändig in der Produktion und wurden daher nur
von wenigen Adeligen oder wohlbetuchten Bürgern in Auftrag gegeben.

Plattnerhandwerk
Am Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert kam es zur Arbeitsteilung im
Schmiedehandwerk. Die Produktionsprozesse wurden kleinteiliger und
spezialisierter. Zu diesen Spezialisten gehörten auch die Plattner, die
Rüstungen und Harnische herstellten. Mit großer Kenntnis der Anatomie
passten sie die Rüstungen dem jeweiligen Auftraggeber an. Dabei war es
notwendig eine Balance zwischen Gewicht, Schutzfunktion und
Tragekomfort zu erzielen. Die Hochblüte erreichte das Handwerk um 1500
als viele Plattner zu Metallkünstlern geworden waren, die geschwärzte
oder bläulich erhitzte Harnische herstellten und diese aufwändig
verzierten.

Willkommensbecher in der Form eines Zweimastseglers. Nachbildung eines Zinngefäßes aus dem 17. Jhdt.

In Waidhofen/Ybbs können zwischen 1553 und 1896 mehrere Zinngießer,
auch Kandlmacher genannt, nachgewiesen werden. Sie stellten aus Zinn
vor allem Schüsseln, Krüge, Kannen, Teller, Flaschen, Leuchter und
viele an-dere Gerätschaften des täglichen Lebens her. Zinn wurde in
verschiedenen Qualitäten hergestellt, je nach Menge des für die
Legierung verwendeten Bleis. Da die Verwendung von Blei bei allen
Gebrauchsgegenständen, die zur Nahrungsaufnahme dienten, äußerst streng
limitiert war, wachte ein Kontrollsystem über die Kennzeichnung der
Qualität und deren nachhaltige Sicherung.

Die ursprünglich mittelalterliche Burg mit Baukern aus der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts war jahrhundertelang Sitz der
freisingischen Pfleger. Der berühmteste Besitzer des Schlosses war
Albert Salomon Anselm von Rothschild (1844–1911), der es ab 1875 zum
Sitz der Verwaltung seiner ausgedehnten Güter machte. Auf seine
Veranlassung hin fand unter Mitwirkung des Wiener Dombaumeisters
Friedrich von Schmidt (1825–1891) ein tiefgreifender neugotischer Umbau
statt.
Heute im Besitz der Stadt, wurde das Gebäude bis 2007 einer
grundlegenden Renovierung unterzogen, im Rahmen derer durch den
Architekten Hans Hollein neue architektonische Akzente gesetzt wurden.
Heute beherbergt es neben verschiedenen anderen Einrichtungen der Stadt
Waidhofen das, sich der Geschichte der Stadt widmende „5e-Museum“.

HAFTBEDINGUNGEN - Wolf Ebenperger
Aus der kaiserlichen Reiterei als Kurier kommend, trat er als
Stadtschreiber am 16. Mai 1553 den Dienst in Waidhofen an der Ybbs an.
Er bekleidete dieses Amt 25 Jahre lang und wurde 1578 Mitglied des
Rates der Stadt. Er war überzeugter Protestant. In erster Ehe war er
mit Margarete Tätzel aus einem hoch angesehenen Bürgerhaus und 1572 in
zweiter Ehe mit der adeligen Dorothea Pinter von der Au verheiratet.
Aus beiden Ehen stammten fünf Söhne und eine Tochter. Er war eine
außerordentliche Führerpersönlichkeit, die zielstrebig seine
persönlichen Dinge als auch die Anliegen der Stadt vertrat. Er brachte
es auch zu einem beachtlichen Reichtum.
Zur Zeit der Reformation waren 90 Prozent der Waidhofener Protestanten.
Die Einwohner erreichten durch die Eisenverarbeitung und den Handel
einen gewissen Wohlstand. Große Brände und Hochwasser brachten aber
dann Armut. Durch die Strenge der Amtsführung des Rates, die
Streitigkeiten mit der Kirche, mit dem Grundherrn und dem Pfleger - wie
immer ging es um Macht und Geld -brachte die in Not geratenen Bürger
dazu zu revoltieren. So kamen bischöfliche und landesfürstliche
Kommissionen, um nach dem Rechten zu sehen. Am 26. September 1587
setzte man den gesamten evangelischen Rat ab und begann mit den
Verhören. Die Anklage lautete auf Missachtung der
bischöflich-freisingischen und kaiserlichen Autorität, Amtsmissbrauch,
Verursachung von Aufständen, Unterschlagung von Müdelgeldern,
Verschwendung von Stadteinkünften und vieles mehr. Dem gesamten Rat
wurde eine Geldstrafe von 32.000 Talern auferlegt. Ebenperger musste
davon die Hälfte zahlen und wurde außerdem noch zum Tode verurteilt.
Dieses Urteil wurde vom Kaiser in lebenslängliche Haft umgewandelt. Er
wurde von der Schranne weg in Eisen gelegt und sofort hier in den
Schlossturm gebracht, wo er auch starb.
In dieser Zeit der härter zugreifenden Gegenreformation und dies war
wohl der eigentliche Grund seiner Verurteilung - starb Ebenperger nach
Meinung vieler Experten als Märtyrer seines Glaubens.

HAFTBEDINGUNGEN - Ausschnitte aus Wolf Ebenpergers Briefen aus dem Kerker:
Er schreibt am 20. Juli 1588, dass er seit 41 Wochen in dem „fenckhnuß
verstrickht" - im Gefängnis gefesselt - und in dieser großen Hitze am
Verschmachten sei. Er habe noch kein einziges Mal, seit er sich hier
befindet, Kopf und Körper waschen können. Er sei ein „madensackh", was
so viel wie ein menschlicher Leib in einem Sack, an dem die Maden
nagen, bedeutet. Er „bittet verner in aller christlicher diemueth
(Demut)" um ein frisches Gewand, da die „lebendig unsauberkbait" -
damit ist das Ungeziefer gemeint, ihm große Beschwerden verursacht. Er
schreibt darüber „mit stätter unaufhorlicher Pein also gemarter werden,
do Ich doch sonsten das leben vill lieber aufgeben und verlasset
wolet".
Er fleht immer wieder, dass ihm die eisernen Fußfesseln abgenommen
werden, da er bereits wunde Füße habe. Er bittet um ein „Fußwasser" zur
Linderung der Schmerzen. Auf einem Zettel, der bei den Briefen lag,
steht, dass am Samstag vor Jakobi 1588 Neumond war und dass am Sonntag
danach, den 24. Juli, und am Montag und Dienstag „mich der sandt
ankhommen und hardt geplagt" hat und Mittwoch abends dann das „Staindl"
abgegangen ist. Danach erfolgte eine Besserung, für die er Gott Lob und
Dank sagte. Er wollte Hilfe und Arznei für seine Nierensteinkolik und
schrieb daher an die Frau des Pflegers. Er erhielt aber weder Antwort
noch Medikamente, auch nicht den Tee, um den er bat.
In seinem letzten erhaltenen Brief aus dem Gefängnis vom 3. Dezember
1588, der nur sehr kurz ist, etwas mehr als eine halbe Seite lang,
schreibt er: „tag und nacht mein ellendes und schwäres leben im frost,
eisnen pannden, und grossen khom(m)er", dass er Tag und Nacht bei Frost
mit eisernen Fesseln und großem Kummer zubringen muss, bittet er Gott
gnädig um Erbarmen, man möge ihn von diesem schweren Kreuz befreien -
„disem schwären creytz und ellend schier entledigen........ mein not in
dieser schwären keltten" - bittet er vorsprechen zu dürfen, da er der
Kälte wegen so steife Finger habe, dass er die Feder nicht mehr halten
könne.
Dieser Brief ist sein letztes schriftliches Lebenszeichen aus dem
Gefängnis, das erhalten ist. Er muss aber den Winter doch noch überlebt
haben. Er wurde nämlich zu alten Erbangelegenheiten befragt und das war
wahrscheinlich der Grund für das Schreibzeug in der Zelle. Seine
Stellungnahmen dazu sind im Ratsprotokoll vom 5. Mai 1589 erhalten.
Vermutlich ist er danach seinem Leiden, hervorgerufen durch die elenden
Haftbedingungen, erlegen. Bis zu seinem Tod hat er also ungefähr 18
Monate in diesem Gefängnis unter fürchterlichen Zuständen
dahinvegetiert.

In der weltlichen Gerichtsbarkeit wurde die Folter
bei uns im späteren Mittelalter, ja bis weit in die Neuzeit hinein
praktiziert. Sie entwickelte sich als geeignetes Mittel im
Strafverfahren und wurde meist so definiert: ein von einem Richter
rechtmäßig in Gang gebrachtes Verhör unter Anwendung körperlicher
Zwangsmittel zum Zwecke der Erforschung der Wahrheit über ein
Verbrechen. Nach mittelalterlicher Auffassung konnte eine Verurteilung
entweder auf Grund der Aussage zweier glaubwürdiger Augenzeugen oder
auf Grund eines Geständnisses erfolgen. Um die Wahrheit vom
Delinquenten zu erfahren, wurde ein strafrechtliches Verhör oder - wie
es hieß - eine peinliche Befragung, sprich Folter, meist Marter und
Tortur, durchgeführt. Die Folter selbst war keine Strafe, sondern eine
Maßnahme des Strafrechtsverfahrens und sollte eine
Entscheidungsgrundlage liefern. Diese peinlichen Befragungen erfolgten
in den Folterkammern. Die Existenz einer Folterkammer, die sich hier im
Schlossturm befand, ist nachgewiesen und diente dem freisingischen
Blutgericht zur vermeintlichen Wahrheitsfindung.
FOLTERMETHODEN
Beim Pendel wurden dem
Angeklagten die Hände auf den Rücken gebunden, dann ein über eine Rolle
laufendes Seil um seine Hände geschlungen. An diesem Seil wurde der
Angeklagte in die Höhe gezogen und eine Weile hängen gelassen. Beim
zweiten Grad der Folter wurde ein Gewicht an die Füße gehängt. Beim
dritten Grad ein noch schwereres Gewicht. Diese hatten eine starke
Verrenkung und Auskegeln der Glieder zur Folge.
Das Strecken oder das
„Aufziehen auf einer Leiter" gehörte ebenfalls zum zweiten Grad der
Folter. Dem Angeklagten wurden die Hände am oberen Ende der Leiter
festgebunden. Die Hände wurden rückwärts über den Kopf hochgezogen, bis
beide Arme ausgestreckt waren und dann wurde der zu Befragende mit den
Füßen nach unten gezogen. Um die Folter zu verstärken, konnte der
Scharfrichter brennende Kerzen an den Leib des Inquisiten halten.

Die Daumenschraube besteht aus
zwei flachen Eisen, die mit spitzen Knöpfen ausgestattet sind. Diese
Knöpfe sind versetzt auf der Innenseite der Eisen festgemacht. Die zwei
Eisen werden durch Schraubenspindeln und Schraubenmuttern
zusammengehalten. An einer Schraubenmutter ist der Schraubenschlüssel
angebracht. Wird dieser gedreht, werden die beiden Eisen und damit die
eingeklemmten Finger zusammengedrückt.
Der Prügeltisch diente für jene
Straftaten, die durch Verstümmelung gesühnt werden sollten, die
sogenannten. „lybstraffen", wie das Abschneiden oder Anschneiden von
Körperteilen z. B. Ohren, Zunge, weiters für Auspeitschen oder
Brandmarken. Das „Schwemmen" war eine besonders schreckliche Art der
Folter. Mit einer Art Birne wurde der Mund aufgespreizt und Wasser mit
Gewalt eingeflößt bis die Organe versagten. Der Mundartbegriff „mir
steigen die Grausbirnen auf" stammt von dieser Methode. Die
Delinquenten wurden angeschnallt, um die Torturen an ihnen durchführen
zu können.
Dem Ideenreichtum und der Grausamkeit der peinlichen Befragung oder
auch hochnotpeinlichen Befragung waren keine Grenzen gesetzt. Die so
Befragten mussten unsagbare Qualen erduldet haben und man hat
wahrscheinlich nach einiger Zeit ohnedies alles gestanden. Die Folter
wurde schon von jeher von allen Völkern als Verhörmethode eingesetzt,
entwickelte sich jedoch regional höchst unterschiedlich. Schriftlich
beurkundet ist die peinliche Befragung 1532 unter Kaiser Karl V. in der
reichseinheitlichen Halsgerichtsordnung, der so genannten Constitutio
Criminalis Carolina. Unter Maria Theresia wurden viele Foltermetoden
abgeschafft und die weiterhin erlaubten in der Constitutio Criminalis
Thersiana 1769 zusammengefasst. Nicht gefoltert werden durften Kinder,
schwangere Frauen und alte Menschen. Gegner gab es immer schon. Einer
von ihnen war der reformierte Pfarrer Anton Praetorius, er sagte ihr
schon 1602 den Kampf an. Er bezeichnete die Folter als barbarisch,
unmenschlich und ungerecht. Erst in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurde jede Art von Folter verboten.

ZUNFTGERICHTSBARKEIT
Die Zünfte, das heißt der der Zunft vorstehende Meister durfte bei
kleineren Delikten wie Trunkenheit, Raufereien in Gasthäusern,
Missachtung der Kleidervorschriften, Fernbleiben vom Arbeitsplatz,
Nichterscheinen zum Gottesdienst und ähnlichem Strafen verhängen. Die
festgesetzten Handwerksstrafen mussten je nach Schwere des Vergehens
mit einem halben bis vier Pfund Wachs oder ein bis zwei Krügel Wein
abgegolten werden. Für die Gesellen waren diese Beträge recht
schmerzhaft, denn sie bekamen von ihren Meistern Kost, Logis, Kleidung
und nur einen bescheidenen Geldbetrag.
NIEDERGERICHTSBARKEIT
Diese Gerichtsbarkeit stand dem Richter und Rat der Stadt zu. Hier
wurden auch die meisten Fälle abgehandelt, denn die häufigsten Delikte
waren Raufereien mit oder ohne Körperverletzungen, Ehrenbeleidigungen,
Ehebruch und uneheliche Kinder von Mägden, Gotteslästerungen und
Alkoholdelikte. Das Stadtgericht konnte zu Geldstrafen, Strafarbeit,
Pranger- und Ehrenstrafen, zum Stadtverweis sowie Arrest verurteilen.
Die vielen kleinen Delikte und Streitigkeiten, die vor dem Stadtgericht
ausgetragen wurden, hat man meist mit einer Geldbuße belegt. Dies war
daher auch eine gute Einnahmequelle für die Stadt. Am Anfang des 19.
Jahrhunderts - nach dem Ausscheiden aus dem freisingischen
Herrschaftsbereich - wurde ein k.k. Bezirkscollegialgericht im Schloss
installiert, das die Aufgaben der Stadt übernahm.
LANDGERICHTSBARKEIT
Das Rädern war wohl eine der
qualvollsten Todesarten. Es wurde an Mördern und Räubern, meist
Männern, vollstreckt. Männer wurden zu blutigen Todesstrafen
verurteilt. Der auf spitzen Scheitern liegende nackte Körper des
Delinquenten wurde durch eine vorgeschriebene Anzahl von Schlägen mit
einem Wagenrad massakriert. Der geschun-dene Körper wurde dann zum
Sterben auf ein Rad geflochten. Als besondere Gnade galt es, wenn der
Scharfrichter ihm mit einem Stoß das Genick brach und ihn so tötete.
Gerädert wurde in Waidhofen Hans Grienwaldt, vulgo der Zigeunerhansl.
In der Ratssitzung vom 23. August 1651 verliest der Stadtrichter Johann
Häckhl ein „Decret" von der fürstlichen Herrschaft, dass am künftigen
Freitag der arretierte Hans Grienwaldt mit dem Rad zum Tode befördert
werden soll.
Enthaupten war die Strafe für
Todschlag und Raub und im Wege der Gnade für jede andere Missetat. Für
den Scharfrichter stellte das Enthaupten die schwierigste Aufgabe dar.
Er musste dem Verurteilten mit einem Schlag von hinten den Kopf
abschlagen. Dabei musste er das Schwert mit beiden Händen führen und
mit einer Körperdrehung den Schwung holen. Die
Verurteilung und Hinrichtung der Maria Wahlnerin: Sie beging ein
Kapitalverbrechen ein Judicium capital und wurde vom Richter und Rat
der Stadt und dem Bannrichter zum Tode durch das Beil des
Scharfrichters verurteilt.
Hängen galt als die häufigste
Todesstrafe. In unserer Stadt gab es einen Galgenplatz, wo diese
Strafen vollzogen wurden. Auf der sogenannten Burgbannzeichnung von
Lorenz Thurman sie zeigt Waidhofen in der Mitte des 16. Jahrhunderts
ist die Kapelle und der Galgen sichtbar. Die Galgenplätze waren auch
Richtstätten und lagen jeweils außerhalb der Stadt. Beim Bau der
Kronprinz Rudolf-Bahn im Bereich des Patertals fand man bei den
Bauarbeiten viele Totenschädel und Gebeine. Da die Verbrecher nicht in
geweihter Erde begraben werden durften, verscharrte man sie einfach
unter dem Galgen. Die Hinrichtungen waren immer öffentliche schaurige
Schauspiele und lockten viele Leute an. Das ganz hatte einen
volksfestähnlichen Charakter. Genau so interessierte man sich auch für
die Gerichtstage von Malefizprozessen die auf der Schranne abgehalten
wurden.
Weitere Todesstrafen waren: Verbrennen, Ertränken, lebendig Begraben, Erdrosseln, Einmauern, Pfählen, Spießen usw.
Dem freisingischen Pfleger wurde die Aufgabe zuteil, bei den
Malefizprozessen - für schwere Verbrechen - das Urteil zu sprechen. Der
Prozess wurde in Fällen wie bei Mord, Kindstötung, Brandstiftung und
Raub auch unter Mitwirkung von landesfürstlichen Bannrichtern und
Bürgern der Stadt als Schöffen geführt. Bei diesen Prozessen wurde auch
die Folter angedroht und angewandt. In manchen Fällen genügte schon das
Zeigen der Foltergeräte, um ein Geständnis zu bekommen. Die Strafen
waren je nach Delikt Gefängnis, schwere Leibstrafen und auch die
Todesstrafe. Die gebräuchlichsten Formen der Todesstrafe waren Rädern,
Köpfen, Aufhängen und „Verhungernlassen".

BÄCKERSCHUPFEN
Der Bäcker, dem nachgewiesen wurde, dass er sein erzeugtes Brot mit zu
geringem Gewicht oder aus schlechtem Mehl verkaufte, wurde zum
sogenannten „Schupfen" verurteilt. Diese Strafe war ungemein demütigend
und peinlich. Die Vollziehung der Strafe war ein reines Volksfest. Vom
Richter und Rat in Waidhofen wurde folgender Beschluss gefasst: Die
Müller haben den Bäckern gutes weißes Mehl mit dem richtigen Maß zu
liefern und die Bäcker haben die Semmeln mit dem richtigen Gewicht zu
backen. Bei zuwider handeln werden sie mit dem „Schupfen" bestraft.
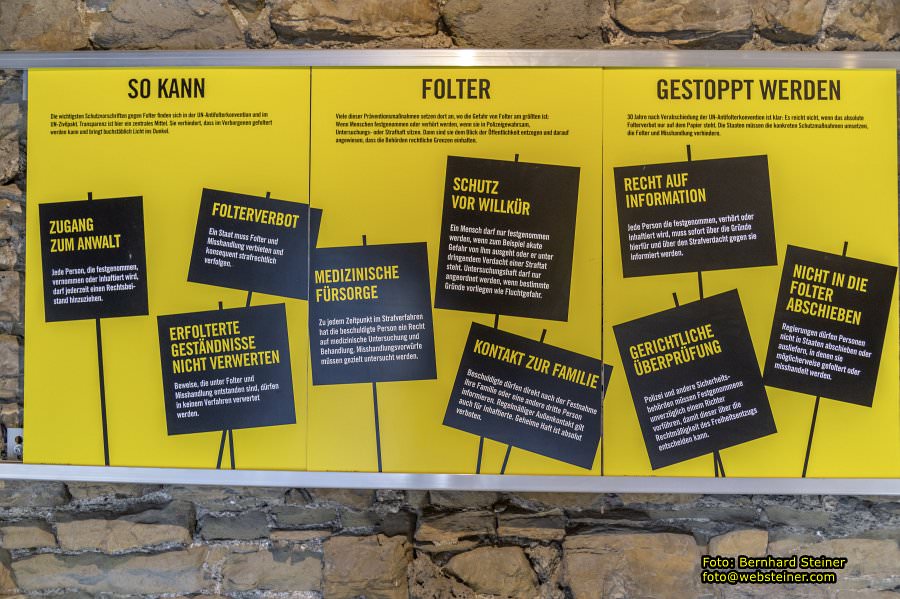
Schloss Waidhofen liegt auf einem Konglomeratfelsen über dem Fluss
Ybbs, im Mündungszwickel zwischen Ybbs und Schwarzbach. Es bildet die
Spitze eines spitzwinkeligen Dreiecks, dessen Fläche der historischen,
ehemals befestigten Innenstadt von Waidhofen an der Ybbs entspricht. In
unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das noch heute durch Mauern
und den Turm des ehemaligen Zeughauses befestigte Areal der
Stadtpfarrkirche. Diese Gebäude bilden gemeinsam, vor allem wenn man
mit der Bahn oder dem PKW von Amstetten kommt, das beeindruckendste
Ensemble der Stadt.

Die Haftbedingungen, im Gefängnis hier im Turm, waren im 16.
Jahrhundert unmenschlich. Im Sommer war es in diesen Verliesen
unbeschreiblich heiß und im Winter eiskalt. Die Häftlinge waren
angekettet und hatten meist eiserne Fesseln an Händen und Füßen. Die
hygienischen Verhältnisse waren schrecklich und alles war voll
Ungeziefer. Die Briefe Wolf Ebenpergers, der hier im Jahr 1588
eingesperrt war, um eine lebenslange Haftstrafe zu verbüßen, schrieb an
den Pfleger Christof von Murhammer. Zwölf Briefe sind im Stadtarchiv
von Waidhofen an der Ybbs erhalten und geben uns eine genaue Schil
derung der Zustände. Der ehemalige Stadtschreiber und Führer der
Protestanten, ein gebildeter Mann, schildert wortgewandt und bildhaft
die Situation.

Die Kontrolle des Feuers war ein wichtiger Schritt in der Entstehung
menschlicher Kulturen und Zivilisationen. Eisenerzeugung und
Eisenverarbeitung ohne Feuer sind undenkbar. Sowohl Schmiede als auch
Köhler arbeiten mit Feuer. Feuer
spielt für Städte eine entscheidende Rolle. Stadtbrände und Kriege
bedrohten mit ihrem Feuer eine Stadt, wie man auf den
„Franzosenbildern" erkennen kann. Feuer steht für Fanatismus, aber auch
Aufklärung und Vertreibung aller Arten von Aberglauben. Das Licht ist
Zeichen des Glaubens und Symbol des Heiligen.

Der Zweite Weltkrieg
Unter großem Jubel hatte Waidhofen 1938 dem Anschluss an das Deutsche
Reich zugestimmt, nur um ein Jahr später die ersten Gefallenen des
Krieges betrauern zu müssen. Die Erfolgsmeldungen des „Boten von der
Ybbs" täuschten die Bevölkerung lange über die Verluste und den
Niedergang des „tausendjährigen" Reichs hinweg. Obwohl Waidhofen
Bahnknotenpunkt war, war es doch kein primäres Angriffsziel der
Alliierten, da es keine kriegswichtige Industrie hatte. So fielen erst
Ende 1944 Bomben auf die Stadt und forderten Todesopfer. Dennoch
spielte Waidhofen als NS-Musterstadt eines ehrgeizigen Bürgermeisters
und letztes Hauptquartier der Heeresgruppe Süd unter Generaloberst
Lothar Rendulic eine wichtige Rolle. Erst am 7. Mai kapitulierte
Rendulic vor den Amerikanern, bevor am 9. Mai die sowjetischen Besatzer
einzogen. Die im Lager Sandhof in Windhag inhaftierten Juden und
politischen Gefangenen wurden in grausamen Todesmärschen verlagert und
zu Tode gehetzt. Viele Soldaten aber auch Zivilisten nutzten die nahe
oberösterreichische Grenze, um noch in die amerikanische Besatzungszone
zu entkommen.
So fängt es für gewöhnlich an: Es findet sich ein Dunkelmann, der von
geheimen Quellen flüstert und von gewissem Wissen wispert, bis er,
durch Lügen vorbereitet, Gerüchte ausstreut und verbreitet: Die Dinge
schienen schlecht zu stehn und könnten leicht noch schiefer gehn. Ganz
B-Stadt sei ein Trümmerfeld, der Krieg verschlinge unser Geld, man
denke nur mal an die Währung, an Überbomber und Ernährung, an
Rohstoffnot und U.S.A., an Riesentanks und Cholera.. Das Herz könnt
einem dabei brechen. Doch solle man nicht drüber sprechen.
Du, Volksgenosse, hast erfaßt, was Du von dem zu halten hast, der flüsternd durch den Alltag kriecht.
Sieh ihn Dir an: Wer flüstert, lügt!

Osmanenkriege - Die erste
Bedrohung durch die Osmanen erreichte Waidhofen 1532. Als Vorhut
verbreiteten Akindschi-Reitertruppen Angst und Schrecken in den
umliegenden Dörfern. Bewaffnete Bürger zogen ihnen entgegen und
vertrieben sie. Die zurückgelassenen Pferde und Beutestücke
ermöglichten den Bau des Stadtturms als Zeichen des Sieges.
Bauernaufstände - 1597 hatten
sich Mostviertler Bauern im Haager Bund organisiert, um gegen die
Unterdrückung durch Robotleistungen und Zehent zu protestieren. Gegen
die Anordnung des freisingischen Pflegers Christoph Murhammer ließen
die Einwohner die Bauern in die Stadt ein, versorgten sie mit
Lebensmitteln und wurden dadurch verschont.
Die Napoleonischen Kriege - Zu
den Schätzen des Museums zählt ein Gemäldezyklus, der die mehrmalige
Besetzung der Stadt im Zuge der Napoleonischen Kriege [1800 bis 1806]
darstellt. Er vermittelt nicht nur eine sehr genaue Vorstellung davon,
was Krieg in diesen Zeiten für die Bevölkerung bedeutete, sondern ist
auch als baugeschichtliche Quelle wichtig. Zwei Autodidakten
überlieferten diese einzigartigen Geschichtsquellen, die durch
schriftliche Chroniken aus dem Stadtarchiv ergänzt werden. Sebald
Grünschachner und Johann Engleitner dokumentieren die „freiwillige"
Unterwerfung der Bürger, die zur Kenntnis nehmen mussten, dass
mittelalterliche Wehrmauern keinen Schutz gegen die Artillerie des 19.
Jahrhunderts boten.

Der ewige Konkurrent
Der Blick über die Ybbs zeigt den blühenden Waidhofner Ortsteil Zell,
der als sonniges Siedlungsgebiet besonders beliebt bei den Einwohnern
ist. Doch das war nicht immer so. Erst 1972 wurde die selbstständige
Gemeinde Zell nach Waidhofen eingemeindet. Die ursprünglich dem
Hochstift Passau untergeordnete Herrschaft Gleiß, zu der auch Zell
gehörte, wechselte im Lauf der Jahrhunderte oft ihre Besitzer. Für die
Waidhofner blieben die Probleme jedoch stets dieselben. Bürger der
Stadt, die sich den Steuern in Waidhofen entziehen wollten, siedelten
in Zell und im 16. und 17. Jahrhundert war Zell Zufluchtsort für
Protestanten, die aus Waidhofen ausgewiesen wurden. Außerdem blieb der
konkurrierende Eisenhandel ein ständiges wirtschaftliches Ärgernis.
Mehrere Versuche des Hochstifts Freising, die Herrschaft Gleiß zu
kaufen, blieben ergebnislos. Besonders der Bau des Zeller Schlosses als
neuen Verwaltungssitz genau gegenüber der Stadtburg der Freisinger
Bischöfe und die Markterhebung Zells 1690 unter den Fürsten von
Montecuccoli belasteten das Verhältnis zwischen den beiden Gemeinden
erheblich. Am heftigsten entzündeten sich die Querelen, wenn es um die
Bau- und Unterhaltskosten für die damals einzige Brücke ging. Noch
1898, als die heutige Zeller Hochbrücke errichtet wurde, verweigerte
der Waidhofner Stadtrat die Beteiligung an den Kosten. Heute ist Zell
der Ortsteil Waidhofens mit den meisten Bewohnern und durch 7 Brücken
und Stege mit der Stadt eng verbunden.

Reformationsstadt- Junge
Waidhofner kamen in Wittenberg in Kontakt mit Martin Luther und seinen
Mitstreitern und begeisterten sich für seine Thesen. Schnell
verbreitete sich das protestantische Gedankengut und machte aus
Waidhofen eine Stadt der Reformation. Die Wirkung war umso größer, weil
sie verbunden war mit einer lange schwelenden Opposition gegen den
bischöflichen Stadtherrn und seine Pfleger. 1587 schließlich eskalierte
der Streit, als der Stadtschreiber Wolf Ebenperger das Mohrenwappen vom
Stadttor entfernen und durch landesfürstliche Insignien ersetzen ließ.
Eine Kommission setzte den Stadtrat ab und verurteilte ihn zu
lebenslanger Haft. Viele protestantische Familien wanderten aus.
Lutherbibel von 1729

Tabernakelschrank mit barocken Monstranzen
Die sakralen Exponate weisen auf die starke Belebung der Prozessionen
und Wallfahrten hin. Auch in der barocken Ausgestaltung vieler Kirchen
und Klöster unserer Region manifestierte sich dieses neue religiöse
Gefühl.

Gegenreformation
Die Absetzung und Verurteilung des protestantischen Stadtrats 1587
hatte für die Waidhofner Bürger eine Zeit der Repressionen zur Folge.
Dabei ging es nicht nur um die zwangsweise Rekatholisierung, sondern
auch um den Versuch, die grundherrschaftlichen Rechte des Freisinger
Bischofs wieder durchzusetzen. Wer sich nicht zur katholischen Lehre
bekennen wollte, verlor seine Bürgerrechte und wurde ausgewiesen. Der
wirtschaftliche Aderlass für die Stadt war enorm. Erst im 17.
Jahrhundert wurde die kirchliche Reorganisation durch eine Reihe gut
ausgebildeter Pfarrherren auf maßvolle Weise und mit vorgelebter
Überzeugungskraft vorangetrieben.

Eine Stadt am Fluss, wie Waidhofen, lebt vom und mit dem Wasser.
Die Ybbs diente als Transportweg (Flößerei), ihre Seitenbäche als
Antrieb für die Hämmer. Heute ist die Ybbs Standort für mehrere
Kraftwerke, die den Strom für Waidhofen erzeugen. Die Brücken und Stege
verbinden die beiden Stadtteile und sind beliebtes Motiv für Künstler.
Für die Hygiene waren Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wichtig
und die Stadt ist heute stolz auf ihr gutes Trinkwasser. Bäder und
Heilanstalten förderten die touristische Entwicklung Waidhofens.

Der Wald war der Reichtum der Eisenwurzen. Mit Holzkohle speiste man die Schmiedefeuer. Städte waren auf die Versorgung mit Holz
angewiesen - als Heiz- und Baumaterial, aber auch als Werkstoff. Auch
viele Gewerbe wie Seifensieder, Bäcker und Bierbrauer brauchten Holz
als Brennstoff. Als Werkstoff für Tischler, Drechsler oder Binder war
Holz die Grundlage für Nutzgegenstände oder Luxusmöbel. Holz prägt
Waidhofen weiter vom Holzspielzeug der museumseigenen Spielzeugsammlung
bis zu den immer noch in der Stadt präsenten Holz verarbeitenden
Betrieben.

Holzbearbeitung - Holz ist noch
heute einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt, der durch sein
Nachwachsen geradezu unerschöpflich scheint und daher zu den
nachhaltigsten Energiequellen und Grundstoffen zählt. Die grundlegenden
Werkzeuge der verschiedenen Handwerkssparten der Holz verarbeitenden
Branchen wie Zimmerer, Tischler oder Fassbinder haben sich bis heute
wenig verändert. Sie wurden lediglich durch moderne Maschinen
erweitert. Waidhofen ist in der glücklichen Lage, sogar noch zwei
Fassbinder im Ort zu haben, die dieses fast vergessene Handwerk ausüben.

Möbel als Glanzstücke des Wohnens
Die älteste Aufzeichnung über das Inventar der bischöflichen Burg Waidhofen stammt aus dem Jahr 1313.
Der spätgotische Stollenschrank des Museums zählt zu den ältesten
Schaustücken und stammt aus dem Jagdhaus des Barons Rothschild in
Atschreith. Möbel aus Hartholz waren im 17. und 18. Jahrhundert dem
Adel und städtischen Patriziat vorbehalten. Vor allem Truhen dienten
zur Aufbewahrung von Kleidung, ergänzt durch Wirtschaftsmöbel und
Schränke. Die Massenherstellung von kostspieligeren Möbeln wie
Glasschränke, Spieltische und Kommoden wurde erst mit dem Aufstieg des
Bürgertums im 19. Jahrhundert üblich.
Bäuerliche Möbel - Relativ
lange unbeeinflusst vom Stilwandel blieben die bäuerlichen Kästen und
Truhen des Ybbstaler Voralpenlandes. Die zweckmäßigen Möbel wurden ab
dem 16. Jahrhundert gerne mit floralen oder religiösen Malereien
verziert.

Lundby Puppenhaus „Stockholm"
Seit 1949 produzierte das schwedische Unternehmen „Lundby" Puppenhäuser
und Möbel, in den 1960/70er Jahren verbreiteten sie schwedisches
Wohngefühl weltweit. Die Villa „Stockholm" wurde 1976-1984 produziert.
Das Haus stammt von Familie Bader, Waidhofen/ Ybbs. Der Unterstock mit
Garten wurde von Friederike Kaltenbrunner ergänzt. Die BewohnerInnen
sind Lundby, Town Square, Ari und Caco Puppenhauspuppen sowie
Schleich-Tiere.

Nachgebaute Biedermeierstube 1975-1992

Kaufmannsladen um 1940

Bürgerstube un 1900

Mizzi Miel, verh. Sitz (1923-1995)
Das blaue Emaillegeschirr stammt aus Mizzis Elternhaus in der
Weyrerstraße. Sie war eine Schulfreundin von Hilde Kaltenbrunner in der
Handelsschule.
Gisi von Lazarini (1900-1971)
Puppenküche der Baronesse von Lazarini, der gehbehinderten Enkelin des
Bürgermeisters Baron Plenker, nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Küche
von Fam. Putzer gekauft, drei Generationen Kinder der Familie spielten
damit, bis nur mehr das Gehäuse und die Kredenz erhalten waren. Fam.
Kaltenbrunner rekonstruierte und baute die restlichen Möbel, der
Messingherd von Otto Kaltenbrunner ist sogar beheizbar.

Konditorei - von Familie Kaltenbrunner, Puppenköpfe 19. Jh.

Mostviertler Spielzeugwelt - Ausgewählte Stücke der Sammlung Kaltenbrunner und der Sammlung Wilhelm laden ein, in kindliche Fantasiewelten einzutauchen.


1875 wurde das Waidhofner Schloss vom mächtigen österreichischen
Bankier Albert Salomon Anselm Freiherr von Rothschild (1844–1911)
gleichzeitig mit den ehemaligen Herrschaften Waidhofen an der Ybbs,
Gaming und Enzersfeld um 2,9 Millionen Gulden gekauft. Er wurde damit
zum größten Landbesitzer (31.000 ha) in Niederösterreich. Nach dem Tode
Albert Rothschilds 1911 (damals der reichste Mann Europas) übernahm
sein Sohn Louis Nathaniel Freiherr von Rothschild (1882–1955),
Präsident der Creditanstalt und einer der einflussreichsten Männer der
Monarchie, die Besitzungen. 1938 wurde er von der SS verhaftet. Für
seine Ausreise erpresste man ein enormes Lösegeld, Schloss und
Landbesitz wurden enteignet und gingen in Staatsbesitz
(Reichsforstmeister) über.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: